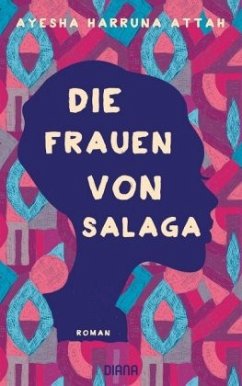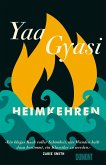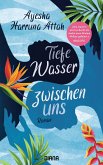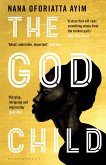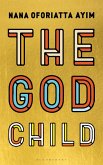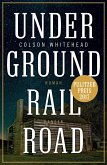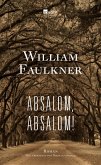Westafrika, Ende des 19. Jahrhunderts. Aminah, ein verträumtes junges Mädchen, wird brutal aus ihrem Zuhause gerissen und als Sklavin verkauft. Wurche ist eine privilegierte Frau, doch ihr Vater zwingt sie, eine ungewollte Ehe einzugehen. Als Aminah und Wurche sich auf dem Sklavenmarkt von Salaga begegnen, verbinden sich ihre Schicksale unwiderruflich miteinander. Beide hadern mit den Grenzen, die ihnen Zeit und Gesellschaft auferlegen. Beide riskieren ihr Leben. Und beide verlieben sich in denselben Mann.

In ihrem bewegenden Roman „Die Frauen von Salaga“ erzählt die ghanaische Autorin
Ayesha Harruna Attah, wie Afrikaner sich vor der Kolonialisierung gegenseitig zu Sklaven machten
VON JONATHAN FISCHER
Schon dafür musste dieser Roman geschrieben werden: um unser Bild vom Afrika des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu erschüttern. Und vor allem: die Rollenbilder innerhalb westafrikanischer Familien zu verkomplizieren.
In ihrem Roman „Die Frauen von Salaga“ lässt die junge ghanaische Schriftstellerin Ayesha Harruna Attah eine Zeit, in der die Geschichtsbücher hauptsächlich von der wirtschaftlichen und politischen Expansion der europäischen Kolonialmächte in Westafrika berichten, in der Perspektive zweier sehr ungleicher afrikanischer Frauen lebendig werden. Herrin und Sklavin einerseits. Aber eben auch Frauen, die sich – der Männerherrschaft und allen Grausamkeiten des Menschenhandels zum Trotz – Freiräume erträumen und erkämpfen. Eine der beiden Figuren, Aminah, hat Attah ihrer eigenen einst mit Gewalt verschleppten und versklavten Ururgroßmutter nachempfunden und stellt ihr eine junge, eigenwillige und nach politischer Mitsprache strebende Häuptlingstochter namens Wurche entgegen, die allerdings selbst Sklavenhalterin ist und zunehmend in Gewissenskonflikte gerät.
Leicht hätte aus den historischen Kriegswirren zwischen Kolonialisten, Sklavenräubern und sich um die Häuptlingsehre befehdenden Clans eine Heldensage im Stile von „Game of Thrones“ werden können. Oder ein Märchen: Die Geschichte eines Mädchens, das in einen Brunnen fällt und eine Zeitreise zu seiner Ahnin antritt, gehörte zu Attahs ersten Entwürfen. „Fiktion“, sagt Attah, „kann den Leser viel kraftvoller an den Haken nehmen als jedes historische Dokument.“ Aber welche Erzählperspektive ist glaubwürdig? Und wie lassen sich überkommene (Herrschafts-) Diskurse umgehen?
Attah, die erste journalistische Erfahrungen in der von ihren Eltern herausgegebenen Zeitung Accra Mail sammelte, später in New York Journalismus und kreatives Schreiben studierte und heute in Senegal lebt, hat vor allem im englischsprachigen Afrika einen Namen. Ihr erster Roman „Harmattan Rain“ wurde 2010 für den Commonwealth Writers’ Prize nominiert. Mit „Die Frauen von Salaga“ aber scheint ihr nun auch international der Durchbruch zu gelingen. Der Roman erscheint unter anderem in deutschen, holländischen und türkischen Übersetzungen.
Im englischen Original heißt das Buch „The Hundred Wells of Salaga“: Eine Anspielung auf die vielen Brunnen, die einst gebaut wurden, um die Sklaven für den Verkauf auf dem Markt im Norden Ghanas zu waschen. Darunter auch Attahs Ururgroßmutter. „Ich wusste nur, dass sie als Kind im heutigen Mali oder Burkina Faso lebte, bis sie Menschenhändler verschleppten“ sagt Attah im Gespräch, „Dennoch bewegte mich ihr Schicksal: In der Schule hatte ich vor allem vom transatlantischen Sklavenhandel gehört, und dann erfuhr ich, dass meine Ururgroßmutter von Menschen mit der selben Hautfarbe wie sie selbst versklavt wurde. Das schockte mich!“
Um ein besseres Bild ihrer Ahnin zu bekommen, besuchte Attah ihre verbliebenen Familienmitglieder in Salaga. Sie fand dort vor allem die atmosphärische Kulisse für ihren Roman: Einen staubigen Marktplatz, Überreste der Brunnen – und ein verwahrlostes Museum, in dem Fußschellen, Halsketten und Gewehre von der Gewalttätigkeit des Sklavenhandels kündeten. Ihre Verwandten allerdings verstummten, wenn es um die Ururgroßmutter ging.
Später durchforstete Attah an der Universität von Accra und dem Schomburg Center for Research in Black Culture in Harlem Reiseberichte aus dem Salaga des 19. Jahrhunderts. Sie stieß in der Geschichte des präkolonialen Westafrika auf starke und komplexe Frauenfiguren: Amina Bakwa etwa, eine militärische Anführerin der Hausa im späten 16. Jahrhundert, deren Kampfgeist und Unabhängigkeit – angeblich hielt sie sich viele Liebhaber – Legende sind. Oder Nana Asma‘u: Die streng religiöse Tochter eines einflussreichen Sheikhs lebte von 1793 bis 1864 im Kalifat Sokoto im nördlichen Nigeria und galt als führende Gelehrte des damals einflussreichen islamischen Staates. Asma‘u übersetzte und schrieb nicht nur über 60 Bücher. Sie debattierte auch mit ausländischen Gelehrten und stellte eine Gruppe von Lehrerinnen zusammen, die Frauen in ihren Häusern unterrichteten. Bakwa und Asma’u dienten Attah als Ahnengeister, die das feministische Narrativ des Romans vorantreiben, eine Figur wie die Häuptlings-tochter Wurche inspirieren.
Der Plot des Romans lebt – Kapitel für Kapitel – von der Gegenüberstellung der Macht- und Ohnmachtsperspektiven der zwei Heldinnen: Da ist Aminah, deren beschauliches Familienleben schlagartig zerstört wird, als Sklavenräuber ihr Dorf überfallen, anzünden und Frauen, Männer und Kinder aneinanderketten und wie Vieh vor sich hertreiben. Sie macht sich schwere Vorwürfe: Wegen ihrer zurückgelassenen und womöglich mit ihrem Baby verbrannten Mutter, der von ihr getrennten Schwester und ihrem kleinen Bruder Issa, dessen Hand Aminah eisern umklammert, bis er irgendwann aus Erschöpfung seinen Geist aufgibt und von den Treibern wie ein Stück Abfall hinter einen Felsen geworfen wird.
Und das ist erst der Anfang von Aminahs Martyrium: Ein ghanaischer Bauer kauft sie auf dem Sklavenmarkt für die Feldarbeit, schlägt sie, missbraucht sie. Sie fügt sich, zumindest äußerlich: „Licabili“ hatte ihre Großmutter den animistischen Glauben genannt, „dass Otienu bestimmte, was einem zustieß, vorausgesetzt man stellte sich gut mit ihm oder war ein guter Mensch. Doch wer Otienu war, oder wo er sich aufhielt, hätte sie nicht zu sagen gewusst.“ So bleibt nur eine Ahnung davon, welches gewaltige und gewalttätige Trauma hinter Aminahs sanfter Schicksalsergebenheit schwelt.
Auf der anderen Seite steht Wurche: „Die alten Frauen von Kempbe sagten, aus Wurche hätte eigentlich ein Junge werden müssen: Das Einzige, was ihr dazu noch fehle, sei dieses Ding zwischen den Beinen.“ Als Tochter eines Chiefs denkt sie gar nicht daran, sich in die Frauenrolle zu fügen. Stattdessen kämpft sie um persönliche Freiheit und Mitsprache.
Wurche reitet und schießt besser als ihre Brüder. Sie hat Spaß daran, die gleichgeschlechtliche Liebe zu erkunden, verweigert sich aber – so gut sie es kann – ihrem Mann, den sie ihrem Vater zuliebe und für ein militärisches Zweckbündnis mit einem Nachbarstamm heiraten musste. Wenn ihr Vater nur auf sie hören würde! Immer wieder versucht sie ihn mit ihren eigenen politischen Ideen zu konfrontieren. Wurches Ehrgeiz und bisweilen an Arroganz grenzendes Selbstvertrauen nehmen eine Entwicklung vorweg, die heute in großen Teilen Westafrika selbstverständlich ist: Frauen, die sich selbst ermächtigen, die hinter der von Männern dominierten Bühne politisch, kulturell und gesellschaftlich die Strippen ziehen. Die Wege von Aminah und Wurche kreuzen sich auf dem Sklavenmarkt in Salaga, zu einer Zeit, als innere Kämpfe das Volk von Wurche entzweien und der Sklavenhandel seine letzte Blüte erlebt: Die Häuptlingstochter kauft das verschleppte Dorfmädchen. Selbstverständlich ist das schon längst nicht mehr. Denn die Engländer, die den Sklavenhandel einst förderten, kommerzialisierten und internationalisierten, wollen ihn nun in ihren afrikanischen Kolonien unterbinden. Für die Herrscherfamilien von Salaga bedeutet das eine wirtschaftliche Bedrohung.
Dass Angehörige besiegter Stämme als Sklaven gehalten wurden, hat in Westafrika Tradition. Mit der transatlantischen Verschiffung aber wurde daraus ein Geschäftsmodell, an dem sich auch Afrikaner bereicherten. Attahs Roman sticht hier in die dunklen und längst nicht aufgearbeiteten Kapitel innerafrikanischen Menschenhandels. „Wir haben die Tendenz“, sagt die Autorin, „unsere Vergangenheit zu verklären, uns auf ihre Glanzpunkte wie die großen Reiche von Ghana und Mali und deren Königshäuser zu konzentrieren. Dabei vergessen wir zu gerne unsere eigene Verwicklung in den Sklavenhandel“.
Die Beziehung zwischen Herrin und Sklavin aber ist nicht einfach: Die hübsche Aminah arbeitet als Wurches Haushaltshilfe und Amme für ihren kleinen Sohn, und dient der Häuptlingstochter gleichzeitig als Projektionsfläche für ihre Sehnsüchte und Fantasien. In die Faszination der beiden Frauen füreinander mischen sich immer wieder Anflüge von Eifersucht und Gewalt. Wurche hat zunehmend Skrupel. Und Aminah will ihrem Sklavenleben entkommen. Beide fühlen sich zudem vom selben Mann angezogen, einem in Salaga berüchtigten Sklavenhändler, ausgerechnet.
Die Figur des Moro wirft moralische Fragen auf. Der „hochgewachsene Mann mit der dunkelsten Hautfarbe, die sie je gesehen hatte“ interessiert sich offensichtlich für Aminah und wird zum Fokus ihres ungelebten Lebens. Ob sie als Sklavin überhaupt einen Freund haben darf? Und kann sie ihm verzeihen, dass er zu den Menschen gehört, die ihr Leben und das ihrer Familie zerstört hatten? „Wenn er wirklich so freundlich war wie er aussah – ständig bot er ihr Hilfe an –, warum überfiel er dann Dörfer, riss Familien auseinander und verkaufte Menschen?“ Doch auch Moro ist Opfer. Wir erfahren, dass er im Auftrag seines Chiefs arbeitet, zu dem ihn einst seine Eltern als Kindersklave gaben.
Allein die Liebe scheint die Kraft zu haben, alle Rationalisierungen über den Haufen zu werfen. Warum etwa sollte sich Helmut, Offizier der deutschen Besatzungstruppen, auch ernsthaft für das Schicksal von Wurches Volk interessieren? Die Häuptlingstochter lässt sich auf eine Affäre mit dem Deutschen ein. Keine Frage, dass Helmut politisch einem Ausbeutungsunternehmen dient. Dennoch billigt ihm Attah eine Menschlichkeit zu, die überraschend gegen den Strich des überheblichen Kolonialisten zeichnet. Und Wurche? Sie verfügt über die weibliche Autorität, sich ihre Liebhaber und Verbündeten selbst auszusuchen. Und sei es nur, um den Patriarchen eins auszuwischen.
„Wir gehen in den Schuhen unserer Ahnen, leben als Erweiterungen derjenigen, die vor uns kamen“ erklärt Attah. Eine sehr afrikanische Weltsicht – die allerdings mit den neuesten Ergebnissen westlicher psychologischer Forschung korrespondiert. Ist es nicht längst erwiesen, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden? Während sie den Roman schrieb, registrierte die Autorin viele Echos auf die Ereignisse von damals in der gegenwärtigen Politik – von den Schulmädchen, die die Terror-Organisation Boko Haram im Norden Nigerias entführte, bis zu der in Afrika und Asien verbreiteten Praxis, Kinder als Hausmägde und -knechte arbeiten zu lassen. Die modernen Formen der Sklaverei. Auch deshalb, sagt Attah, habe sie mit Cassava Press aus Nigeria bewusst einen afrikanischen Verlag für ihr Buch gesucht. „Viele der im Westen publizierten Bücher afrikanischer Autoren finden nie ihren Weg zurück nach Afrika. Aber genau diese Leser möchte ich erreichen. Weil wir erst durch die Konfrontation mit unserer Geschichte unsere Wurzeln zurückgewinnen“.
Ayesha Harruna Attah: „Die Frauen von Salaga“. Roman. Aus dem Englischen von Christiane Burckhardt. Diana Verlag, München 2019. 320 Seiten, 20 Euro.
Bei der Recherchie stieß
Attah auf starke
afrikanische Frauenfiguren
Das Buch hat sie
bewusst bei einem afrikanischen
Verlag veröffentlicht
Der Ashanti-Stamm im Jahr 1901: Dass Angehörige besiegter Stämme als Sklaven gehalten wurden, hat in Westafrika Tradition.
Foto: Hulton Archive / Getty
Die Autorin Ayesha Harruna Attah.
Foto: Itunu Kuku
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Interessiert greift Marie-Sophie Adeoso zu diesem Roman der ghanaischen Autorin Ayesha Harruna Attah, stellt jedoch bald fest, dass es sich bei den "Frauen von Salaga" weniger um die literarische Erkundung von weiblichem Leben im kolonisierten Ghana handelt als um eine seichte Erotik-Geschichte vor historischer Kulisse, wie sie klagt. Attah erzählt die Geschichte der Königstochter Wurche, die aus strategischen Gründen einen Verbündeten ihres Vaters heiraten muss. Dass sich die unglücklich Vermählte immer wieder in wilde Affären stürzt, kann die Kritikerin nicht begeistern. Adeoso moniert simple Figurenzeichnung, hölzerne Dialogen und sprachliche Ausrutscher. Zum Lachen bringt sie allerdings die unfreiwillige Komik mancher Liebesszenen, etwas wenn es heißt: "Die Welt zwischen ihren Beinen loderte lichterloh."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein glänzendes historisches Drama.« The New Yorker