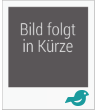Robert Menasse
Buch
Die Hauptstadt
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:



Produktdetails
- Verlag: Büchergilde Gutenberg
- ISBN-13: 9783763269914
- Artikelnr.: 53628217
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.09.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.09.2017Die Leiden des Kulturbeamten Susman
Man kann auch zu viel Schwein haben: Robert Menasse beschert in seinem Roman "Die Hauptstadt" der Europäischen Kommission ihr literarisches Debüt.
Mit seinem Buch "Die Hauptstadt" begründet der 1954 in Wien geborene Erzähler und Essayist Robert Menasse ein neues Genre der deutschsprachigen Literatur: den Europa-Roman. Deutsche Romane aus europäischem Geist oder mit europäischer Wirkung: Das hat es seit Goethes "Werther" allemal gegeben. Nicht aber ein Erzählen aus dem Inneren der europäischen Institutionen, die als Folge der Römischen Verträge von 1957 immerhin schon sechzig Jahre lang existieren. Ihr Debüt kommt also spät.
Eine Hauptfigur hat "Die Hauptstadt" nicht,
Man kann auch zu viel Schwein haben: Robert Menasse beschert in seinem Roman "Die Hauptstadt" der Europäischen Kommission ihr literarisches Debüt.
Mit seinem Buch "Die Hauptstadt" begründet der 1954 in Wien geborene Erzähler und Essayist Robert Menasse ein neues Genre der deutschsprachigen Literatur: den Europa-Roman. Deutsche Romane aus europäischem Geist oder mit europäischer Wirkung: Das hat es seit Goethes "Werther" allemal gegeben. Nicht aber ein Erzählen aus dem Inneren der europäischen Institutionen, die als Folge der Römischen Verträge von 1957 immerhin schon sechzig Jahre lang existieren. Ihr Debüt kommt also spät.
Eine Hauptfigur hat "Die Hauptstadt" nicht,
Mehr anzeigen
dafür eine Reihe relativ gleichrangiger Protagonisten, deren Auftritte an Robert Altmans Kinoklassiker "Short Cuts" erinnern: Sie wechseln sich episodisch ab, begegnen sich bisweilen rein zufällig oder aus beruflicher Notwendigkeit, reichen den Erzählstab dann an eine schon bekannte Person zurück oder geben ihn an eine neue weiter. Einer der Protagonisten heißt Martin Susman, ist Österreicher, etwa Mitte vierzig, wohnhaft in Brüssel. Beruf? "Er war", so stellt ihn der anonyme Erzähler vor, "Beamter der Europäischen Kommission, Generaldirektion ,Kultur und Bildung', zugeteilt der Direktion C ,Kommunikation', und leitete die Abteilung EAC-C-2 ,Programm und Maßnahmen Kultur'." Im Zweifel geht in diesem Roman Genauigkeit vor Seele. Weshalb das Benennen von Susmans Tätigkeit auch nicht pedantisch ist, sondern präzis.
Man muss sich überdies an Abkürzungen gewöhnen wie "DG Agri" (Directorate-General for Agriculture and Rural Development), man muss sich damit abfinden, dass es permanent um "Bullet-Points" geht, also die Stichworte einer Entscheidungsvorlage, des Öfteren auch um den oder das "Badge", die Ansteckplakette für den privilegierten Zugang zu Veranstaltungen, sprich: Events. Erstaunlich dabei: Man gewöhnt sich rasch daran. Die größte Leistung des Romans besteht darin, das Funktionieren eines vielsprachigen und multinationalen Gesamtapparats so zu schildern, dass wir, die Leser, teilnehmendes Interesse an ihm gewinnen. Und das tun wir - auch dank Menasses Gebrauch des Globalidioms.
"Die Hauptstadt" spielt in der unmittelbaren Gegenwart. Dem islamistischen Terroranschlag auf die U-Bahn-Station Maelbeek im März 2016 fallen auch Figuren des Romans zum Opfer, über das Brexit-Votum vom Juni jenes Jahres wird diskutiert. Handwerklich klug ist der Verzicht, die aktuellen Kommissare ebenso wenig beim Namen zu nennen wie den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der im Roman als anonyme Allgegenwart über den Brüsseler Wassern schwebt und über dessen Lieblingsbuch man spekulieren darf. Umso plastischer und glaubwürdiger treten die Spitzenbeamten einiger Ressorts und Mitarbeiter als fiktive Charaktere auf, reale Bezüge schließt das nicht aus. In Brüssel könnte es bald zum Dechiffrierspiel werden, wer denn wer sei in Menasses Roman.
Der Teilapparat Kultur, in dem Martin Susman wirkt, gilt als Stiefkind der Kommission. Gleichwohl fühlen sich Susman und seine Kollegen aus Tschechien oder Zypern wie in einer "Arche Noah": Verschonte sind sie auf dem tosenden Meer der Großadministration. Der aktuelle Auftrag, der auf sie zukommt, verspricht zudem unverhofftes Renommee. Es geht um das "Big Jubilee Project". Je nach Gründungsdatum der frühen EWG oder der späteren EG gerechnet, wird "die Kommission in drei Jahren sechzig, im anderen Fall in zwei Jahren fünfzig". Das will gefeiert sein. Aber wie?
Mehrfach ist in Menasses Roman die Rede von Robert Musils Jahrhundertprosa "Der Mann ohne Eigenschaften". Dort - handelnd im Wien des Jahres 1913 - wird ebenfalls ein großes Jubiläum vorbereitet: die siebzigjährige Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph I., die 1918 festlich zu begehen wäre. Gesucht wird nach einer übergreifenden Idee, die, im Brüsseler Jargon von heute, vier "Bullet-Points" zu berücksichtigen hat: "Friedenskaiser, europäischer Markstein, wahres Österreich und Besitz und Bildung". Zudem gilt es, die Superiorität Franz Josephs über den deutschen Kaiser Wilhelm II. zu bekräftigen, der 1918 erst auf eine dreißigjährige Regentschaft würde zurückblicken können. Weshalb denn auch die Wiener Suche nach der Zentralidee unter dem Stichwort "Parallelaktion" firmiert.
Absichtsvoll spielt Menasses "Jubilee Project" mit Musils "Parallelaktion". Das spricht für kühnen Erzählermut, wird aber zur Hybris des Romans. Musils sublime Kunst besteht darin, die große Idee als leere Hülse zu schildern - und die Suche nach ihr in einen Gesellschaftsreigen voller Sentiment und Satire zu verwandeln. Bei Menasse ist es der Kulturbeamte Susman, der die Idee für das nahende Jubiläum findet: "Auschwitz als Geburtsort der Europäischen Kommission", denn: "Nie wieder - das ist Europa!" Deshalb gelte es jetzt, die Überlebenden der Vernichtungslager "ins Zentrum der Feierlichkeit" zu stellen.
In Menasses bis dato fünf Romanen seit 1988, zumal in den beiden besten - "Selige Zeiten, brüchige Welt" (1991) und "Die Vertreibung aus der Hölle" (2001) -, findet sich als Erzählkern die emphatische Verbindung zwischen einer dramatisch ernsten, nicht selten tragisch oder geschichtskatastrophal zugespitzten Handlung und einem eher kolloquialen, ja saloppen Stil, der sich mit Vorliebe situationskomischer Elemente bedient und im Slapstick ganz zu sich selbst kommt. Diese Synthese sucht auch das neue Buch. Die Schilderung des Brüsseler Beamtenmilieus bereitet dabei keine Schwierigkeiten, im Gegenteil: Sie gelingt ungemein.
Um Susmans Idee nicht nur zeithistorisch, sondern auch erzählerisch zu plausibilisieren, entfaltet Menasse eine beeindruckende Konstruktionsenergie. Ein Strang seiner Short Cuts rekapituliert die Geschichte des belgischen Auschwitz-Überlebenden David de Vriend, eines inzwischen hochbetagten Lehrers, der im Seniorenheim unweit der europäischen Institutionen eine letzte Bleibe findet. Einen vollständigen Lebenslauf erhält auch Alois Erhart, das Wiener Kind eines Hitlersoldaten und jetzt ein emeritierter Wirtschaftsprofessor. Er wird gegen Ende des Romans den Mitgliedern des ",New Pact for Europe'-Think-Tanks" die Leviten lesen, dabei das Ende der Nationalstaaten und das Entstehen einer europäischen Republik fordern - und er wird das Areal um das Lager von Auschwitz als Sitz einer neu zu gründenden europäischen Hauptstadt reklamieren.
Man muss mit Menasse nicht darüber rechten, ob Auschwitz, das deutsche Verbrechen, der Ort für das Begründen und Befestigen einer emphatisch europäischen Zukunft sein kann und sein sollte, auch nicht darüber, ob die fast vollständige Gleichsetzung der europäischen Nationalstaaten mit verderblichem Nationalismus haltbar ist. Der Roman postuliert beides und vertritt dabei Menasses geschichtspolitische Sorgen und Wünsche. Kritisch rechten allerdings lässt sich darüber, ob Menasse seine Figuren, zumal Susman und Erhart, nicht mit zu viel Botschaft befrachtet, sie ob ihrer oft seitenlangen Herleitungen und Analysen zu Papiermonstern aufbläst und damit verkleinert. Dass er dies tut, wird zur Hybris der "Hauptstadt".
Im "Mann ohne Eigenschaften" gibt es luzide Kapitel über den Prostituiertenmörder und Psychiatriehäftling Moosbrugger. Menasses Parallelgeschichte dazu handelt vom polnischen Profikiller Oswiecki und seinem Gegenspieler, dem Brüsseler Kommissar Brunfaut. Gestrickt wird daraus eine Verschwörungsfama, in die sich unter Führung des Vatikans die Geheimdienste des Westens verstricken. Bei aller Fabulierfreude, die sich in diesen Passagen findet: Das kann Dan Brown besser, also ein bisschen weniger haarsträubend.
Bleibt der Slapstick. Dafür zuständig ist im neuen Roman zuallererst ein Schwein, "ein verdrecktes, aber eindeutig rosa Hausschwein". Im Prolog rennt es irrlichternd durch Brüssels Zentrum. Das hat skurrilen Witz, zudem ermöglicht es dem Erzähler, wie nebenbei einige für das weitere Geschehen wichtige Figuren vorzustellen. Aber das rastlose Vieh hetzt munter weiter bis ans Ende des Epilogs. Es gibt zu viel Schwein in diesem Roman - zum rennenden Brüssel-Gag gesellen sich "der größte österreichische Schweineproduktionsbetrieb", "das Schwein als Querschnittsmaterie" und schier endlose Schweinefleisch-Verhandlungen mit China.
Im Essay "Der Europäische Landbote" von 2012, einem fulminanten Plädoyer für die Kompetenz und die Vernunft der wohlfeil "vielgeschmähten EU-Bürokratie", hat sich Robert Menasse die Frage gestellt, ob die Europäische Kommission überhaupt "romanfähig" sei. Seine Antwort, ein entschiedenes Ja, ist der Roman "Die Hauptstadt". Den Reichtum, die Energie und den Furor des Buches respektvoll rühmend, bleibt, aufs Ganze gelesen, am Ende aber doch ein entschiedenes Jein. Susmans Idee für das "Jubilee Project" versickert übrigens in den Intrigen der Kommission.
JOCHEN HIEBER
Robert Menasse: "Die Hauptstadt". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 458 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Man muss sich überdies an Abkürzungen gewöhnen wie "DG Agri" (Directorate-General for Agriculture and Rural Development), man muss sich damit abfinden, dass es permanent um "Bullet-Points" geht, also die Stichworte einer Entscheidungsvorlage, des Öfteren auch um den oder das "Badge", die Ansteckplakette für den privilegierten Zugang zu Veranstaltungen, sprich: Events. Erstaunlich dabei: Man gewöhnt sich rasch daran. Die größte Leistung des Romans besteht darin, das Funktionieren eines vielsprachigen und multinationalen Gesamtapparats so zu schildern, dass wir, die Leser, teilnehmendes Interesse an ihm gewinnen. Und das tun wir - auch dank Menasses Gebrauch des Globalidioms.
"Die Hauptstadt" spielt in der unmittelbaren Gegenwart. Dem islamistischen Terroranschlag auf die U-Bahn-Station Maelbeek im März 2016 fallen auch Figuren des Romans zum Opfer, über das Brexit-Votum vom Juni jenes Jahres wird diskutiert. Handwerklich klug ist der Verzicht, die aktuellen Kommissare ebenso wenig beim Namen zu nennen wie den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der im Roman als anonyme Allgegenwart über den Brüsseler Wassern schwebt und über dessen Lieblingsbuch man spekulieren darf. Umso plastischer und glaubwürdiger treten die Spitzenbeamten einiger Ressorts und Mitarbeiter als fiktive Charaktere auf, reale Bezüge schließt das nicht aus. In Brüssel könnte es bald zum Dechiffrierspiel werden, wer denn wer sei in Menasses Roman.
Der Teilapparat Kultur, in dem Martin Susman wirkt, gilt als Stiefkind der Kommission. Gleichwohl fühlen sich Susman und seine Kollegen aus Tschechien oder Zypern wie in einer "Arche Noah": Verschonte sind sie auf dem tosenden Meer der Großadministration. Der aktuelle Auftrag, der auf sie zukommt, verspricht zudem unverhofftes Renommee. Es geht um das "Big Jubilee Project". Je nach Gründungsdatum der frühen EWG oder der späteren EG gerechnet, wird "die Kommission in drei Jahren sechzig, im anderen Fall in zwei Jahren fünfzig". Das will gefeiert sein. Aber wie?
Mehrfach ist in Menasses Roman die Rede von Robert Musils Jahrhundertprosa "Der Mann ohne Eigenschaften". Dort - handelnd im Wien des Jahres 1913 - wird ebenfalls ein großes Jubiläum vorbereitet: die siebzigjährige Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph I., die 1918 festlich zu begehen wäre. Gesucht wird nach einer übergreifenden Idee, die, im Brüsseler Jargon von heute, vier "Bullet-Points" zu berücksichtigen hat: "Friedenskaiser, europäischer Markstein, wahres Österreich und Besitz und Bildung". Zudem gilt es, die Superiorität Franz Josephs über den deutschen Kaiser Wilhelm II. zu bekräftigen, der 1918 erst auf eine dreißigjährige Regentschaft würde zurückblicken können. Weshalb denn auch die Wiener Suche nach der Zentralidee unter dem Stichwort "Parallelaktion" firmiert.
Absichtsvoll spielt Menasses "Jubilee Project" mit Musils "Parallelaktion". Das spricht für kühnen Erzählermut, wird aber zur Hybris des Romans. Musils sublime Kunst besteht darin, die große Idee als leere Hülse zu schildern - und die Suche nach ihr in einen Gesellschaftsreigen voller Sentiment und Satire zu verwandeln. Bei Menasse ist es der Kulturbeamte Susman, der die Idee für das nahende Jubiläum findet: "Auschwitz als Geburtsort der Europäischen Kommission", denn: "Nie wieder - das ist Europa!" Deshalb gelte es jetzt, die Überlebenden der Vernichtungslager "ins Zentrum der Feierlichkeit" zu stellen.
In Menasses bis dato fünf Romanen seit 1988, zumal in den beiden besten - "Selige Zeiten, brüchige Welt" (1991) und "Die Vertreibung aus der Hölle" (2001) -, findet sich als Erzählkern die emphatische Verbindung zwischen einer dramatisch ernsten, nicht selten tragisch oder geschichtskatastrophal zugespitzten Handlung und einem eher kolloquialen, ja saloppen Stil, der sich mit Vorliebe situationskomischer Elemente bedient und im Slapstick ganz zu sich selbst kommt. Diese Synthese sucht auch das neue Buch. Die Schilderung des Brüsseler Beamtenmilieus bereitet dabei keine Schwierigkeiten, im Gegenteil: Sie gelingt ungemein.
Um Susmans Idee nicht nur zeithistorisch, sondern auch erzählerisch zu plausibilisieren, entfaltet Menasse eine beeindruckende Konstruktionsenergie. Ein Strang seiner Short Cuts rekapituliert die Geschichte des belgischen Auschwitz-Überlebenden David de Vriend, eines inzwischen hochbetagten Lehrers, der im Seniorenheim unweit der europäischen Institutionen eine letzte Bleibe findet. Einen vollständigen Lebenslauf erhält auch Alois Erhart, das Wiener Kind eines Hitlersoldaten und jetzt ein emeritierter Wirtschaftsprofessor. Er wird gegen Ende des Romans den Mitgliedern des ",New Pact for Europe'-Think-Tanks" die Leviten lesen, dabei das Ende der Nationalstaaten und das Entstehen einer europäischen Republik fordern - und er wird das Areal um das Lager von Auschwitz als Sitz einer neu zu gründenden europäischen Hauptstadt reklamieren.
Man muss mit Menasse nicht darüber rechten, ob Auschwitz, das deutsche Verbrechen, der Ort für das Begründen und Befestigen einer emphatisch europäischen Zukunft sein kann und sein sollte, auch nicht darüber, ob die fast vollständige Gleichsetzung der europäischen Nationalstaaten mit verderblichem Nationalismus haltbar ist. Der Roman postuliert beides und vertritt dabei Menasses geschichtspolitische Sorgen und Wünsche. Kritisch rechten allerdings lässt sich darüber, ob Menasse seine Figuren, zumal Susman und Erhart, nicht mit zu viel Botschaft befrachtet, sie ob ihrer oft seitenlangen Herleitungen und Analysen zu Papiermonstern aufbläst und damit verkleinert. Dass er dies tut, wird zur Hybris der "Hauptstadt".
Im "Mann ohne Eigenschaften" gibt es luzide Kapitel über den Prostituiertenmörder und Psychiatriehäftling Moosbrugger. Menasses Parallelgeschichte dazu handelt vom polnischen Profikiller Oswiecki und seinem Gegenspieler, dem Brüsseler Kommissar Brunfaut. Gestrickt wird daraus eine Verschwörungsfama, in die sich unter Führung des Vatikans die Geheimdienste des Westens verstricken. Bei aller Fabulierfreude, die sich in diesen Passagen findet: Das kann Dan Brown besser, also ein bisschen weniger haarsträubend.
Bleibt der Slapstick. Dafür zuständig ist im neuen Roman zuallererst ein Schwein, "ein verdrecktes, aber eindeutig rosa Hausschwein". Im Prolog rennt es irrlichternd durch Brüssels Zentrum. Das hat skurrilen Witz, zudem ermöglicht es dem Erzähler, wie nebenbei einige für das weitere Geschehen wichtige Figuren vorzustellen. Aber das rastlose Vieh hetzt munter weiter bis ans Ende des Epilogs. Es gibt zu viel Schwein in diesem Roman - zum rennenden Brüssel-Gag gesellen sich "der größte österreichische Schweineproduktionsbetrieb", "das Schwein als Querschnittsmaterie" und schier endlose Schweinefleisch-Verhandlungen mit China.
Im Essay "Der Europäische Landbote" von 2012, einem fulminanten Plädoyer für die Kompetenz und die Vernunft der wohlfeil "vielgeschmähten EU-Bürokratie", hat sich Robert Menasse die Frage gestellt, ob die Europäische Kommission überhaupt "romanfähig" sei. Seine Antwort, ein entschiedenes Ja, ist der Roman "Die Hauptstadt". Den Reichtum, die Energie und den Furor des Buches respektvoll rühmend, bleibt, aufs Ganze gelesen, am Ende aber doch ein entschiedenes Jein. Susmans Idee für das "Jubilee Project" versickert übrigens in den Intrigen der Kommission.
JOCHEN HIEBER
Robert Menasse: "Die Hauptstadt". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 458 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Paul Jandl fühlt sich mit Robert Menasses neuem Roman an Musils "Mann ohne Eigenschaften" erinnert. Hier wie da werden die Verhältnisse in ihrer Gefährlichkeit aufgedeckt, bei Menasse ist das vor allem die EU-Wirklichkeit im Abgleich mit ihren Möglichkeiten, erklärt Jandl. Dass Menasse Europa als Thema urbar gemacht hat, findet der Rezensent bemerkenswert, zumal der Autor hier geradezu einen Krimi um die europäische Fleischindustrie entwirft, wie Jandl feststellt. Geschichte und Gegenwart, Tragik und Komik, Hoffnung und Scheitern haben darin gleichermaßen ihren Platz, meint Jandl, ohne dass der Autor es allzu parodistisch oder milieuhaft angehen lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Eine grandiose ... Liebeserklärung an Europa und gleichzeitig eine blendend recherchierte Innenansicht über die Arbeit der Europäischen Kommission.« Denis Scheck Der Tagesspiegel 20171217
Gebundenes Buch
"Roman" nennt der Verlag das Buch von Robert Menasse, aber für einen Roman gebricht es dem Buch an so etwas wie einem Handlungsaufbau. Auf esseayistische, z.T. groteske Art werden kurze Augenblicke aus dem Leben verschiedenster Personen in Brüssel - die meisten davon sind EU …
Mehr
"Roman" nennt der Verlag das Buch von Robert Menasse, aber für einen Roman gebricht es dem Buch an so etwas wie einem Handlungsaufbau. Auf esseayistische, z.T. groteske Art werden kurze Augenblicke aus dem Leben verschiedenster Personen in Brüssel - die meisten davon sind EU Beamte - dargestellt. Realistische Darstellungen von Karrierekämpfen und Lobbyarbeit innerhalb des EU-Apparates und reale Ereignisse (der U-Bahn-Anschlag) werden vermengt mit grotesken Beschreibungen (das in Brüssel frei laufende Schwein als "running gag") sowie (Achtung Spoiler!) dem Dan-Brown-haften Killer-Geheimdienst des Vatikan.
Das Buch ist streckenweise durchaus amüsant zu lesen, lässt einen aber letztlich doch ratlos zurück. "Was will uns der Autor sagen"? - Dass es in einer so großen Organisation wie der EU auch ziemlich "menschelt"? Dass sie aber trotzdem (Stichwort Auschwitz) sehr notwendig? So wahr wie banal.
Weniger
Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben – oder so ähnlich. Ein Schwein, Mitten in Brüssel, der europäischen Hauptstadt. Die Gemüter sind erregt, die Gazetten stürzen sich auf das Thema. Derweil plagen die Beamten der Europäischen Kommission ganz andere Sorgen als …
Mehr
Eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben – oder so ähnlich. Ein Schwein, Mitten in Brüssel, der europäischen Hauptstadt. Die Gemüter sind erregt, die Gazetten stürzen sich auf das Thema. Derweil plagen die Beamten der Europäischen Kommission ganz andere Sorgen als Schweine auf Brüssels Straßen. Schweineohren sind interessant, aber nur, weil man damit auf dem chinesischen Markt Geld verdienen kann und aktuell die Nationalstaaten im Alleingang mit dem asiatischen Riesen verhandeln und sich gegenseitig reihenweise ausbooten und schaden. Ist das im Sinne der EU? Die könnte etwas für ihr Image tun, da kommt Fenia Xenopoulou das Big Jubilee Project gerade recht. Außerdem könnte das ihr Sprungbrett in ein wichtiges Ressort sein, Kultur ist mehr so das Abstellgleis. Apropos Gleis, als Kind ist David de Vries von einem Zug gesprungen, einem Deportationszug nach Auschwitz, der ihn in den sicheren Tod befördern sollte. Sein Leben lang war er Zeuge dessen, was Hass und Nationalstolz verursachen können, doch jetzt kann er sich kaum mehr erinnern, was er zehn Sekunden zuvor noch gedacht hat. Sein geistiges Erbe droht zu verfallen. Ähnlich verfällt auch der Körper von Kommissar Brunfaut, der eigentlich einen Mord aufklären will, den es aber plötzlich nicht mehr gegeben haben soll und der ihm einen unplanmäßigen Urlaub einbringt. Sie alle haben das Schwein gesehen, wie viele andere in der Hauptstadt der derzeit unpopulären Union, ein Schwein, über das alle reden und das die Leute in der Suche nach einem Namen zusammenführt und so wenigstens in einem Thema vereint.
Es ist nicht einfach, Robert Menasses Roman auf den Punkt zu bringen. Sehr viele Figuren, sehr viele Einzelhandlungsstränge, viel Geschichte und Politik – aber vielleicht ist es doch ganz einfach: es lebe die EU. Was wie ein chaotisches Kaleidoskop undurchdringlich scheint, schillert jedoch und entsteht in jeder Sekunde neu und kann bestaunt und bewundert werden. Die Menschen sind es, die das gemeinsame Europa entstehen lassen und die Vielfalt ausmachen.
Die Figuren sind durchdacht und vielschichtig kreiert. Die Karrieristin, der brave Beamte, der leidenschaftliche Volkswirt – es mangelt nicht an Stereotypen, jedoch bleiben sie dabei nicht stehen, sie haben Brüche und zeigen Facetten, die sie aus der Schablone herauslösen und zu Individuen werden lassen. Ihre Wege kreuzen und überschneiden sich, lösen sich dann wieder und oftmals bleiben die Begegnungen unentdeckt. Ein buntes Treiben geradezu, genau wie man es in Brüssel auch erleben kann.
Zweifelsohne ist der Roman ein Lobgesang auf die nachnationale Staatengemeinschaft, auch wenn die Mitarbeiter der Kommission weniger an der großen politischen Idee als an dem persönlichen Weiterkommen interessiert zu sein scheinen. Geradezu ad absurdum wird dies durch die Figur Alois Erharts geführt, der ein rauschendes Plädoyer auf eine neue europäische Hauptstadt singt, die aus Ruinen auferstehen müsse und daher nur an dem Ort entstehen könne, an dem die größte Niederlage Europas zu beklagen war: in Auschwitz. Leider verstirbt kurz danach der letzte Überlebende der Tragödie. Ein Humor, der begeistern kann, wenn man über eine gewisse Morbidität hinwegsieht, die sich durch das ganze Buch zieht. Menasse versteht sein Handwerk und setzt seine Sprachfertigkeit gekonnt ein, nein, er steht sogar über dem gängigen literarischen Diskurs und kann sich eine Eröffnung mit „Wer hat den Senf erfunden?“ erlauben.
Dass „Die Hauptstadt“ auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis 2017 gelandet ist, ist keine große Überraschung. Thematisch am Puls der Zeit – das Schwein soll hier nochmals ganz am Ende eine grenzwertige politisch relevante Rolle spielen und den Verdruss der Bürger zu einer unsäglichen Klimax führen – und doch leicht und unterhaltsam. Es macht tatsächlich wieder Lust auf das europäische Miteinander, das Europa von Menschen, die hier bei Menasse auch äußert menschlich sein dürfen.
Weniger
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Bemerkenswertes Buch, das im Gegensatz zu „Widerfahrnis“ im letzten Jahr zurecht den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Neben den nachdenklichen Kapitelüberschriften gefallen mir auch die jeweils kurzen ersten Sätze.
Ein wenig schwierig ist die große Personenanzahl, doch …
Mehr
Bemerkenswertes Buch, das im Gegensatz zu „Widerfahrnis“ im letzten Jahr zurecht den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Neben den nachdenklichen Kapitelüberschriften gefallen mir auch die jeweils kurzen ersten Sätze.
Ein wenig schwierig ist die große Personenanzahl, doch überzeugt mich die "Übrigens-Kultur". So besitzen die radfahrenden Mitarbeiter der EU Aufkleber, die sie Falschparker an die Scheibe kleben, wenn sie den Radweg blockieren (ich muss beim ADFC in Heidelberg mal nachfragen, ob es die auch in Heidelberg gibt.).
Besonders schön ist die Friedhofsgeschichte mit dem Satz: „Ich bin lieber mit dieser Frau geächtet als ohne sie geachtet!“ (S.90) Der Satz bezieht sich auf einen Brüsseler Baron, der eine „Negerin“ aus dem Kongo geheiratet hat und ein Museum der bedingungslosen Liebe für sie schuf.
Dann der Abgeordnete, der zur Gedenkfeier nach Ausschwitz muss: „Wir wollen auf keinen Fall, dass sie krank werden. […] Deutsche Unterwäsche ist das Beste für Ausschwitz!“ (S.101f, dass sie vor krank müsste eigentl. groß geschrieben werden…)
Menasse schreibt mit viel Witz, etwa bei der gedachten Szene mit dem Bier für den Kommissar, das nicht kommt, und dem Wirt, der die Polizei holen will oder der Interpretation von chin. Schriftzeichen: Aus „Alle Menschen sind Schweine“ wird „Alte Menschen sind schweigsam (S.384).
Was bei Satire immer schwierig ist und was auch hier nicht hundertprozentig gelingt, ist die Auflösung am Ende. Ich möchte festhalten, dass hier kein Krimi geschrieben wurde, dennoch der Mord aufgeklärt, selbst wenn der Täter nicht bestraft wird. Mehr will ich hier nicht verraten.
Am Rande wird noch das Drama der Flüchtlinge in Ungarn behandelt und auch der Europa quälende Terrorismus kommt nicht zu kurz. Und jetzt habe ich gar nichts über das Schwein gesagt.
In einem inhaltsreichen Buch muss nicht alles optimal sein, deswegen noch 5 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Fazit:
Die EU funktioniert auch nicht anders als ein Kleintierzuchtverein.
Amüsant geschrieben.
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Roman beginnt damit, dass ein Schwein panisch durch Brüssel läuft. Männer und Frauen geraten in Panik. Manch einer stürzt vor Schreck auf den regennassen Straßen und wälzt sich im Dreck.
Ich dachte bei mir, wie skurril diese Situation anmutet. Ein Schwein jagt …
Mehr
Der Roman beginnt damit, dass ein Schwein panisch durch Brüssel läuft. Männer und Frauen geraten in Panik. Manch einer stürzt vor Schreck auf den regennassen Straßen und wälzt sich im Dreck.
Ich dachte bei mir, wie skurril diese Situation anmutet. Ein Schwein jagt erwachsenen Menschen Angst ein. Mutig sind wir Menschen wirklich nur dann, wenn so ein beschauliches Nutztier paniert und dampfend auf unserem Teller liegt. Das Thema Schweinehandel hat mir sehr zu denken gegeben. Wie hier mit Lebewesen gehandelt wird, ist einfach nicht richtig. Aber, das wissen wir längst. Ich habe mir die Frage gestellt: Ist das Schwein als Symbol für unsere Politik gedacht?
Ich habe vorher noch nie ein Buch gelesen, dessen Schwerpunkt auf Politik beruht. Der Autor hat es geschafft, dass mich die Geschichte um die EU gefesselt hat.
Man lernt viele Personen kennen, bei denen man sich fragt, was sie mit der Handlung zu tun haben. Nach und nach fügen sich die Protagonisten in das Geschehen ein.
Sei es der demente David de Vriend, der seinen Lebensabend in einem Altenheim verbringt oder der Referent Martin Susman. Mit David de Vriend beginnt die Geschichte. Er zieht aus seiner Wohnung aus. Eigentlich weiß er gar nicht warum. Er wird in dieser Geschichte noch sehr wichtig werden. Er hat den Holocaust überlebt.
Susman und seine ehrgeizige griechische Kollegin Fenia Xenopoulou aus der EU-Kommission, versuchen eine Kunstausstellung zur Jubiläumsfeier zu gestalten. Als Hauptthema: Die letzten Überlebenden des Holocaust.
Kommissar Brunfaut schien mir einer von den wenigen Charaktermenschen in der Geschichte zu sein. Übergewichtig und ehrlich. Er weiß nicht mehr, wem er noch trauen kann. Er darf bei einem Mord nicht mehr weiter ermitteln. Die Daten aus seinem PC sind komplett gelöscht. Brunfaut wird beurlaubt. Brunfaut ist nicht gesund. Brunfaut möchte der Sache trotzdem auf den Grund gehen.
Die katholische Kirche schickt einen polnischen Agenten auf Reisen, der nun auf der Flucht ist.
Der österreichische Emeritus der Volkswirtschaft Alois Erhart, plant beim Think-Tank seine letzte Rede zu halten. Er nimmt kein Blatt mehr vor den Mund und stößt die Denkbeauftragten mit seinen Worten vor den Kopf.
Der Autor hat Fiktion und Realität gekonnt miteinander verwoben. Sei es das Flüchtlingsproblem oder die katastrophale Situation in Griechenland. Besonders deutlich wird, dass es in der Politik eigentlich kein Miteinander gibt. Jeder möchte das größte Stück vom Kuchen. Jeder will die Karriereleiter hochklettern und geehrt werden. Für Idealisten gibt es wenig Platz in der politischen Maschinerie. Nichts Neues!
Überlebende Holocaustopfer benutzt man zu Werbezwecken. Das Image der europäischen Komission soll mit geheuchelter Empathie aufpoliert werden. Das sind so meine Gedanken.
Mein Fazit
Der Schreibstil ist nüchtern und stellenweise sehr humorvoll. Es wird stets aus der Sicht der verschiedenen Protagonisten erzählt. Es wird viel philosophiert und diskutiert. Jedes Kapitel beginnt mit einem philosophischen Satz.
Ein raffinierter Prolog holt den Leser von Anfang an ab.
Das Schwein läuft in der Geschichte immer wieder seine Bahnen.
Stellenweise war mir die Geschichte etwas zu ausschweifend. Es wurde, für meinen Geschmack, zuviel in die Geschichte hineingepackt.
Nichtsdestotrotz hat der Autor einen Roman geschrieben, der auch für Menschen geeignet ist, die nicht leidenschaftlich gerne politisieren.
Vegetarier dürften nun darüber glücklich sein, dass sie keine Konsumenten von Schweinefleisch sind. Schweine sind Lebewesen! Warum nur geht das immer wieder unter?
Mir ist es unheimlich schwer gefallen, über dieses Buch meine Meinung zu schreiben, da ich mich zuvor nie so eingehend mit der Thematik befasst habe. Ich habe viel dazu gelernt. Vor allem, warum Raucher Angorawäsche tragen sollten. :-)
Danke Robert Menasse
Meine Lieblingszitat
Ideen stören, was es ohne sie gar nicht gäbe, (Überschrift 2. Kapitel)
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nach dem Lesen dieses Romans ist eines jedenfalls klar: Brüssel ist Europas Hauptstadt, hier findet man die VertreterInnen aller Nationen, die gegen- und miteinander versuchen, die Gegenwart und Zukunft unseres Kontinents zu gestalten. Doch so unterschiedlich die Menschen dort auch sind, auf …
Mehr
Nach dem Lesen dieses Romans ist eines jedenfalls klar: Brüssel ist Europas Hauptstadt, hier findet man die VertreterInnen aller Nationen, die gegen- und miteinander versuchen, die Gegenwart und Zukunft unseres Kontinents zu gestalten. Doch so unterschiedlich die Menschen dort auch sind, auf irgendeine Weise sind sie miteinander verbunden, jetzt oder durch ihre Vorfahren in der Vergangenheit. Davon handelt dieses Buch, vom Leben in dieser Hauptstadt und den zumeist unsichtbaren Fäden, die die BewohnerInnen untereinander verknüpfen.
Viele Geschichten werden hier erzählt: die des Kommissars Brunfaut, dem die Untersuchung eines Mordfalles entzogen wird; die des ehemaligen Auschwitzgefangenen David de Vriend, der in ein Altenheim umzieht; die der EU-Beamtin Fenia, die sich strafversetzt fühlt und zum ersten Mal ein Gefühl verspürt, an das sie nie glaubte; und sechs, sieben weitere Personen, die alle auf ihre Art ihre Nationen vertreten, gleichzeitig aber so europäisch sind, wie man es nur sein kann.
Robert Menasse erzählt in einem locker-leichten Plauderton mit viel (auch schwarzem) Humor und serviert einem praktisch so nebenbei viele der Probleme unserer Zeit mit teilweise umfangreichen Analysen: Flüchtlingskrise, Vergangenheitsbewältigung, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, zunehmende Medialisierung, Werteverlust usw. Das Ganze meist mit jeder Menge feiner Ironie und leichter Spöttelei, sodass ich mich trotz der ernsten Themen häufig gut amüsierte.
Einen kleinen Haken hat das Buch jedoch, wie ich finde. Durch die vielen ProtagonistInnen wechseln die Erzählstränge zwangsweise häufig und auch schnell. Liest man den Roman zügig durch, dürfte das kein Problem sein. Zieht es sich jedoch etwas hin (wie es bei mir der Fall war), kommt kein richtiger Erzählfluss auf. Die Figuren wurden mir nicht vertraut genug, sodass ich nahtlos wieder einsteigen konnte - häufig musste ich zurückblättern, wer wer war. Trotzdem war es eine unterhaltsame und stellenweise auch erhellende Lektüre.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eine Stadt, die synonym für eine Institution steht: Brüssel und die EU. In dieser Stadt leben die unterschiedlichsten Menschen, vom hohen EU-Beamten mit großen Karriereplänen über einen Hauptkommissar, der in eine brisante Ermittlung schlingert, einen alternden Professor …
Mehr
Eine Stadt, die synonym für eine Institution steht: Brüssel und die EU. In dieser Stadt leben die unterschiedlichsten Menschen, vom hohen EU-Beamten mit großen Karriereplänen über einen Hauptkommissar, der in eine brisante Ermittlung schlingert, einen alternden Professor und einen Altenheimbewohner, der einst Auschwitz überlebte. All diese Geschichten, verbunden durch die Stadt in der sie leben, zeigen die Absurditäten einer überbordenden Bürokratie in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt auf.
Robert Menasse ist mit „Die Hauptstadt“ wirklich ein großer Wurf gelungen. Es ist ein Roman, der viele hochaktuelle Themen anspricht und dabei gleichzeitig kurzweilig und sehr gut lesbar bleibt. Er vermittelt auf sehr leichte Art all die Kuriositäten, die sich um den Machtkomplex EU – oder genauer die Kommission- ranken. Die Charaktere sind so unterschiedlich wie es die Themen sind, die mit ihnen abgedeckt werden, was die Lektüre umso unterhaltsamer macht. Vom Großlobbyisten aus der Schweinezucht bis zum kleinen Beamten ist alles dabei und alle bewegen sich in einem riesigen Netz aus Beziehungen und Interessen, indem man sich eigentlich nur verstricken kann.
Das Buch wurde meiner Meinung nach vollkommen zu Recht mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Autor hat einen sehr komplexen und intelligenten und zugleich gut lesbaren Roman abgeliefert, der hochaktuell und für alle Leser von Interesse ist. Egal ob man begeistert von der europäischen Ideen ist oder sich eher als Europakritiker sieht, hat der Roman viel zu bieten und regt zum Nachdenken an. Robert Menasse hat mit „Die Hauptstadt“ ein Buch geschrieben, dass unbedingt gelesen werden sollte.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Brüsseler Allerlei
Würde ich das Buch kommentieren, wenn es landauf, landab mit weniger Lorbeer behängt worden wäre? Ich würde nicht. Schon gar nicht, wenn dessen Kapitel mit Untersprüchen beschwert werden („Wenn wir in die Zukunft reisen könnten, …
Mehr
Brüsseler Allerlei
Würde ich das Buch kommentieren, wenn es landauf, landab mit weniger Lorbeer behängt worden wäre? Ich würde nicht. Schon gar nicht, wenn dessen Kapitel mit Untersprüchen beschwert werden („Wenn wir in die Zukunft reisen könnten, hätten wir noch mehr Distanz“, u.a.), deren Sinn und Zusammenhang mit dem Folgenden mir regelmäßig verschlossen blieben. Und dennoch tu ich es. Korrumpiert vom vielen Lorbeer?
Ich konzentriere mich auf eine Gestalt in Menasses Werk, eine von den vielen, die durch Brüssels Straßen, Kneipen, Gebäude laufen, vielleicht doch eher irren, essen, schlürfen, schwitzen, intrigieren, von ihren körperlichen und psychischen Schmerzen und der unaufhörlichen Hitze gepeinigt werden. Auf eine aus dem umfangreichen „Personal“ (Bezeichnung von S. Prokopp, einer Amazon-Kommentatorin): den Herrn Professor Erhart. Dieser gelehrte Österreicher hält eine aufrührerische Rede vor einem von der EU finanzierten „think tank“. Es geht um Europas Zukunft, insbesondere die wirtschaftliche. Nach mehreren Anläufen, die vom Autor unterbrochen werden, weil es zwischendurch auf jeweils hundert Seiten ja auch anderes zu berichten gibt (so daß ich immer wieder rekapitulieren mußte, wer denn bloß noch dieser Erhart ist), kommt es endlich. Es muß etwas Großes kommen, es muß der Kulminationspunkt des Romans sein, dachte ich, was sonst hätte die gespreizten Wege von Erhart durch Brüssel gerechtfertigt, bis er loswerden kann, was ihm auf den Nägeln brennt? Doch der Berg kreißte und gebar eine Maus. Das Elend der Ökonomie, so Erhart, sei ihr nationalistischer Charakter. Und Auschwitz müsse europäische Hauptstadt werden.
Alles in allem: ein Buch mit bescheidener Dramaturgie, ein Behälter für Geschichten und Gestalten, die den berühmten roten Faden vermissen lassen. Die Bücher von Menasses Schwester Eva gefallen mir besser. Der Bruder wird’s mir verzeihen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In seinem Europa-Roman stellt der Autor die Hauptpersonen, um die er seine Geschichte entwickelt, dem Leser vor, indem er sie durch eine Gemeinsamkeit eint: alle sehen ein Schwein, das durch Brüssel läuft und einen keineswegs friedlichen Eindruck macht.
Dies sind die ehrgeizige Fenia …
Mehr
In seinem Europa-Roman stellt der Autor die Hauptpersonen, um die er seine Geschichte entwickelt, dem Leser vor, indem er sie durch eine Gemeinsamkeit eint: alle sehen ein Schwein, das durch Brüssel läuft und einen keineswegs friedlichen Eindruck macht.
Dies sind die ehrgeizige Fenia „Xeno“ Xenopoulou, gegen ihre Wünsche ins Kultur Ressort befördert und Kai-Uwe Frigge, Kabinettchef Generaldirektion Handel, mit dem sie eine lockere Beziehung hat;
Dr. Martin Susman, Mitarbeiter in ihrem Team, Kind österreichischer Bauern, dessen Bruder Florian den elterlichen Schweinemastbetrieb erfolgreich weiterführt;
Ryszard „Mateusz“ Oswiecki, der einen Auftrag ausgeführt hat und untertaucht;
David de Vriend, der in Brüssel lebt, Auschwitz überlebt hat und gerade in ein Altersheim übersiedelt ist;
Prof. DDr. Alois Erhart, auch im Alter noch damit beschäftigt ist, seine Kindheit zu verarbeiten und endlich seine eigenen Visionen findet;
Kommissar Emile Brunfaut der einen Mordfall vergessen soll, statt ihn aufzuklären.
Jede dieser Hauptpersonen hat ihre eigene Geschichte, die Menasse erzählt, teilweise durch Rückblenden, vor allem aber, indem er uns an ihren Gedanken teilhaben lässt. Dadurch erklären sich Verhaltensweisen und Handlungen. Manche der Personen kennen einander, andere begegnen sich, verharren jedoch in der Anonymität der Großstadt und als Leser möchte ihnen zurufen, doch miteinander zu reden, weil es wichtig wäre. Die Sprachenvielfalt in Brüssel macht die Kommunikation nicht einfacher.
Robert Menasse beschreibt in diesem Roman das Gefüge der Europäischen Union, Abläufe in der Bürokratie von Brüssel, und dies alles so realistisch, dass es genau so passiert sein könnte, teilweise auch ist. Ähnliche Personen wie die Hauptakteure seiner Geschichte kennen wir alle. Kritisch werden Verträge hinterfragt, die internen Querelen nachvollzogen, aber Kernstück ist die Frage nach der Eigenständigkeit der Nationen unter der Idee einer supranationalen Zukunft – und der nach wie vor aktuelle Umgang mit der Vergangenheit.
Die parallel laufenden Einzelschicksale machen die Geschichte spannend, dazu kommt die gekonnte sprachliche Qualität, die Lesevergnügen garantiert. Besonders die genialen philosophischen Betrachtungen über Dinge wie Senf und Insekten, die der Autor Dr. Martin Susman anstellen lässt, sind skurril, geistreich und witzig.
Leider lässt die Spannung in der zweiten Hälfte des Buches etwas nach, der Autor will uns hier meiner Meinung nach einfach zu viel über Abläufe in der EU und in den Kommissionen mitteilen und auch die langatmigen inneren Selbstdialoge von Prof. Erhart haben dazu geführt, dass mich der Autor kurzzeitig verloren hat, die Geschichte schien mir irgendwie in Nebensächlichkeiten auszufransen. Dann jedoch führt der Autor die Personen im Finale nochmals zusammen und lässt das Schicksal einen gewaltigen Schlusspunkt setzen.
Beim Erscheinen dieses Romans war ich natürlich gespannt, aber die Leseprobe hat mich eher ratlos gemacht. Als Österreicherin kannte ich Menasse bisher nur als Essayist und dieser Roman schien für mich in Richtung Essay, zum Ganzen zusammengefügt, zu gehen. Doch trotz kleiner Einschränkungen hat mich dieser Roman überzeugt und ich habe ihn mit Vergnügen gelesen. Ich empfehle ihn für Leser, die am Thema Europa uinteressiert sind und mögliche Lösungswege für eine gemeinsame Zukunft, und an mit ihren Eigenheiten nur allzu menschlichen Personen. Wenn sie zu wissen glauben, dass EPP für European People's Party, Europäische Volkspartei, steht, dann sollten sie lesen, was Menasse dazu eingefallen ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Brüssel oder Auschwitz
Neueste in der langen Reihe von Ehrungen für den österreichischen Schriftsteller Robert Menasse ist der ihm vor drei Tagen verliehene Preis der Frankfurter Buchmesse für den Roman «Die Hauptstadt». Er hat damit den weltweit ersten EU-Roman …
Mehr
Brüssel oder Auschwitz
Neueste in der langen Reihe von Ehrungen für den österreichischen Schriftsteller Robert Menasse ist der ihm vor drei Tagen verliehene Preis der Frankfurter Buchmesse für den Roman «Die Hauptstadt». Er hat damit den weltweit ersten EU-Roman veröffentlicht, ein Panorama der europäischen Eliten, eine Farce aber auch über die Brüsseler Verhältnisse abseits der Blitzlichtgewitter und rituellen Statements von Spitzenpolitikern, wie man sie aus den Medien kennt. Der europa-politisch engagierte Autor, der sich schon vielfach in Essays und Traktaten mit der europäischen Idee beschäftigt hat, greift hier mit dem Moloch der Brüsseler Bürokratie ein literarisches Thema auf, das in dem schwierigen Fahrwasser, in dem sich die EU derzeit befindet, manchem allein von der guten Absicht her schon preiswürdig erscheinen mag.
«Da läuft ein Schwein». Mit dem ungewöhnlichen Rahmenmotiv eines durch Brüssel irrlichternden Schweins, das im Roman immer wieder mal kurz auftaucht, beginnt Menasse seinen Prolog, sicherlich auch in Hinblick auf die allfälligen Konnotationen. Und wie man bald erfährt, stammt eine seiner Figuren von der EU-Kommission prompt aus dem agrarischen Milieu, sein Bruder betreibt einen Schweinemastbetrieb und ist als Lobbyist in Brüssel aktiv, um von dem gewaltigen Agrar-Etat der Gemeinschaft möglichst viel zu ergattern. Vergleichsweise winzig sind dagegen die Gelder, die Fenia Xenopoulou von der Generaldirektion Kultur zu Verfügung stehen. Sie hat den schwierigen Auftrag, das arg ramponierte Image der Kommission mit einer Feier zu ihrem fünfzigjährigen Bestehen aufzupolieren, - Musils «Parallelaktion» als literarisches Vorbild also! Und sie gewinnt Gefallen an der Idee, dafür Auschwitz heranzuziehen, den Fokus der Gemeinschaft also weg vom kleinteilig Ökonomischen auf das universal Moralische, auf das historische Grauen zu richten, das die Gründungsväter Europas mit ihrem Zusammenrücken ein für alle Mal politisch bannen wollten, nach dem Motto: Nie wieder!
In diversen, fragmentarisch erzählten Handlungssträngen entwickelt Menasse das anschauliche Bild eines engen Geflechts von karrieregeilen Akteuren, die mit- und gegeneinander arbeitend in Think-Tanks nach kreativen Lösungen suchen für die geplante Feier, - oder sie, im Hintergrund und mit geschickten Winkelzügen, schnöde hintertreiben. Der nach außen hin erratische Block der Kommission wird hier zum lebendigen Organismus europäischer Eliten, in dem der Einzelne als das berühmte Rädchen im Getriebe fungiert, sich damit für ein großes Ganzes engagierend. Das im Roman verwendete Insider-Kauderwelsch ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig für den Leser, und die vielen fremdsprachigen Textschnipsel sind ebenfalls nicht gerade leserfreundlich.
Der Plot ist mit einem Mordfall angereichert, dessen spurlose Tilgung aus allen Akten und Datenbanken auf die große Politik hinweist, die Nato ist im Spiel, und da ist alles möglich, es gibt schließlich ja auch noch eine supranationale, vatikanische Killertruppe. Eine der Figuren kommt bei dem Attentat im U-Bahnhof Maelbeek (sic!) ums Leben, und der emeritierte Professor aus einer Nazi-Familie fordert gar in seiner Einführungsrede die Gründung einer neuen europäischen Hauptstadt auf dem Boden von Auschwitz als symbolträchtigem Standort. Das Schwein aber erscheint plötzlich als Hirngespinst einiger überspannter Bewohner Brüssels, das Boulevardblatt lässt ihre hysterisch aufgeblähte Serie daraufhin sang und klanglos in der Versenkung verschwinden. Menasse erzählt seine vielschichtige, zuweilen tief in die Vergangenheit zurückgreifende, turbulente Geschichte durchaus ironisch, er verbindet dabei gekonnt ziemlich disparate Themen miteinander, wobei mir seine überwiegend männlichen Figuren jedoch arg überzeichnet vorkommen. Der große Wurf ist dieser Roman literarisch bestimmt nicht, Buchpreis hin oder her, aber er erweitert den Horizont und ist zudem unterhaltsam, mithin also durchaus bestsellertauglich.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich