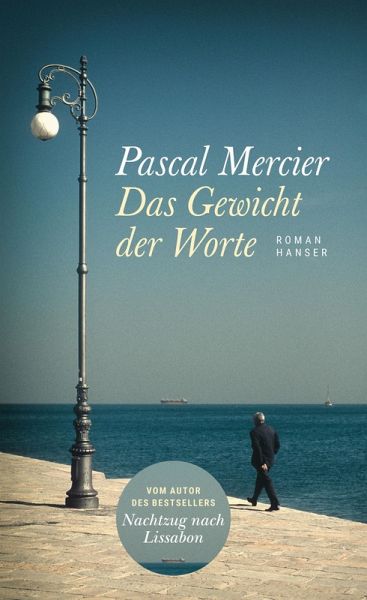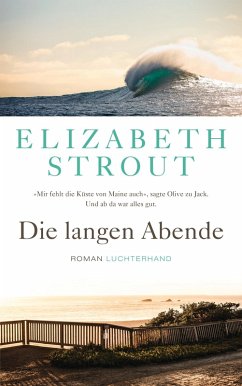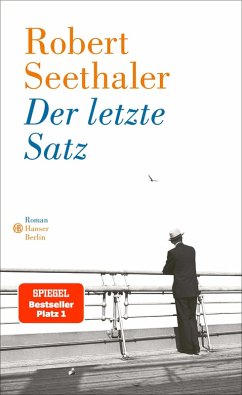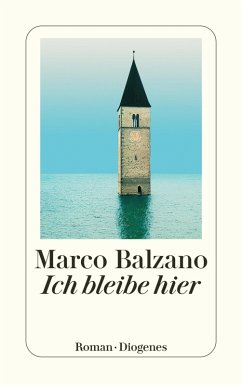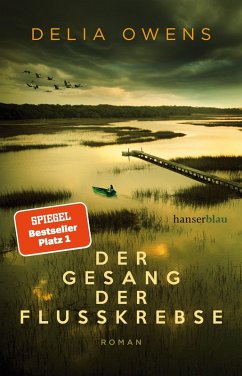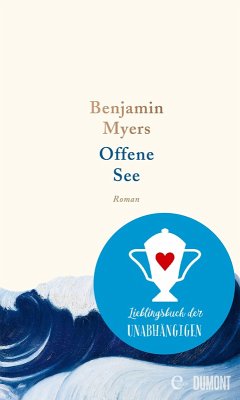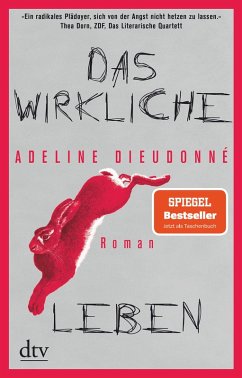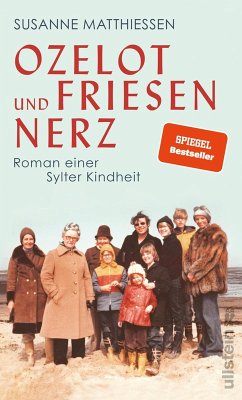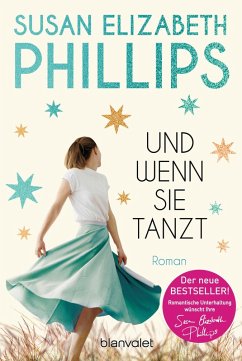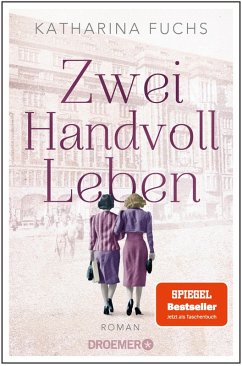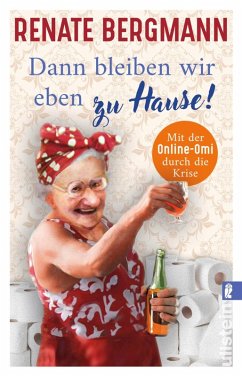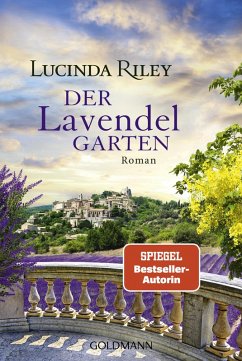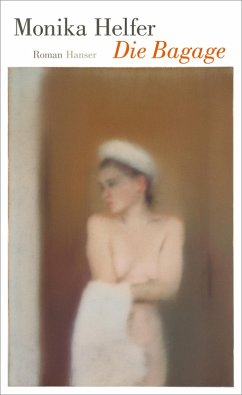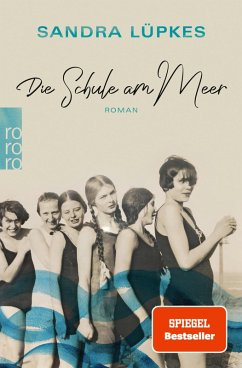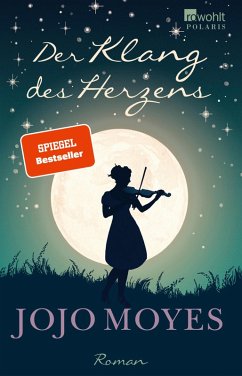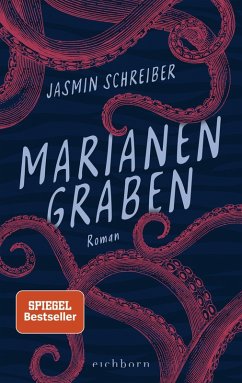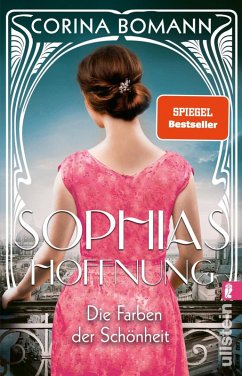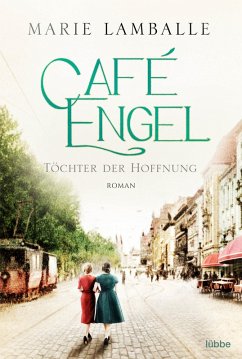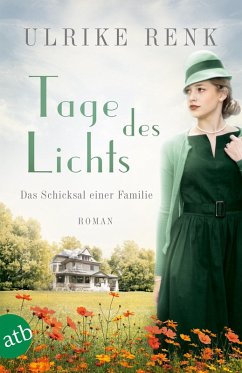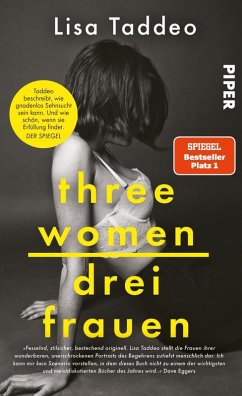Pascal Mercier
eBook, ePUB
Das Gewicht der Worte (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)






"Jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen." - Der neue Roman von Pascal Mercier, dem Autor des Bestsellers "Nachtzug nach Lissabon" Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben - bis ihn ein ärztl...
"Jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen." - Der neue Roman von Pascal Mercier, dem Autor des Bestsellers "Nachtzug nach Lissabon" Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben - bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. Doch dann erweist sich die vermeintliche Katastrophe als Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu einrichten kann. Wieder ist Pascal Mercier ein philosophischer Roman gelungen, bewegend wie der "Nachtzug nach Lissabon."
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 2.06MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Datum der letzten Bewertung der Barrierefreiheit: 20200127
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis für direkten Zugriff auf Text und Medien
- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
- Entspricht EPUB Accessibility Spec 1.0 AA und WCAG Level AA
Pascal Mercier (1944-2023) wurde in Bern geboren und lebte in Berlin. Nach Perlmanns Schweigen (1995) und Der Klavierstimmer (1998) wurde sein Roman Nachtzug nach Lissabon (2004) einer der größen Bestseller der vergangenen Jahre und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2007 folgte die Novelle Lea und 2020 der Roman Das Gewicht der Worte. Unter seinem bürgerlichen Namen Peter Bieri veröffentlichte er, ebenfalls bei Hanser, Das Handwerk der Freiheit (2001) sowie Eine Art zu leben (2013). Pascal Mercier wurde 2006 mit dem Marie-Luise-Kaschnitz-Preis ausgezeichnet und 2007 in Italien mit dem Premio Grinzane Cavour für den besten ausländischen Roman geehrt. 2007 erhielt er die Lichtenberg-Medaille der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

Produktdetails
- Verlag: Carl Hanser Verlag
- Seitenzahl: 576
- Erscheinungstermin: 27. Januar 2020
- Deutsch
- ISBN-13: 9783446266674
- Artikelnr.: 58254266
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Niklas Bender fühlt sich "beleidigt" durch Pascal Merciers neuen Roman. Denn Merciers Einladung zum Rundgang im Textgebäude zieht sich oft so arg hin, dass der Kritiker alle Mühe hat, die Lektüre durchzustehen. Wenn ihm Mercier in der Geschichte um einen verschrobenen britischen Übersetzer, der nach einer falschen Hirntumor-Diagnose seinen geerbten Verlag verkauft, Lebensbilanz zieht und den Neuanfang als Schriftsteller plant, seitenweise und "geschwätzig" von Kühlschrankpostkarten, Topfpflanzen oder Tapetenfalten erzählt, muss Bender feststellen: Mercier ist nicht Proust. Und auch das "leicht exzentrische", aber natürlich absolut tugendhafte Personal des Romans, das sich "kollektiv auf die Schulter klopft", wirkt auf den Rezensenten doch recht "banal".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2020Schön gefühlt, aber wozu?
Treffen sich zwei Schiffbrüchige: Pascal Merciers Roman "Das Gewicht der Worte" setzt allein auf kollektives Schulterklopfen
Die Literatur hat ihre eigene Geselligkeit, aber auch für Autor und Leser gelten Höflichkeitsregeln. Nehmen wir an, dass der Autor ein Gastgeber ist, der durch sein Haus führt: Dann gibt es Ecken, die er dem Leser gern zeigt, andere, die er kaschiert - oder die gerade deshalb gezeigt werden müssen, weil sie schön schmuddelig sind. Es gibt Gesetze des Verweilens, die Dauer entspricht dem Gezeigten; diese Regeln sind andere als etwa in der Philosophie, wo man alle Zeit der Welt hat. In der Literatur sind Regeln der Ästhetik und des Sozialverhaltens verknüpft: Was
Treffen sich zwei Schiffbrüchige: Pascal Merciers Roman "Das Gewicht der Worte" setzt allein auf kollektives Schulterklopfen
Die Literatur hat ihre eigene Geselligkeit, aber auch für Autor und Leser gelten Höflichkeitsregeln. Nehmen wir an, dass der Autor ein Gastgeber ist, der durch sein Haus führt: Dann gibt es Ecken, die er dem Leser gern zeigt, andere, die er kaschiert - oder die gerade deshalb gezeigt werden müssen, weil sie schön schmuddelig sind. Es gibt Gesetze des Verweilens, die Dauer entspricht dem Gezeigten; diese Regeln sind andere als etwa in der Philosophie, wo man alle Zeit der Welt hat. In der Literatur sind Regeln der Ästhetik und des Sozialverhaltens verknüpft: Was
Mehr anzeigen
wegen Überlänge nervt, missfällt dem Geschmack. Anders gesagt: Plaudertaschen sind doppelt verpönt, ethisch und ästhetisch.
Der neue Roman von Pascal Mercier (bürgerlich Peter Bieri, Philosophieprofessor em.) heißt "Das Gewicht der Worte" und ist zutiefst unhöflich. Dabei läge seinem Helden nichts ferner: Simon Leyland wirkt wie ein exzentrischer, aber erzanständiger Mann, das Abziehbild eines Briten eben. Der einundsechzigjährige Übersetzer ist in einer eigenartigen Lage: Im Sommer noch glaubte er sich an einem Hirntumor erkrankt und verkaufte den Triester Verlag, den seine verflossene Frau Livia ihm elf Jahre zuvor überlassen hatte. Dann - nach elf Wochen Todesangst - hat er erfahren, dass man ihm Bilder und Krankheit eines anderen zugeschrieben hat. Aktuell ist er in London, wo er in einem geerbten Haus sein Leben neu ordnet. Die Gefühle mischen sich: Die Rückschau auf die überstandene Schreckenszeit, welche ihrerseits eine gedanken- und wortreiche Lebensbilanz enthält, geht über in den Londoner Neuanfang, Abstecher nach Triest, Mailand und Padua inklusive. Nach dem Verlagsverkauf steht Leyland vor viel Geld und wenig Projekten. Das halbe Jahr der Romanhandlung dient seiner Neuorientierung inklusive der Entdeckung seiner schriftstellerischen Berufung.
Um seinen Helden herum entwirft Mercier einen schönfühlenden Mikrokosmos. Da wären Leylands Kinder Sophia und Sidney, angehende Ärztin respektive angehender Anwalt, die aber die "weiße" und die "schwarze Kaste" verlassen, um ihren Leben eine neue Richtung zu geben. Hinzu kommen mit Andrej Kuzmín ein ehemaliger russischer Häftling (Totschlag aus Leidenschaft) und Übersetzer, mit Leylands Nachbar Kenneth Burke ein ehemaliger Apotheker, der die Armen gesetzeswidrig mit Medikamenten versorgt hat, mit Pat Kilroy ein irischer Kellner, der Dichtung liebt, mit Francesca Marchese eine steinreiche Autorin, die einen mühsam verfassten Roman nicht publiziert, mit Paolo Michelis ein bettelarmer Autor und Hilfslehrer - und noch viele mehr. Den Wichtigeren unter ihnen gemein ist, dass sie einen befreienden Schritt machen, der sie dem Eigentlichen näher bringt, weil er mit sozialen Regeln bricht. Mercier benennt sein Programm apropos der Freundschaft mit Burke: "Es gab Momente, da kam es mir vor, als sprächen zwei Schiffbrüchige miteinander. Doch dabei blieb es nicht. Es begann eine neue gemeinsame Zukunft." Kollektives Wohlfühlen und Schulterklopfen sind zentral.
Zurück zur Höflichkeit. Der Gastgeber Mercier ist charmant und unterhaltsam, doch er nötigt seine Besucher: Bei jeder Kühlschrankpostkarte verweilt er, jeder Topfpflanze, jeder Tapetenfalte widmet er zwanzig geschwätzige Seiten. Literarische Abschweifungskunst kann legitim sein, bei Proust etwa, weil der Leser Wichtiges über den Erzähler erfährt oder in den Genuss raffinierter Ansichten zu Gesellschaft, Psychologie, Kunst, Literatur kommt. Vielleicht war das Merciers Kalkül, aber es geht nicht auf. Sein Held ist zwar ebenfalls ein Mensch der Erinnerung und der Worte, bleibt aber flach; seine An- und Einsichten sind meist banal. Anders als vom Titel angekündigt, wird den Worten kaum Gewicht zuteil. Wer sie in großer Menge ohne Sachwertdeckung und blind streut, darf sich über Inflation nicht wundern.
Verstärkt wird sie durch das Wiederkäuen des Erlebten in Briefen an die verstorbene Livia, eine verbale Verdauung, die wiederum kommentiert wird: "Er wollte es sich vergegenwärtigen, den Bildern, Gedanken und Worten freien Lauf lassen und ihnen zugleich eine Ordnung geben. Und so begann er, die Geschehnisse und Empfindungen in der Art, wie sie ineinandergriffen, für sich und Livia aufzuschreiben." Wer meint, solche Banalitäten überhaupt erklären zu müssen, und dies dann erst auf Seite 500 tut, beleidigt seine Leser doppelt.
Hinzu kommt Gesinnungskitsch. Nicht nur der Held, alle Figuren sind leicht exzentrisch, aber - dem Maßstab des Romans zufolge - grundinteger; keine hat wirkliche Ambivalenzen oder Abgründe. Michelis zum Beispiel ist arm, aber großzügig. "Man brauchte nicht lange mit ihm zu reden, um zu wissen: Er war ein Mann, der für etwas brennen konnte, ein Mann, der immer etwas suchen würde, was ihn entflammen könnte. Schon die Art, wie er in seinem weit geschnittenen, hellen Leinenanzug an die Tür kam und Francesca umarmte: Es lag eine solche Offenheit und Großzügigkeit darin, ein solches Bedürfnis, etwas zu verschenken." So geht es weiter: "Alles war von dieser überwältigenden Großzügigkeit. Sogar seine Art zu sitzen war großzügig, verschwenderisch", denn "er brauchte das ganze Sofa für sich allein". Na, wenn das mal nicht großzügig ist.
Wie in einem sepiafarbenen Puzzle ("Die fabelhafte Welt der Amélie" liegt nicht fern) findet jeder dieser Tugendbolde seinen Platz, auch dank der Wohlhabenden, welche die Rolle der Maschinengötter übernehmen. Schließlich gibt es ein paar Böse, Ärzte und Juristen, denen ein Kastenbewusstsein zugeschrieben wird - oder aber Literaturkritiker; Neil McKenna, das schlimmste Exemplar, lässt Mercier reuevoll knirschen. Viel davon kennt man aus anderen Mercier-Romanen (am bekanntesten ist "Nachtzug nach Lissabon" von 2004), die ihren Erfolg nicht radikalen Zweifeln verdanken, sondern einem unbedarften Grundvertrauen ins Gute, das wie der naive Freundschaftskult den Pseudonymbezug auf Blaise Pascal absurd scheinen lässt. Besonders ärgerlich ist dieses Gutmenschentum aber nun in "Das Gewicht der Worte", einem Roman über Literatur. Damit setzt Mercier sich einen Maßstab, dem er nicht genügen kann, allem prophylaktischen Schimpfen auf Rezensenten zum Trotz.
NIKLAS BENDER
Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte". Roman.
Hanser Verlag, München 2020. 574 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der neue Roman von Pascal Mercier (bürgerlich Peter Bieri, Philosophieprofessor em.) heißt "Das Gewicht der Worte" und ist zutiefst unhöflich. Dabei läge seinem Helden nichts ferner: Simon Leyland wirkt wie ein exzentrischer, aber erzanständiger Mann, das Abziehbild eines Briten eben. Der einundsechzigjährige Übersetzer ist in einer eigenartigen Lage: Im Sommer noch glaubte er sich an einem Hirntumor erkrankt und verkaufte den Triester Verlag, den seine verflossene Frau Livia ihm elf Jahre zuvor überlassen hatte. Dann - nach elf Wochen Todesangst - hat er erfahren, dass man ihm Bilder und Krankheit eines anderen zugeschrieben hat. Aktuell ist er in London, wo er in einem geerbten Haus sein Leben neu ordnet. Die Gefühle mischen sich: Die Rückschau auf die überstandene Schreckenszeit, welche ihrerseits eine gedanken- und wortreiche Lebensbilanz enthält, geht über in den Londoner Neuanfang, Abstecher nach Triest, Mailand und Padua inklusive. Nach dem Verlagsverkauf steht Leyland vor viel Geld und wenig Projekten. Das halbe Jahr der Romanhandlung dient seiner Neuorientierung inklusive der Entdeckung seiner schriftstellerischen Berufung.
Um seinen Helden herum entwirft Mercier einen schönfühlenden Mikrokosmos. Da wären Leylands Kinder Sophia und Sidney, angehende Ärztin respektive angehender Anwalt, die aber die "weiße" und die "schwarze Kaste" verlassen, um ihren Leben eine neue Richtung zu geben. Hinzu kommen mit Andrej Kuzmín ein ehemaliger russischer Häftling (Totschlag aus Leidenschaft) und Übersetzer, mit Leylands Nachbar Kenneth Burke ein ehemaliger Apotheker, der die Armen gesetzeswidrig mit Medikamenten versorgt hat, mit Pat Kilroy ein irischer Kellner, der Dichtung liebt, mit Francesca Marchese eine steinreiche Autorin, die einen mühsam verfassten Roman nicht publiziert, mit Paolo Michelis ein bettelarmer Autor und Hilfslehrer - und noch viele mehr. Den Wichtigeren unter ihnen gemein ist, dass sie einen befreienden Schritt machen, der sie dem Eigentlichen näher bringt, weil er mit sozialen Regeln bricht. Mercier benennt sein Programm apropos der Freundschaft mit Burke: "Es gab Momente, da kam es mir vor, als sprächen zwei Schiffbrüchige miteinander. Doch dabei blieb es nicht. Es begann eine neue gemeinsame Zukunft." Kollektives Wohlfühlen und Schulterklopfen sind zentral.
Zurück zur Höflichkeit. Der Gastgeber Mercier ist charmant und unterhaltsam, doch er nötigt seine Besucher: Bei jeder Kühlschrankpostkarte verweilt er, jeder Topfpflanze, jeder Tapetenfalte widmet er zwanzig geschwätzige Seiten. Literarische Abschweifungskunst kann legitim sein, bei Proust etwa, weil der Leser Wichtiges über den Erzähler erfährt oder in den Genuss raffinierter Ansichten zu Gesellschaft, Psychologie, Kunst, Literatur kommt. Vielleicht war das Merciers Kalkül, aber es geht nicht auf. Sein Held ist zwar ebenfalls ein Mensch der Erinnerung und der Worte, bleibt aber flach; seine An- und Einsichten sind meist banal. Anders als vom Titel angekündigt, wird den Worten kaum Gewicht zuteil. Wer sie in großer Menge ohne Sachwertdeckung und blind streut, darf sich über Inflation nicht wundern.
Verstärkt wird sie durch das Wiederkäuen des Erlebten in Briefen an die verstorbene Livia, eine verbale Verdauung, die wiederum kommentiert wird: "Er wollte es sich vergegenwärtigen, den Bildern, Gedanken und Worten freien Lauf lassen und ihnen zugleich eine Ordnung geben. Und so begann er, die Geschehnisse und Empfindungen in der Art, wie sie ineinandergriffen, für sich und Livia aufzuschreiben." Wer meint, solche Banalitäten überhaupt erklären zu müssen, und dies dann erst auf Seite 500 tut, beleidigt seine Leser doppelt.
Hinzu kommt Gesinnungskitsch. Nicht nur der Held, alle Figuren sind leicht exzentrisch, aber - dem Maßstab des Romans zufolge - grundinteger; keine hat wirkliche Ambivalenzen oder Abgründe. Michelis zum Beispiel ist arm, aber großzügig. "Man brauchte nicht lange mit ihm zu reden, um zu wissen: Er war ein Mann, der für etwas brennen konnte, ein Mann, der immer etwas suchen würde, was ihn entflammen könnte. Schon die Art, wie er in seinem weit geschnittenen, hellen Leinenanzug an die Tür kam und Francesca umarmte: Es lag eine solche Offenheit und Großzügigkeit darin, ein solches Bedürfnis, etwas zu verschenken." So geht es weiter: "Alles war von dieser überwältigenden Großzügigkeit. Sogar seine Art zu sitzen war großzügig, verschwenderisch", denn "er brauchte das ganze Sofa für sich allein". Na, wenn das mal nicht großzügig ist.
Wie in einem sepiafarbenen Puzzle ("Die fabelhafte Welt der Amélie" liegt nicht fern) findet jeder dieser Tugendbolde seinen Platz, auch dank der Wohlhabenden, welche die Rolle der Maschinengötter übernehmen. Schließlich gibt es ein paar Böse, Ärzte und Juristen, denen ein Kastenbewusstsein zugeschrieben wird - oder aber Literaturkritiker; Neil McKenna, das schlimmste Exemplar, lässt Mercier reuevoll knirschen. Viel davon kennt man aus anderen Mercier-Romanen (am bekanntesten ist "Nachtzug nach Lissabon" von 2004), die ihren Erfolg nicht radikalen Zweifeln verdanken, sondern einem unbedarften Grundvertrauen ins Gute, das wie der naive Freundschaftskult den Pseudonymbezug auf Blaise Pascal absurd scheinen lässt. Besonders ärgerlich ist dieses Gutmenschentum aber nun in "Das Gewicht der Worte", einem Roman über Literatur. Damit setzt Mercier sich einen Maßstab, dem er nicht genügen kann, allem prophylaktischen Schimpfen auf Rezensenten zum Trotz.
NIKLAS BENDER
Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte". Roman.
Hanser Verlag, München 2020. 574 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Ein Roman zum Runterkommen, der aber durchaus intellektuelle Substanz bietet." Denis Scheck, Tagesspiegel, 05.07.20 "Ein Buch, das mit sanfter Beharrlichkeit gegen den Strom schwimmt." Torsten Unger, MDR Kultur, 22.03.20 "Der Roman ist philosphisch, nachdenklich und poetisch." Uta Kenter, 3sat Kulturzeit, 11.02.20 "Mercier liefert mit diesem großen lebenshungrigen Roman endlich Nachschub für alle 'Nachtzug nach Lissabon'-Fans." Brigitte, 29.01.20 "Ein tiefgründiges und zugleich unterhaltsames Buch - das auch etwas über den Schriftsteller dahinter erzählt." Luzia Stettler, SRF Literatur, 27.01.20 "Als Schriftsteller, nah an Proust, entfaltet Mercier anhand einer Figur, was die Zeit anrichten kann. Als Philosoph Bieri entwickelt er Fragen, die einen lange beschäftigen können. Wie ist es, sich selbst zu fühlen? Was habe ich aus der Zeit meines Lebens gemacht?" Christine Richard, Tages-Anzeiger, 26.01.20 "Vorsichtig, behutsam lässt Pascal Mercier seinen Protagonisten sein literarisches Potential entdecken. Dabei beweist er sein eindrucksvolles Gespür für sprachliche Nuancen. ... Ein hochgradig reflektierter Roman, der nicht nur die Geschichte eines erwachenden Autors, sondern eines sich völlig neue erfindenden Menschen erzählt.." Anja Dalotta, Norddeutscher Rundfunk, 22.01.20
Gebundenes Buch
Simon Leyland ist Übersetzer und lebt in Triest, der Stadt der Wörter. Er hat zwei Kinder, Sophia und Sydney. Seine Frau Livia ist einem plötzlichen Herztod erlegen. Leyland erhält eines Tages die Diagnose eines Hirntumors. Der Arzt, Dr. Leonardi schaut auf das Röntgenbild …
Mehr
Simon Leyland ist Übersetzer und lebt in Triest, der Stadt der Wörter. Er hat zwei Kinder, Sophia und Sydney. Seine Frau Livia ist einem plötzlichen Herztod erlegen. Leyland erhält eines Tages die Diagnose eines Hirntumors. Der Arzt, Dr. Leonardi schaut auf das Röntgenbild und sagt ihm, dass er ein Glioblastom habe. Wie lange noch? fragt Leyland ihn. Und er antwortet: Ein paar Monate. Leyland verzweifelt an dieser Diagnose, er beginnt, die Zeit, die er noch hat, anders einzuordnen. Keine Zeit zu verschwenden. Was ist wichtig, was unwichtig. Elf Wochen lebt er mit dieser Diagnose, die sein ganzes Leben verändert. Nach diesen elf Wochen stellt sich heraus, dass alles ein Irrtum war. Jetzt hat Leyland wieder eine Zukunft und muss sich wiederum damit erst einmal arrangieren.
Leyland hat als Junge bei seinem Onkel eine Karte vom Mittelmeer an der Wand gesehen. Spontan sagt er zu seinem Onkel: Ich will alle Sprachen lernen, von den Ländern, die ans Mittelmeer grenzen. Und genau das tut er auch. Er lernt alle verschiedenen Sprachen. Und das Wichtigste von allem sind Leyland die Worte.
Zitat Seite 20:
"Oft hatte er sich gewünscht, ohne Worte bei den Sachen zu sein, bei den Sachen und den Menschen und den Gefühlen und den Träumen - und dann waren ihm doch wieder die Worte dazwischengekommen. Er erlebe die Dinge erst, wenn er sie in Worte gefasst habe, sagte er manchmal, nur dann sahen ihn die Leute ungläubig an".
Er richtet sich sein neues Leben langsam wieder ein, schließt Freundschaften, und hat plötzlich wieder eine Zukunft vor sich. Mit vielen neuen Dingen und großen Plänen.
Eine meiner Lieblingsstellen aus dem Buch: Seite 361:
"Was ist eigentlich Poesie? Die poetische Gegenwart ist wie herausgehoben aus dem Fluss und der drängenden Abfolge des zeitlichen Geschehens. Poesie erlaubt einem, ganz bei einer Sache zu sein. Etwas Poetisches, ein Satz, ein Bild, ein Klang: Es fesselt einen wie nichts sonst. Man möchte, dass es nicht aufhört oder verschwindet, man möchte immer mehr davon... Etwas Poetisches, auch wenn es nur etwas Kleines ist, ein winziges Detail, gibt dem Leben im Moment der Betrachtung eine Tiefe, die es sonst nicht hat".
Pascal Mercier hat mit diesem Roman ein so wundervolles, wunderschön geschriebenes Buch geschaffen, das mich sehr begeistert hat. Der Schreib- und Erzählstil sind so tiefgehend, poetisch und philosophisch, wie es selten alles in einem Roman vereint ist. Ich bin hinabgetaucht in die Geschichte von Simon Leyland und wollte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Dieser Roman hat mich gefangengenommen und gefesselt, durch die außergewöhnliche Sprache und den Tiefgang. Einfach wundervoll. Dieser Roman ist für mich gehobene, anspruchsvolle Literatur, gepaart mit Poesie, Philosophie und Tiefgang.
Dies ist eines der wenigen Bücher, die ich auf jeden Fall noch einmal lesen werde.
Fazit:
Mein Lesehighlight für 2020. Ein wundervoller, wunderschön geschriebener Roman, poetisch, philosophisch, voller Tiefgang. Er hat mich einfach nur begeistert.
Weniger
Antworten 21 von 22 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 21 von 22 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Langweilig
Der Autor von „Nachtzug nach Lissabon“ und dieses Buch habe ich gern gelesen, bringt sein neues Buch auf den Markt. Während ich glaubte, in Corona-Zeiten Bücher lesen zu können, kann ich zu diesem hier nur sagen: Langweilig.
Bis Seite 60 gequält, weiter …
Mehr
Langweilig
Der Autor von „Nachtzug nach Lissabon“ und dieses Buch habe ich gern gelesen, bringt sein neues Buch auf den Markt. Während ich glaubte, in Corona-Zeiten Bücher lesen zu können, kann ich zu diesem hier nur sagen: Langweilig.
Bis Seite 60 gequält, weiter nicht. Auch während Corona ist Zeit für schlechte Bücher zu schade. 1 Stern
Weniger
Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Unspektakulär und doch bedeutend!
Das Thema Sprachen und Übersetzen sowie Verlage interessiert mich und Pascal Merciers sehr ruhiger, fast meditativer Erzählstil spricht mich an.
In der von Markus Hoffmann getragen gesprochenen Hörbuchfassung wirkt das besonders gut. Sprache …
Mehr
Unspektakulär und doch bedeutend!
Das Thema Sprachen und Übersetzen sowie Verlage interessiert mich und Pascal Merciers sehr ruhiger, fast meditativer Erzählstil spricht mich an.
In der von Markus Hoffmann getragen gesprochenen Hörbuchfassung wirkt das besonders gut. Sprache und Bedeutung durchzieht das ganze Hörbuch. Gespiegelt wird das im sensiblen, bedächtigen Protagonisten Simon Leyland.
Eine Erkrankung ändert sein Leben. Es gibt einen Verdacht auf einen Hirntumor, angeblich unheilbar und tödlich.
Er verkauft seinen Verlag in Triest und erbt überraschend ein Haus in London. Als sich herausstellt, dass seine Krankheit eine Fehldiagnose war, ist sein Leben dennoch verändert. Als Leser macht man die Gefühlsbewegungen mit durch.
Sehr schön Leylands Freundschaft zum Nachbarn Kenneth Berg. Auch der Handlungspart um Lelylands Tochter ist einfühlsam gemacht. Und schließlich faszinierte mich der Prozess, wie der Übersetzer Leyland selbst zum Schriftsteller wird.
Manche Passagen sind sorgfältig ausgearbeitet, manchmal ist es sehr unspektakulär und aus ein paar Motiven hätte man auch noch mehr machen können. Der Roman ist im zeitgenössischen Feuilleton umstritten, aber ich persönlich habe das Buch gemocht, da es ganz offensichtlich eine ganz eigene Größe besitzt.
Weniger
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Worte die beeindrucken
Ich muss zugeben, dass " Nachtzug nach Lissabon" eines meiner Lieblingsbücher ist, umso gespannter war ich auf das Hörbuch zu "Das Gewicht der Worte". Vorab, es erreicht nicht ganz das Niveau aber nach wie vor ein wunderschönes …
Mehr
Worte die beeindrucken
Ich muss zugeben, dass " Nachtzug nach Lissabon" eines meiner Lieblingsbücher ist, umso gespannter war ich auf das Hörbuch zu "Das Gewicht der Worte". Vorab, es erreicht nicht ganz das Niveau aber nach wie vor ein wunderschönes Buch.
Geschichte: Simon Leyland schmeißt die Schule und fängt als Nachtportier in einem kleinem Hotel in London an zu arbeiten. Seine Liebe gilt den Sprachen und nach einem Blick auf die Karte im Arbeitszimmer seines Onkels ( eine Karte des Mittelmeers) wächst der Wunsch in ihm, alle Sprachen der Länder zu sprechen, die an das Mittelmeer angrenzen. Als er im Hotel einen Gast trifft, der eine Übersetzung eines Kinderbuchs benötig, setzt sich Leyland daran und übersetzt den Text in einer Nacht. Der Gast ist begeistert und vermittelt Leyland weitere Aufträge. Als Leyland Jahre später mit seiner Frau nach Triest reist, da sie den Verlag von ihrem Vater übernehmen soll, befindet er sich am Ziel seiner Wünsche, dem Mittelmeer....Da bekommt er aufgrund seiner permanenten Migräne eine falsche Diagnose gestellt und sein Leben ändert sich in ungeahnten Ausmaßen....
Was unspektakulär klingt, ist es auch aber dies ist eine Liebesgeschichte an Übersetzungen, Bücher und vor allem eine Auseinandersetzung mit den Bedeutungen von Wörtern und ihrer Übersetzung. Eine Huldigung an Übersetzer, die tief in den Charakter und die Aussprache der Romanautoren eindringen müssen, um in der übersetzten Sprache den genauen Ton wiederzufinden und die Bedeutung des Satzes einer fremden Sprache, genau zu treffen. Leyland ist einfach nur sympathisch und das Buch erzählt so schön leise und warm eine wunderbare Geschichte seines Lebens. Die Menschen, die er trifft sind auf eine seltsame Art und Weise einfach nur Charaktervolle Menschen, die jeder von uns gerne um sich hätte. Sei es die Bedienung in Triest , ein irischer Gerechtigkeitsfanatiker oder ein ehemaliger russischer Knastbruder, dem Leyland zu helfen vermag. Alles an diesem Buch ist so wortgewaltig und man möchte nicht mehr aufhören das Buch anzuhören. Markus Hoffmann als Sprecher ist der Beste, den man für dieses Buch holen konnte, da seine Stimme einfach nur purer Genuss ist und so ideal zu diesem Hörbuch passt wie es nur geht.
Noch Tage nach dem Lesen verbleibt eine Einsamkeit und ein Verlust, dass dieses Buch zu Ende ist, dass es weh tut. Einziger Kritikpunkt sind die häufigen Wiederholungen in Form von Zusammenfassungen, die Leyland als Brief an seine Frau schreibt. Es hätte kürzer sein müssen aber durch den Gesamteindruck nimmt es trotzdem keinen Stern weg. Es ist romantisch, tragisch, traurig, lebt durch seine Wortwahl und seine Charaktere auf die Leyland immer wieder neu trifft und die aus fremden Freunde machen. Es gibt sehr merkwürdige Menschen und Leute die man eher ablehnen würde, die aber trotzdem irgendetwas besonderes an sich haben.
Fazit: Wer Bücher liebt, wer Sprache und Ausdruck liebt und eher eine ruhige und entspannte Erzählung gerne hat ohne permanent Spannung und Action verspüren zu müssen, für den ist das Buch ein Genuss und eine absolute Empfehlung. Die Ortswechsel zwischen London und Triest sind absolut klasse und mich juckt es stark, die Straßen und Orte zu besuchen. 5 Sterne für ein weiteres Meisterwerk der Literatur!
Weniger
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Triest. In diese wunderschöne Hafenstadt im Nordosten Italiens folgt Simon Leyland seiner Frau Livia, welche dort ihr Erbe eines Verlags antritt. Die „Molo Audace“, ein Steinpier aus dem 18. Jahrhundert, ist ein wunderbarer Ort um das Leben auf sich wirken zu lassen. Doch wie das …
Mehr
Triest. In diese wunderschöne Hafenstadt im Nordosten Italiens folgt Simon Leyland seiner Frau Livia, welche dort ihr Erbe eines Verlags antritt. Die „Molo Audace“, ein Steinpier aus dem 18. Jahrhundert, ist ein wunderbarer Ort um das Leben auf sich wirken zu lassen. Doch wie das Leben so spielt, ereignen sich Schicksalsschläge, die Simon einen ganz anderen Blick auf sein Leben gewähren. Plötzlich findet Simon sich in London wieder und kommt zu einer unerwarteten Begegnung woraus eine wahre Freundschaft erwächst.
Mit „Das Gewicht der Worte“ ist Pascal Mercier ähnlich wie „Nachtzug nach Lissabon“ ein sehr bewegender philosophischer Roman gelungen. Als Leserin habe ich oft innegehalten und mich gefragt „wie ist das eigentlich bei mir?“, „geht es mir ähnlich?“, „was empfinde ich in einem solchen Moment?“. Augenblicke die mich als Leserin abholen und in diesen Roman eintauchen lassen.
Beispielsweise seien hier Sätze wie „Trotzdem war es anders als bei ihm. Er hatte den Eindruck, Jahre mit etwas verschwendet zu haben, was er überhaupt nicht wollte und nicht genoss. Mit etwas, was ihm jetzt als ganz und gar entfremdet vorkam, eine Zeit, in der er nicht bei sich selbst war.“; „Doch nun spürte ich: das konnte nicht alles gewesen sein, es gab da noch ein anderes Leben zu entdecken, oder sogar viele andere.“; „Das können nur Menschen, sagte sie: ihr Leben verpassen, sich selbst verpassen in dem, was sie vielleicht hätten werden können, hingegeben an eine hektische, tyrannische, gebieterische Zeit. Tieren kann das nicht zustoßen: Sie sind in jedem Augenblick, was sie sind, versunken in blinde Gegenwart und Selbstvergessenheit..
Und obwohl „Das Gewicht der Worte“ in mir als Leserin viel bewegt hat (und auch immer noch bewegt) entwickelt sich eine Leichtigkeit und Freiheit der Literatur („Die Phantasie ist der eigentliche Ort der Freiheit.“ ) die ihres gleichen sucht. Wieder ein Roman der noch einige Zeit nachhallen wird.
Es ist kein Buch, welches man „mal eben“ zwischendurch lesen können wird. Ich gebe hier aber eine ganz klare Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Eine geistreiche leise Geschichte
„Weißt du, was mir [Simon Leyland] daran am besten gefällt? Dass die Erzählung so unspektakulär ist. Das nichts Heftiges passiert, kein lautes Drama.“
Simon Leyland ist ein sprachlich gewandter Übersetzer, der den Ehrgeiz …
Mehr
Eine geistreiche leise Geschichte
„Weißt du, was mir [Simon Leyland] daran am besten gefällt? Dass die Erzählung so unspektakulär ist. Das nichts Heftiges passiert, kein lautes Drama.“
Simon Leyland ist ein sprachlich gewandter Übersetzer, der den Ehrgeiz hat, alle Sprachen im Mittelmeerraum zu erlernen. Irgendwann entschließt er sich, selbst ein Buch zu schreiben. Der Auszug passt auf seinen Protagonisten Fontaine, aber auch darauf, wie Autor Pascal Mercier das Leben seines Protagonisten Simon Leyland darstellt.
Auf Basis der Ereignisse (seine Fehldiagnose, Tod seiner Frau Livia) hätte man ein Drama entwerfen können. Mercier hat es vorgezogen, einen Mikrokosmos zu kreieren, in dem Gedanken und Erinnerungen dominieren, der von Freundschaften handelt und in dem Schicksalsschläge auf eine sanfte Art und Weise behandelt werden.
Elf Wochen Ungewissheit über sein eigenes Schicksal verändern Leylands Leben. Er verkauft im Hinblick auf seinen zu erwartenden baldigen Tod aufgrund eines Hirntumors seinen von Livia geerbten Triester Verlag und sortiert sein Leben neu. Seinen Arzt, Dr. Leonardi, konfrontiert er mit der Fehldiagnose aufgrund der vertauschten Röntgenbilder.
Mercier stellt zahlreiche Personen aus Leylands Umfeld vor, so seine Kinder Sidney und Sophia, seinen Nachbarn und Freund Kenneth Burke, den ehemaligen Häftling Andrej Kuzmin, die Autorin Francesca Marchese, um nur Beispiele zu benennen. Die Verflechtungen zwischen den Personen sowie deren Motive werden deutlich.
Ereignisse werden in den zahlreichen Briefen, die Leyland an seine verstorbene Frau schreibt, reflektiert. Das führt zu Wiederholungen. Die Erzählungen wirken teilweise in die Länge gezogen. Insofern wird nicht jedermann durch diesen Schreibstil angesprochen. Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Moral sind Themen, dennoch hat mich das „Gewicht der Worte“ nicht wirklich überzeugt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Von Pascal Mercier hatte ich bereits einige Bücher gelesen. Und von daher konnte ich mir ausrechnen, welchen Stil dieses Hörbuch haben wird. Es ist zwar lang, lohnt aber jedes Wort. Wie bei jedem anderen Buch von Pascal Mercier auch, werde ich als Konsument nachdenklich zurück …
Mehr
Von Pascal Mercier hatte ich bereits einige Bücher gelesen. Und von daher konnte ich mir ausrechnen, welchen Stil dieses Hörbuch haben wird. Es ist zwar lang, lohnt aber jedes Wort. Wie bei jedem anderen Buch von Pascal Mercier auch, werde ich als Konsument nachdenklich zurück gelassen und daran erinnert, dass ich die persönliche Freiheit habe, mein Leben selbst zu gestalten und ihm einen Sinn zu geben.
Simon Leyland zum Beispiel hat sich in den Kopf gesetzt alle Sprachen des Mittelmeerraumes zu erlernen. Durch einen Zufall erhält er die Gelegenheit ein Kinderbuch zu übersetzen. Und von diesem glücklichen Umstand beflügelt, eilt er seinem Ziel nur noch entschlossener entgegen. Dann erhält er eine furchtbare Diagnose. Und fortan wollen ihn die Worte nicht mehr so ohne Weiteres erreichen. Entsetzlich! Doch aus dieser Tragödie erwächst für ihn die große Chance sein bisheriges Leben zu reflektieren und zu überdenken. Und einige Korrekturen vorzunehmen.
Der Sprecher Markus Hoffmann hat eine sehr angenehme Stimme und passt perfekt zu dieser Story. Empfehlenswert!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ich habe das Hörbuch gehört und fand es wirklich schön.
Der Roman selbst handelt sowohl von der Freiheit, unser Leben zu gestalten, als auch von der Freiheit, die uns dabei die Literatur verspricht.
Der Autor hat viel Mühe und Liebe in dieses Buch gesteckt und eine interessante …
Mehr
Ich habe das Hörbuch gehört und fand es wirklich schön.
Der Roman selbst handelt sowohl von der Freiheit, unser Leben zu gestalten, als auch von der Freiheit, die uns dabei die Literatur verspricht.
Der Autor hat viel Mühe und Liebe in dieses Buch gesteckt und eine interessante Geschichte gezaubert.
Das Hörbuch ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Protagonist Simon Leyland ist seit seiner Kindheit von Sprachen fasziniert und wird später gegen den Willen seiner Eltern Übersetzer. Er verfolgt unbeirrt sein Ziel, alle Sprachen rund ums Mittelmeer zu lernen. Mit seiner Frau geht er nach Triest und glaubt dort den idealen Ort …
Mehr
Der Protagonist Simon Leyland ist seit seiner Kindheit von Sprachen fasziniert und wird später gegen den Willen seiner Eltern Übersetzer. Er verfolgt unbeirrt sein Ziel, alle Sprachen rund ums Mittelmeer zu lernen. Mit seiner Frau geht er nach Triest und glaubt dort den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben. Dann wirft ihn jedoch ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn und er sieht sein Leben als Wendepunkt und richtet sich noch einmal völlig neu ein.
Der Roman handelt von der Freiheit, unser Leben zu gestalten, und von der Freiheit, die uns dabei die Literatur verspricht.
Die angenehme Stimme des Sprechers Markus Hoffmann verleiht in der Hörbuchfassung des Romans von Autor Pascal Mercier der Geschichte auf eindrucksvolle Weise Leben und reinen Hörgenuss. Man bemerkt die Leidenschaft für das literarische Erzählen. Dieses Hörbuch ist in gekonnter Manier vorgetragen und wird sicher ebenso wie der geschriebene Roman ein Besteller.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Und plötzlich ist nicht nur der Körper gelähmt, sondern auch die Stimme ist weg. Er kann die Worte nicht mehr sagen, die doch sein Leben bedeuten. Der Engländer Simon Leyland kommt in Triest in die Klinik, doch die Hoffnung, dass der Anfall nur eine Migraine accompagnée …
Mehr
Und plötzlich ist nicht nur der Körper gelähmt, sondern auch die Stimme ist weg. Er kann die Worte nicht mehr sagen, die doch sein Leben bedeuten. Der Engländer Simon Leyland kommt in Triest in die Klinik, doch die Hoffnung, dass der Anfall nur eine Migraine accompagnée sei, wird durch den untrüglichen Blick des Arztes zunichtegemacht. Da ist etwas in seinem Kopf, dass da nicht hingehört und mehr als ein paar Monate werden dem Verleger und Übersetzer nicht mehr bleiben. Er erinnert sich zurück an die Zeit mit seiner Frau Livia, als sie mit den Kindern in London wohnten, dann nach dem Tod von Livias Vater und der Übernahme seines Verlages nach Triest kamen, einer seiner Sehnsuchtsstädte, denn als Junge schon stand Simon vor einer Karte und beschloss, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden und nun sollte er direkt an dieses ziehen. Mit der Diagnose jedoch geht das Leben, wie er es kannte zu Ende. Womöglich jedoch ist da aber noch ein Fünkchen Hoffnung darauf, dass er eine Chance auf ein zweites bekommt und jemand zu ihm sagt „Welcome home, Sir!“.
Pascal Mercier, schriftstellerisches Pseudonym des Schweizer Philosophen Peter Bieri, ist ein Virtuose im Umgang mit Worten. Sein aktueller Roman ist eine Hommage an alle Liebhaber der Literatur und Linguistik, denn im Zentrum der Gedanken seines Protagonisten stehen die Worte mit ihren Bedeutungen, Konnotationen und den Emotionen, die sie auslösen, sowie die Frage, ob man den Gedanken einer Sprache adäquat auch in einer anderen wiedergeben kann und wo sich letztlich die Grenze der Sprache befindet. Es ist eine Reise durch die Literatur und die Sprachen des Mittelmeerraums, die eingebunden ist in eine Handlung voller Schmerz, Trauer und Hoffnung gleichermaßen.
Man kann den Inhalt kaum angemessen zusammenfassen, einerseits ob der Fülle der Gedankengänge, die sich um die perfekte Übersetzung und den vollkommenen Ausdruck drehen, andererseits ohne einen wesentlichen Aspekt der Handlung vorwegzunehmen, der für Leyland essentiell werden wird. Es gibt ein Vorher, vor dem Anfall, als sein Leben geprägt ist durch Jagd nach Worten und von Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, denen allerlei fremde Worte eigen sind und die sie mit ihm teilen. Es gibt aber auch ein Danach, als plötzlich die Menschen viel mehr in seinen Blick geraten und aller Fatalität zum Trotz immer ein Neubeginn möglich scheint.
Den knapp 600 Seiten langen Roman liest Markus Hoffmann in über 22 Stunden mit einer leisen und prononcierten Stimme, die hervorragend als Erzählstimme von Simon Leyland gewählt ist. So gerne man ihm zuhört, liegen hier aber für mich auch die einzigen beiden Kritikpunkte: ich hätte mir gewünscht, dass seine fremdsprachigen Einwürfe ebenso flüssig klingen wie die deutsche Stimme, aber leider wirken sein Englisch wie auch sein Italienisch oder das portugiesische Vorwort sehr angestrengt und bemüht. So sehr mich der Roman begeisterte und ich den mäandernden Überlegungen Leylands folgte, so ist das Hörbuch doch etwas zu lange und irgendwann wünscht man sich doch ein etwas zielgerichteteres Erzählen ohne die zahlreichen Wiederholungen bereits geschilderter Episoden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für