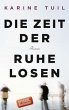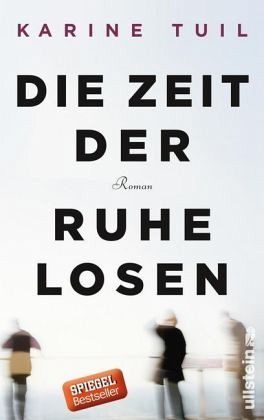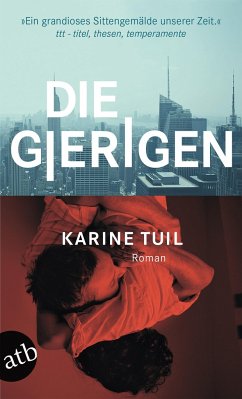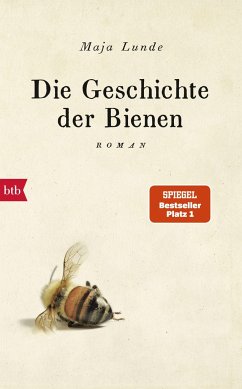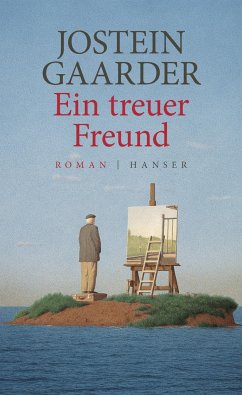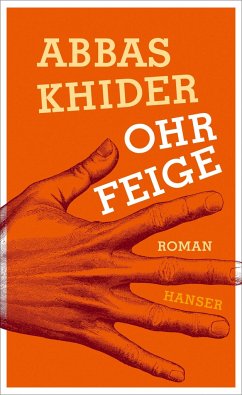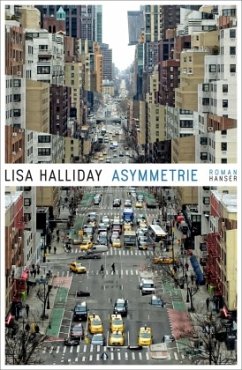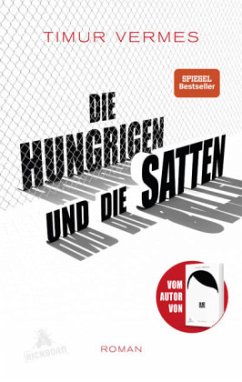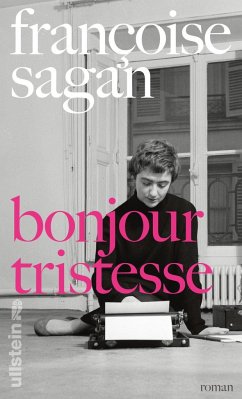Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Furios erzählt Karine Tuil von Menschen, die getrieben sind von dem Wunsch nach Anerkennung, Geld und Macht - und beinah tragisch daran scheitern. Ein grandioses Gesellschaftspanorama unserer Zeit, aus der Feder einer der wichtigsten französischen Autorinnen der Gegenwart, nominiert für den Prix Goncourt.Der Aufstieg des brillanten Managers François Vély scheint unaufhaltsam. Bis seine Exfrau sich aus dem Fenster stürzt, als sie erfährt, dass er wieder heiraten will. Der Tragödie folgt die Entdeckung, dass seine neue Lebensgefährtin in eine Affäre mit einem Offizier verstrickt ist, d...
Furios erzählt Karine Tuil von Menschen, die getrieben sind von dem Wunsch nach Anerkennung, Geld und Macht - und beinah tragisch daran scheitern. Ein grandioses Gesellschaftspanorama unserer Zeit, aus der Feder einer der wichtigsten französischen Autorinnen der Gegenwart, nominiert für den Prix Goncourt.
Der Aufstieg des brillanten Managers François Vély scheint unaufhaltsam. Bis seine Exfrau sich aus dem Fenster stürzt, als sie erfährt, dass er wieder heiraten will. Der Tragödie folgt die Entdeckung, dass seine neue Lebensgefährtin in eine Affäre mit einem Offizier verstrickt ist, der völlig traumatisiert aus Afghanistan heimkehrt. Außerdem wird Vély ein Mediencoup zum Verhängnis, man bezichtigt ihn des Rassismus und Sexismus. Als er persönlich und beruflich am Ende ist, ergreift ausgerechnet der Politiker Osman Diboula Partei für ihn - dabei ist Diboula bekannt als Wortführer gegen eine weiße gesellschaftliche Elite. Wenige Wochen später kommt es im Irak zu einer Begegnung aller Beteiligten, die für Vély fatale Konsequenzen hat.
Der Aufstieg des brillanten Managers François Vély scheint unaufhaltsam. Bis seine Exfrau sich aus dem Fenster stürzt, als sie erfährt, dass er wieder heiraten will. Der Tragödie folgt die Entdeckung, dass seine neue Lebensgefährtin in eine Affäre mit einem Offizier verstrickt ist, der völlig traumatisiert aus Afghanistan heimkehrt. Außerdem wird Vély ein Mediencoup zum Verhängnis, man bezichtigt ihn des Rassismus und Sexismus. Als er persönlich und beruflich am Ende ist, ergreift ausgerechnet der Politiker Osman Diboula Partei für ihn - dabei ist Diboula bekannt als Wortführer gegen eine weiße gesellschaftliche Elite. Wenige Wochen später kommt es im Irak zu einer Begegnung aller Beteiligten, die für Vély fatale Konsequenzen hat.
Tuil, Karine
Karine Tuil, geboren 1972, Juristin und Autorin mehrerer gefeierter Bücher, darunter der Roman "Die Gierigen". Zuletzt erschien ihr vielbeachteter Roman "Die Zeit der Ruhelosen", der in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Karine Tuil lebt mit ihrer Familie in Paris.
Karine Tuil, geboren 1972, Juristin und Autorin mehrerer gefeierter Bücher, darunter der Roman "Die Gierigen". Zuletzt erschien ihr vielbeachteter Roman "Die Zeit der Ruhelosen", der in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Karine Tuil lebt mit ihrer Familie in Paris.
Produktdetails
- Verlag: Ullstein HC
- Seitenzahl: 512
- Erscheinungstermin: 6. März 2017
- Deutsch
- Abmessung: 221mm x 150mm x 45mm
- Gewicht: 697g
- ISBN-13: 9783550081750
- ISBN-10: 3550081758
- Artikelnr.: 47072156
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.03.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.03.2017Alle Prosa ist Protest
Warum der Roman nur als Gesellschaftsporträt eine Gegenwart und eine Zukunft hat: Über Karine Tuil und ihr Buch "Die Zeit der Ruhelosen"
Als neulich in einem kleinen Restaurant in der Rue Mazarine in Paris die Literaturwissenschaftlerin Agathe Novak-Lechevalier das Erscheinen des Bandes feierte, den sie in Frankreich gerade über Michel Houellebecq herausgegeben hat, war zwischen den Freunden und Weggefährten des Autors auch Houellebecq selbst. Sie rief ihn zu sich nach vorne und erzählte, wie sie ihm, ohne ihn zu kennen, einen Brief geschrieben hatte und an ihn mit dem Wunsch herangetreten war, über das neunzehnte Jahrhundert zu reden. Er hatte zugesagt, sie hatten sich getroffen und
Warum der Roman nur als Gesellschaftsporträt eine Gegenwart und eine Zukunft hat: Über Karine Tuil und ihr Buch "Die Zeit der Ruhelosen"
Als neulich in einem kleinen Restaurant in der Rue Mazarine in Paris die Literaturwissenschaftlerin Agathe Novak-Lechevalier das Erscheinen des Bandes feierte, den sie in Frankreich gerade über Michel Houellebecq herausgegeben hat, war zwischen den Freunden und Weggefährten des Autors auch Houellebecq selbst. Sie rief ihn zu sich nach vorne und erzählte, wie sie ihm, ohne ihn zu kennen, einen Brief geschrieben hatte und an ihn mit dem Wunsch herangetreten war, über das neunzehnte Jahrhundert zu reden. Er hatte zugesagt, sie hatten sich getroffen und
Mehr anzeigen
tatsächlich stundenlang über das neunzehnte Jahrhundert gesprochen. Denn im neunzehnten Jahrhundert, das sagte Houellebecq an diesem Abend gerne noch mal, war der Roman in Frankreich sozusagen geboren worden. Nach der Revolution hatten die Schriftsteller zum ersten Mal begriffen, dass die Gesellschaft etwas war, das sich wandelt. Vorher, in der Tragödie und Komödie, war es um die ewigen Dinge gegangen. Balzac dagegen beschrieb die Gesellschaft so, wie sie sich unter den eigenen Augen veränderte. Und weil die Gesellschaft sich noch immer verändere, so Houellebecq, könne die Mission von Romanautoren weiter dieselbe sein.
Er selbst ist der Beweis. Mit seinen Strategien der Verunsicherung und der Analyse der Gegenwartsgesellschaft über den Umweg in die Zukunft versteht Michel Houellebecq es wie kein anderer, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch schreiben in Frankreich auch andere Autoren Gesellschaftsromane, und zwar so gute, dass man, jedenfalls für eine Weile, überhaupt keine Ich-Romane oder biographischen Berichte mehr lesen will, weil diese ein Panorama der Gesellschaft, wie wir es dringend brauchen, gar nicht bieten können. Wenn einen das instabile und fragile soziale Gefüge umtreibt, wenn man es verstehen und analysieren will, kommt es auf die Multiperspektivität genau solcher Panoramen an.
Kann Literatur noch oder überhaupt oder wieder politisch sein, wird gerne gefragt. Dabei erübrigen sich diese Fragen ja, wenn es um Gesellschaftsromane geht. Denn in der Art und Weise, wie sie die verschiedensten Stimmen zu Wort kommen lassen, wie sie einander widerstrebende Bewegungen innerhalb der Gesellschaft miteinander in Beziehung setzen und vereinfachende ideologische Botschaften bekämpfen, sind sie an sich politisch. Der Gesellschaftsroman war auf seine Weise immer politisch und hat nie aufgehört, es zu sein.
Die 44-jährige Pariser Schriftstellerin Karine Tuil entwirft jetzt ein solches politisches Panorama in ihrem Roman "Die Zeit der Ruhelosen", weshalb man ihr Buch, kurz vor den Präsidentschaftswahlen mit dem schillernden Kandidaten Macron, dem von Skandalen zerrütteten Fillon, einem von der eigenen Partei im Stich gelassenen Hamon und der Drohung, die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen könne am Ende womöglich an die Macht kommen, beinahe gierig in die Hände nimmt. Macron, Fillon, Hamon, Marine Le Pen und die Wahlen - sie kommen in "Die Zeit der Ruhelosen" nicht vor, doch gibt es Anspielungen auf real existierende Figuren in Politik und Medien, die das Ganze im Jetzt verorten.
Nur heißt das nicht, dass der Roman ausschließlich in Frankreichs politischer Klasse spielt. Karine Tuil geht mit vier fiktionalen Hauptfiguren ins Rennen, von denen drei in der Sphäre der Politik, der Medien und der Wirtschaft zu Hause sind oder gerne zu Hause wären. Es ist der 51-jährige Chef eines der größten Mobilfunkunternehmens, François Vély, zehntreichster Mann Frankreichs, der eine Weile lang Anbieter für Online-Sexdienste und Peepshows gekauft und im Internet Websites mit Pornovideos aufgebaut hatte, um dann wieder ins Telekommunikationsgeschäft einzusteigen und, in der Hoffnung auf Prestigegewinn, Teilhaber einer der größten Tageszeitungen geworden war. Es ist seine neue Freundin, die Journalistin und Schriftstellerin Marion Decker, Ende zwanzig, die an einer Reportage über traumatisierte Soldaten in Auslandseinsätzen arbeitet und ihrerseits traumatisiert ist: Als Vély seine Exfrau um ihr Einverständnis gebeten hatte, die junge neue Freundin heiraten zu dürfen, war die Frau aus dem Fenster gesprungen. Die Kinder aus erster Ehe hat das Paar seither gegen sich, insbesondere den Sohn, der als Reaktion auf den Tod der Mutter ein neues Leben als orthodoxer Jude führt.
Und es ist Osman Diboula, ein schwarzer Politiker, im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois groß geworden, der dort zunächst als Sozialarbeiter arbeitete, bis es ihm gelang, ohne den klassischen Ausbildungsweg, ohne Eliteuniversität und Diplom, aber mit unbändigem Ehrgeiz einen Posten im Beraterstab des französischen Präsidenten zu bekommen.
Dass das Spektrum auf diese Weise größer ist als das jener kleinen Gruppe Bürgerlich-Intellektueller, die in Paris zwischen Élysée-Palast und dem "Café de Flore" zu Hause sind, einer Gruppe, die einem in der französischen Literatur der Gegenwart ja immer überrepräsentiert vorkommt, ist damit von der ersten Seite an klar. Für Karine Tuil, die aus einer tunesisch-jüdischen Familie stammt und als Einwandererkind in der Banlieue aufgewachsen ist, ist diese Banlieue nicht weniger wichtig, als es die Salons der politischen Klasse im Zentrum von Paris sind. Und nicht zufällig handelt es sich bei der Banlieue im Roman um Clichy-sous-Bois, um jenen Vorort also, von dem vor zwölf Jahren die Unruhen in den Vorstädten ausgingen, als im Oktober 2005 zwei junge Menschen starben, die vor der Polizei Zuflucht in einem Transformatorenhäuschen gesucht hatten. Clichy steht seither für alle Probleme, die die soziale Situation in den französischen Banlieues betreffen.
Tuil gelingt nun ein Kunststück. Sie führt eine vierte Figur ein, einen im Auslandseinsatz in Afghanistan traumatisierten französischen Soldaten, und schafft damit den notwendigen Kitt, der in ihrem Gesellschaftsroman alles zusammenhält. Romain Roller heißt dieser Soldat, auch er war einmal ein Kind aus Clichy-sous-Bois, Teil einer Gang von vier Freunden, von denen drei zur Armee gingen, der vierte die Aufnahmeprüfung aber nicht schaffte, sich mit Rap-Texten von Mafia K'1 Fry zudröhnte und, als die anderen weg waren, zum radikalen Islamisten entwickelte. Als Roller beim Einsatz in einen Hinterhalt gerät, kommt einer der Freunde ums Leben, der andere wird verstümmelt. Er kommt nicht damit zurecht, dass er sie nicht hat schützen können. Die für ihre Reportage recherchierende Journalistin Marion Decker beginnt, sich für den Traumatisierten zu interessieren, sie verlieben sich ineinander, und François Vély wird zu Rollers Gegenspieler.
Sie habe erst einen Roman schreiben wollen, der das moralische und mentale Leid eines Soldaten in den Mittelpunkt rückt, hat Karine Tuil in Interviews gesagt. Im Sommer 2008 gerieten einige französische Soldaten im Uzbin-Tal in einen Hinterhalt der Taliban und kamen dabei ums Leben. Dieser Zwischenfall habe sie sehr beschäftigt. Die Franzosen machten gerade alle Urlaub, während in Afghanistan, im Namen des Kampfes gegen den islamischen Terrorismus, junge Männer um die zwanzig an der Front ihr Leben ließen.
Doch beschäftigte sie glücklicherweise zugleich noch so vieles andere, was sie davon abhielt, sich auf die Fallgeschichte zu beschränken. Roller ist im Roman eine starke Figur - nicht weil er im Mittelpunkt stünde, sondern weil Tuil ihn so facettenreich anlegt, dass die Verbindungen zu den anderen Figuren an keiner Stelle konstruiert wirken. Nicht einmal als klar wird, dass der ehrgeizige Politiker Osman Diboula der für die vier Freunde um Roller zuständige Sozialarbeiter in Clichy-sous-Bois gewesen war, zu dem sie während all der Jahre Kontakt hielten, denkt man beim Lesen: "So ein Zufall, dass die sich jetzt auch alle von früher kennen . . .!" Dazu ist das Netz der Figuren bei Karine Tuil viel zu elegant angelegt.
Alles hängt mit allem zusammen und steht gleichzeitig völlig unversöhnlich da. Das macht die beklemmende und immerzu dunkle Stimmung in diesem Roman aus, der alle Figuren zusammen in den Abgrund schickt. Karine Tuil leuchtet die sozialen Verhältnisse aus. Doch ist ihr Licht niemals schmeichelhaft. An keiner Stelle. Sie registriert Konfliktlinien und beschreibt, wie, sobald Konflikte an einer Stelle gelöst werden, im selben Moment an anderer Stelle welche neu aufbrechen. Eine Kaskadenbewegung - unaufhaltsam und beunruhigend.
"Wie kann man sich in einer Gesellschaft verwirklichen, die so verdorben ist durch identitäre Streitereien, durch Rassismus und Antisemitismus? Und welchen Preis muss man dafür bezahlen?", fragt sie. Um Dichotomien geht es ihr dabei nicht. Es gibt nicht die Abgehängten aus Clichy-sous-Bois auf der einen Seite und die Gewinner der bürgerlichen Klasse auf der anderen. Es gibt in den gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhängen nur Menschen, denen es nicht möglich ist, sich in einer, um es mit Houellebecq zu sagen, immer stärker ausweitenden Kampfzone nicht schuldig zu machen.
Der Gesellschaftsroman, sagt Karine Tuil, sei nicht wichtiger geworden als früher. Er sei immer schon wichtig gewesen. "Aber wir erleben gerade heftige Zeiten, die uns vor besondere moralische und eben auch schriftstellerische Herausforderungen stellen. Ich könnte heute keinen nur persönlichen oder rein fiktionalen Text schreiben. Die Fiktion hilft mir, die Realität zu begreifen, und ich arbeite zunehmend dokumentarisch, meine Stoffe nähren sich von tatsächlichen Gegebenheiten. Allerdings läuft diese Konfrontation mit der Realität nicht ohne Reibungsverluste ab."
Mario Vargas Llosa habe in "Die Wahrheit der Lügen" gesagt, dass "im Herzen jeder Fiktion ein Protest" glühe. Und genau das sei ihr neuer Roman: "Ein Protest gegen die Welt, in der wir leben und in der jede Bewegung vom Ende der Unschuld zu künden scheint."
In "Die Zeit der Ruhelosen" schreibt die Journalistin und Schriftstellerin Marion Decker am Ende weder eine Reportage noch einen neuen Roman. Sie ist mit Roller in den Bergen und hat Jorge Semprúns "Schreiben oder Leben" im Gepäck. Für Karine Tuil ist Schreiben oder Leben zum Glück keine Frage des Entweder-oder. Sie hat eins der besten und spannendsten Bücher dieses Frühjahrs geschrieben.
JULIA ENCKE
Karine Tuil: "Die Zeit der Ruhelosen". Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff. Ullstein, 512 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Er selbst ist der Beweis. Mit seinen Strategien der Verunsicherung und der Analyse der Gegenwartsgesellschaft über den Umweg in die Zukunft versteht Michel Houellebecq es wie kein anderer, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch schreiben in Frankreich auch andere Autoren Gesellschaftsromane, und zwar so gute, dass man, jedenfalls für eine Weile, überhaupt keine Ich-Romane oder biographischen Berichte mehr lesen will, weil diese ein Panorama der Gesellschaft, wie wir es dringend brauchen, gar nicht bieten können. Wenn einen das instabile und fragile soziale Gefüge umtreibt, wenn man es verstehen und analysieren will, kommt es auf die Multiperspektivität genau solcher Panoramen an.
Kann Literatur noch oder überhaupt oder wieder politisch sein, wird gerne gefragt. Dabei erübrigen sich diese Fragen ja, wenn es um Gesellschaftsromane geht. Denn in der Art und Weise, wie sie die verschiedensten Stimmen zu Wort kommen lassen, wie sie einander widerstrebende Bewegungen innerhalb der Gesellschaft miteinander in Beziehung setzen und vereinfachende ideologische Botschaften bekämpfen, sind sie an sich politisch. Der Gesellschaftsroman war auf seine Weise immer politisch und hat nie aufgehört, es zu sein.
Die 44-jährige Pariser Schriftstellerin Karine Tuil entwirft jetzt ein solches politisches Panorama in ihrem Roman "Die Zeit der Ruhelosen", weshalb man ihr Buch, kurz vor den Präsidentschaftswahlen mit dem schillernden Kandidaten Macron, dem von Skandalen zerrütteten Fillon, einem von der eigenen Partei im Stich gelassenen Hamon und der Drohung, die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen könne am Ende womöglich an die Macht kommen, beinahe gierig in die Hände nimmt. Macron, Fillon, Hamon, Marine Le Pen und die Wahlen - sie kommen in "Die Zeit der Ruhelosen" nicht vor, doch gibt es Anspielungen auf real existierende Figuren in Politik und Medien, die das Ganze im Jetzt verorten.
Nur heißt das nicht, dass der Roman ausschließlich in Frankreichs politischer Klasse spielt. Karine Tuil geht mit vier fiktionalen Hauptfiguren ins Rennen, von denen drei in der Sphäre der Politik, der Medien und der Wirtschaft zu Hause sind oder gerne zu Hause wären. Es ist der 51-jährige Chef eines der größten Mobilfunkunternehmens, François Vély, zehntreichster Mann Frankreichs, der eine Weile lang Anbieter für Online-Sexdienste und Peepshows gekauft und im Internet Websites mit Pornovideos aufgebaut hatte, um dann wieder ins Telekommunikationsgeschäft einzusteigen und, in der Hoffnung auf Prestigegewinn, Teilhaber einer der größten Tageszeitungen geworden war. Es ist seine neue Freundin, die Journalistin und Schriftstellerin Marion Decker, Ende zwanzig, die an einer Reportage über traumatisierte Soldaten in Auslandseinsätzen arbeitet und ihrerseits traumatisiert ist: Als Vély seine Exfrau um ihr Einverständnis gebeten hatte, die junge neue Freundin heiraten zu dürfen, war die Frau aus dem Fenster gesprungen. Die Kinder aus erster Ehe hat das Paar seither gegen sich, insbesondere den Sohn, der als Reaktion auf den Tod der Mutter ein neues Leben als orthodoxer Jude führt.
Und es ist Osman Diboula, ein schwarzer Politiker, im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois groß geworden, der dort zunächst als Sozialarbeiter arbeitete, bis es ihm gelang, ohne den klassischen Ausbildungsweg, ohne Eliteuniversität und Diplom, aber mit unbändigem Ehrgeiz einen Posten im Beraterstab des französischen Präsidenten zu bekommen.
Dass das Spektrum auf diese Weise größer ist als das jener kleinen Gruppe Bürgerlich-Intellektueller, die in Paris zwischen Élysée-Palast und dem "Café de Flore" zu Hause sind, einer Gruppe, die einem in der französischen Literatur der Gegenwart ja immer überrepräsentiert vorkommt, ist damit von der ersten Seite an klar. Für Karine Tuil, die aus einer tunesisch-jüdischen Familie stammt und als Einwandererkind in der Banlieue aufgewachsen ist, ist diese Banlieue nicht weniger wichtig, als es die Salons der politischen Klasse im Zentrum von Paris sind. Und nicht zufällig handelt es sich bei der Banlieue im Roman um Clichy-sous-Bois, um jenen Vorort also, von dem vor zwölf Jahren die Unruhen in den Vorstädten ausgingen, als im Oktober 2005 zwei junge Menschen starben, die vor der Polizei Zuflucht in einem Transformatorenhäuschen gesucht hatten. Clichy steht seither für alle Probleme, die die soziale Situation in den französischen Banlieues betreffen.
Tuil gelingt nun ein Kunststück. Sie führt eine vierte Figur ein, einen im Auslandseinsatz in Afghanistan traumatisierten französischen Soldaten, und schafft damit den notwendigen Kitt, der in ihrem Gesellschaftsroman alles zusammenhält. Romain Roller heißt dieser Soldat, auch er war einmal ein Kind aus Clichy-sous-Bois, Teil einer Gang von vier Freunden, von denen drei zur Armee gingen, der vierte die Aufnahmeprüfung aber nicht schaffte, sich mit Rap-Texten von Mafia K'1 Fry zudröhnte und, als die anderen weg waren, zum radikalen Islamisten entwickelte. Als Roller beim Einsatz in einen Hinterhalt gerät, kommt einer der Freunde ums Leben, der andere wird verstümmelt. Er kommt nicht damit zurecht, dass er sie nicht hat schützen können. Die für ihre Reportage recherchierende Journalistin Marion Decker beginnt, sich für den Traumatisierten zu interessieren, sie verlieben sich ineinander, und François Vély wird zu Rollers Gegenspieler.
Sie habe erst einen Roman schreiben wollen, der das moralische und mentale Leid eines Soldaten in den Mittelpunkt rückt, hat Karine Tuil in Interviews gesagt. Im Sommer 2008 gerieten einige französische Soldaten im Uzbin-Tal in einen Hinterhalt der Taliban und kamen dabei ums Leben. Dieser Zwischenfall habe sie sehr beschäftigt. Die Franzosen machten gerade alle Urlaub, während in Afghanistan, im Namen des Kampfes gegen den islamischen Terrorismus, junge Männer um die zwanzig an der Front ihr Leben ließen.
Doch beschäftigte sie glücklicherweise zugleich noch so vieles andere, was sie davon abhielt, sich auf die Fallgeschichte zu beschränken. Roller ist im Roman eine starke Figur - nicht weil er im Mittelpunkt stünde, sondern weil Tuil ihn so facettenreich anlegt, dass die Verbindungen zu den anderen Figuren an keiner Stelle konstruiert wirken. Nicht einmal als klar wird, dass der ehrgeizige Politiker Osman Diboula der für die vier Freunde um Roller zuständige Sozialarbeiter in Clichy-sous-Bois gewesen war, zu dem sie während all der Jahre Kontakt hielten, denkt man beim Lesen: "So ein Zufall, dass die sich jetzt auch alle von früher kennen . . .!" Dazu ist das Netz der Figuren bei Karine Tuil viel zu elegant angelegt.
Alles hängt mit allem zusammen und steht gleichzeitig völlig unversöhnlich da. Das macht die beklemmende und immerzu dunkle Stimmung in diesem Roman aus, der alle Figuren zusammen in den Abgrund schickt. Karine Tuil leuchtet die sozialen Verhältnisse aus. Doch ist ihr Licht niemals schmeichelhaft. An keiner Stelle. Sie registriert Konfliktlinien und beschreibt, wie, sobald Konflikte an einer Stelle gelöst werden, im selben Moment an anderer Stelle welche neu aufbrechen. Eine Kaskadenbewegung - unaufhaltsam und beunruhigend.
"Wie kann man sich in einer Gesellschaft verwirklichen, die so verdorben ist durch identitäre Streitereien, durch Rassismus und Antisemitismus? Und welchen Preis muss man dafür bezahlen?", fragt sie. Um Dichotomien geht es ihr dabei nicht. Es gibt nicht die Abgehängten aus Clichy-sous-Bois auf der einen Seite und die Gewinner der bürgerlichen Klasse auf der anderen. Es gibt in den gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhängen nur Menschen, denen es nicht möglich ist, sich in einer, um es mit Houellebecq zu sagen, immer stärker ausweitenden Kampfzone nicht schuldig zu machen.
Der Gesellschaftsroman, sagt Karine Tuil, sei nicht wichtiger geworden als früher. Er sei immer schon wichtig gewesen. "Aber wir erleben gerade heftige Zeiten, die uns vor besondere moralische und eben auch schriftstellerische Herausforderungen stellen. Ich könnte heute keinen nur persönlichen oder rein fiktionalen Text schreiben. Die Fiktion hilft mir, die Realität zu begreifen, und ich arbeite zunehmend dokumentarisch, meine Stoffe nähren sich von tatsächlichen Gegebenheiten. Allerdings läuft diese Konfrontation mit der Realität nicht ohne Reibungsverluste ab."
Mario Vargas Llosa habe in "Die Wahrheit der Lügen" gesagt, dass "im Herzen jeder Fiktion ein Protest" glühe. Und genau das sei ihr neuer Roman: "Ein Protest gegen die Welt, in der wir leben und in der jede Bewegung vom Ende der Unschuld zu künden scheint."
In "Die Zeit der Ruhelosen" schreibt die Journalistin und Schriftstellerin Marion Decker am Ende weder eine Reportage noch einen neuen Roman. Sie ist mit Roller in den Bergen und hat Jorge Semprúns "Schreiben oder Leben" im Gepäck. Für Karine Tuil ist Schreiben oder Leben zum Glück keine Frage des Entweder-oder. Sie hat eins der besten und spannendsten Bücher dieses Frühjahrs geschrieben.
JULIA ENCKE
Karine Tuil: "Die Zeit der Ruhelosen". Aus dem Französischen von Maja Ueberle-Pfaff. Ullstein, 512 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Sie hat eins der besten und spannendsten Bücher dieses Frühjahrs geschrieben." Julia Encke Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20170319
Eine anspruchsvolle Lektüre über die überraschende Wendungen im Leben. Es wird die Geschichte dreier Männer erzählt, deren Lebensgeschichten sich im Laufe des Buches in irgendeiner Art und Weise zusammenfügen, obwohl sie anfangs wenig miteinander gemein haben. Roman …
Mehr
Eine anspruchsvolle Lektüre über die überraschende Wendungen im Leben. Es wird die Geschichte dreier Männer erzählt, deren Lebensgeschichten sich im Laufe des Buches in irgendeiner Art und Weise zusammenfügen, obwohl sie anfangs wenig miteinander gemein haben. Roman Rollar kehrt nach einem Militäreinsatz mit phyhischem Trauma zurück und kann sich nur schwer im sozialen Leben wieder einfinden. Osman Diboula, ein farbiger Politiker, ist soweit erfolgreich, seiner dunklen Hautfarbe aber wegen stösst er auf gewisse Barrieren, die in Endeffekt auch seine Ehe zerstören.
Und Marion Vély, reich erzogen, ein Jude, der dies zu verleugnen versucht und erfolgreicher Unternehmer. Er verliebt sich in eine Frau, die ihn aber im Laufe des Buches verachtet, und welche eine Vergangenheit mit Roman hatte. Dies ist nur der Gipfel seines Unglücks, denn es folgen viele Weitere und seine Leben wird ruiniert, sei es durch den Tod seiner Ex-Frau oder einer Kampagne gegen ihn, die seinem Ruf unmittelbar schadet.
Gleichzeitig ist das Buch mit vielen Ereignissen bereichert, die es und die problematische Atmosphäre perfekt ergänzen, wie der Sturz der Twin Towers in New York, der Krieg in Afganistan und im Irak, sowie die Schwierigkeiten die jeder von ihnen in verschiedenen Lebensphasen gegenübertreten muss.
Als sie sich später unter bestimmten Verhältnissen in den Irak gegenübertreten, kommt es zu einem wichtigen Wendepunkt.
Ein Buch, das man nicht so leicht aus der Hand legen kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Drei Männer, drei Schicksale. Romain Roller kehrt mit seinem Team aus Afghanistan zurück. Sie sind in einen Hinterhalt geraten und er konnte seine Männer nicht beschützen. Der Stress des Auslandseinsatzes, die permanente Gefahr und die Selbstvorwürfe werfen den jungen Vater …
Mehr
Drei Männer, drei Schicksale. Romain Roller kehrt mit seinem Team aus Afghanistan zurück. Sie sind in einen Hinterhalt geraten und er konnte seine Männer nicht beschützen. Der Stress des Auslandseinsatzes, die permanente Gefahr und die Selbstvorwürfe werfen den jungen Vater völlig aus der Bahn. Eine Rückkehr in das alte Leben schein unmöglich. Sicher fühlt er sich nur bei der Journalistin Marion Decker, mit der er ein Verhältnis anfängt. Diese ist an einer Beziehung mit ihm jedoch nicht wirklich interessiert, steckt ihr Mann gerade im größten Skandal seines Lebens. Der erfolgreiche Manager François Vély will in den kleinen Kreis der Großen und Mächtigen vordringen, doch nach einem Interview steht der Vorwurf von Rassismus im Raum, dem er kaum etwas entgegensetzen kann. Seine jüdische Herkunft, die er eigentlich erfolgreich verdrängt hatte, rückt zunehmend in den Fokus der Medien, die nach weiteren Skandalen gieren. Genauso am Ende scheint Osman Diboula. Einst Lieblingsschüler des Präsidenten, der junge Mann aus der Banlieue, der so schön die Toleranz der hohen Politiker demonstrieren konnte, ist in Ungnade gefallen und wird aus dem Elysée gedrängt. Ein brillanter Coup soll ihn zurück an die Spitze katapultieren: er ergreift öffentlich Partei für Vély und steht plötzlich im Zentrum des Interesses. Die Wege der drei Männer am Scheideweg ihres Lebens kreuzen und verflechten sich zunehmend und sie rasen unaufhörlich auf den großen Knall zu.
Karine Tuils neuer Roman greift gleich mehrere aktuelle politische Themen auf und verarbeitet diese gelungen literarisch. Das Posttraumatische Stresssyndrom, an dem Romain Roller ganz offenkundig leidet, wird hierbei sehr greifbar dargestellt. Die Regierung scheint zu glauben, dass drei Tage im Luxushotel den Soldaten reichen, um sich wieder zu akklimatisieren und in die Normalität zurückzukehren. Dass diese unfähig sind, jemals wieder normal in die Gesellschaft einzugliedern, wird am Beispiel Romains besonders deutlich. Wer den Krieg nicht erlebt hat, kann kaum nachvollziehen, was ihn bewegt und warum er nicht einfach zu Frau und Kind ins traute Heim zurückgehen und tun kann, als wäre nichts gewesen. Die Flucht wieder in den Krieg scheint die einzige logische Konsequenz.
Das Paar Osman Diboula und seine Freundin und spätere Ehefrau sind symptomatisch für die französische Gesellschaft mit ihren abgeschotteten Eliten. Ein Vordringen ins Zentrum der Macht ist an den richtigen Background und die richtigen Schulen geknüpft. Fremde will man da nicht, einzelne als Vorzeigebeispiel für die ach so hohe Toleranz werden genauso schnell fallengelassen wie sie aufsteigen konnten.
Zuletzt Vély, der den rasanten Absturz eines Wirtschaftsbosses repräsentiert. Die Medien und ihre unermüdliche Suche nach verwertbarem Material für ihre Gazetten sind ein wichtiger Machtfaktor, der auch die ganz Großen zu Fall bringen kann. Für mich eine traurige Figur, verfügt er doch nicht über Mittel, sein Privat- oder Berufsleben selbstständig wieder auf die Reihe zu bringen. Dass er am Ende auch noch für etwas bezahlen muss, dass er nie war – geradezu klassisch tragisch.
Ein Roman mit vielen Facetten und Denkanstößen, der geschickt und glaubwürdig konstruiert ist, indem er die Figuren immer wieder zusammenführt und sie doch keine Gemeinschaft bilden lässt, obwohl die drei Männer gleichsam tief in der Krise stecken. Messerscharfe Beobachtungen Frankreichs und der französischen Gesellschaft prägen die Erzählung. Die Figuren sind fast Karikaturen ihrer gesellschaftlichen Funktion, können aber so umso drastischer die Verfehlungen repräsentieren und umso deutlicher machen, wie Leichtsinnigkeit (an dieser Stelle ist der französische Titel weitaus passender als der deutsche: „L’Insouciance“) das fragile Gebilde des öffentlichen Ansehens zum Einsturz bringen kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Karine Tuils Roman ist ein emotional dunkles Prosawerk, das mit bewegenden Einzelschicksalen aufwartet.
Inhaltlich geben sich allerhand "ruhelose" Gestalten die Klinke in die Hand. Ob Afghanistan-Veteran mit posttraumatischer Belastungsstörung, egozentrischer Technikmogul mit …
Mehr
Karine Tuils Roman ist ein emotional dunkles Prosawerk, das mit bewegenden Einzelschicksalen aufwartet.
Inhaltlich geben sich allerhand "ruhelose" Gestalten die Klinke in die Hand. Ob Afghanistan-Veteran mit posttraumatischer Belastungsstörung, egozentrischer Technikmogul mit Frauenproblem oder geschasster schwarzer Staatsabgeordneter mit Selbstzweifeln. Paris der Handlungsort spielt dabei nur eine Nebenrolle. Es sind die einzelnen gescheiterten Lebensgeschichten, die im Mittelpunkt der Erzählung stehen und allerhand aktuellen Zündstoff, wie Rassismus, Rechtspopulismus oder Medienhetze, transportieren. Tuils Geschichte zeigt der menschlichen Abgründe viel und driftet dabei erschreckender Weise nie ins Unrealistische ab. Im Gegenteil, plastisch und mit viel Sinn für die menschliche Psyche nähert sich Tuil ihren verzweifelten Charakteren an, die ab einem gewissen Punkt nur noch vom Leben mitgerissen werden und erst spät erkennen, dass eigentlich sie es sind, die Änderungen bewirken können. Löblich ist noch anzumerken, dass die Autorin jeden ihrer Erzählstränge auch zu Ende führt, was heutzutage nicht immer gang und gäbe ist.
FAZIT
Ein erschreckend realistisches Werk, das mit Blick auf die heutige Zeit und Politik nachdenklich stimmt und zeigt, wie eng die Luft in den oberen Sphären der Macht sein kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Soldat Romain Roller kommt aus Afghanistan zurück und bekommt die Bilder und den Schrecken der Krieges nicht mehr aus dem Kopf. Während er in einem Hotel auf Zypern zur Erholung untergebracht ist, fängt er eine verhängnisvolle Affäre mit der Journalistin Marion Decker an. …
Mehr
Soldat Romain Roller kommt aus Afghanistan zurück und bekommt die Bilder und den Schrecken der Krieges nicht mehr aus dem Kopf. Während er in einem Hotel auf Zypern zur Erholung untergebracht ist, fängt er eine verhängnisvolle Affäre mit der Journalistin Marion Decker an. Diese ist die Ehefrau des bekannten Managers Francois Vely, der gerade mit furchtbaren Gerüchten zu kämpfen hat und dabei Unterstützung von unerwarteter Seite erhält... .
Karine Tuil hat hier ein beeindruckendes Buch geschrieben, welches die französische Gegenwart unglaublich echt wirkend und authentisch darstellt. Dabei werden die politische und die gesellschaftliche Situation in den Mittelpunkt gestellt und so auch für Menschen, die nicht in Frankreich leben, anschaulich und greifbar gemacht.
Besonders gefesselt haben mich die Beschreibungen des Krieges aus der Sicht des Soldaten Romain Roller. Fast schon wie ein Bewusstseinsstrom wird aus seiner Perspektive ein realistisches Bild von Afghanistan und der Situation der Menschen und auch der dort stationierten Armee gezeichnet. Es ist wirklich erschreckend zu lesen, was in diesem traumatisierten Mann vorgeht. Umso unglaublicher scheint es mir, dass man im Buch, aber auch in unserer Realität von den Soldaten nach ihrem Kriegseinsatz verlangt, fast ohne Unterbrechung direkt wieder in ihr altes Leben zurückzukehren und alles Erlebte zu vergessen.
Auch die anderen Figuren im Buch wirken alles andere als konstruiert. Jeder hat seine Schwierigkeiten und muss sich über Ungerechtigkeiten hinwegsetzen, was nicht immer gelingt. So ist zum Beispiel Osman Diboula ein gebildeter Mann, der aber aufgrund seiner Herkunft in der Politik eine nur unsichere Stellung hat und deswegen nie den selben Status wie seine Mitstreiter erreichen kann.
Karine Tuil hat einen gut lesbaren und sehr nüchternen Schreibstil. Ohne viel Gefühlsduselei schildert sie die oft schwierige Situation ihrer Figuren und zeichnet so ein Bild der französischen Gesellschaft, welches es in sich hat.
Mir persönlich hat das Buch insgesamt sehr gut gefallen. Allerdings schreibt Frau Tuil mir manchmal zu kühl und sie hätte auch ruhig ein paar mehr positive Aspekte hineinbringen können. Dennoch empfehle das Buch sehr gerne weiter.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Inhalt und meine Meinung:
Karine Tuil wirft in ihrem Roman den Blick auf drei völlig unterschiedliche Menschen und Lebensweisen, die alle miteinander verknüpft sind. Der Manager eines Telekommunikationsunternehmens Francois Vély, der einen rasanten Aufstieg hinter sich hat, …
Mehr
Inhalt und meine Meinung:
Karine Tuil wirft in ihrem Roman den Blick auf drei völlig unterschiedliche Menschen und Lebensweisen, die alle miteinander verknüpft sind. Der Manager eines Telekommunikationsunternehmens Francois Vély, der einen rasanten Aufstieg hinter sich hat, gerät dank eines Mediencoups in eine schier unaufhaltsame Abwärtsspirale. Der Abstieg beginnt schon damit, dass sich seine Exfrau aus dem Fenster stürzt als er ihr eröffnet, dass er wieder heiraten will. Seine neue Frau Marion, die aus schwierigen familiären Verhältnissen stammt, beginnt unterdessen eine Affäre mit dem Offizier Romain Roller, der gerade aus dem Afghanistan-Krieg heimgekehrt ist. Er versucht sein Trauma in den Griff zu bekommen und wieder im Leben Fuß zu fassen und Halt zu finden, dies ist für ihn eine große persönliche Herausforderung. Der Politiker Osman Diboula ist die dritte Hauptfigur im Roman, er stammt aus einem Pariser Problemviertel und war früher Sozialarbeiter. Diboula hat auch den schnellen Aufstieg und Fall selbst erlebt und ergreift in der Debatte um Rassismus und Sexismus ausgerechnet für Francois Vély Partei. Schließlich treffen alle im Irak aufeinander, eine Begegnung die für alle Beteiligten schwerwiegende Konsequenzen haben wird.
Dieses kritische Gesellschaftsdrama von Karine Tuil hat mich von Beginn an sehr gut unterhalten. Ich konnte mich schnell in die Handlung einfinden. Besonders gut hat mir die Aufteilung der Kapitel gefallen, so wusste man als Leser immer sofort, mit welchem Teil des verwobenen Handlungsstranges man es gerade zu tun hatte. Die Autorin beschreibt anschaulich und mit gutem Gespür und Feingefühl die Ereignisse und Hintergründe. Ein Roman über die gesellschaftliche Stellung, Diskriminierung und Rassismus, vom schnellen Aufstieg und genauso schnellen rasanten Fall. Ein kritisch beäugtes, tiefgründig, durchdachtes und gut recherchiertes Drama der Gesellschaft.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ein Elitesoldat, der nach seinem Einsatz in Afghanistan mit sich und der Welt zu kämpfen hat. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, dem der Erfolg zwischen den Händen zu zerrinnen droht. Ein aufstrebender Politiker, der die Fallstricke der eigenen Herkunft nicht sehen will. Eine …
Mehr
Ein Elitesoldat, der nach seinem Einsatz in Afghanistan mit sich und der Welt zu kämpfen hat. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, dem der Erfolg zwischen den Händen zu zerrinnen droht. Ein aufstrebender Politiker, der die Fallstricke der eigenen Herkunft nicht sehen will. Eine Journalistin, die am Puls der Zeit arbeitet und dabei den eigenen Puls nicht mehr zu fühlen scheint. Jeder ist getrieben, von den eigenen Wünschen, dem Druck der Gesellschaft, der Vorgabe „erfolgreich“ zu sein. Von „leben“ war nicht die Rede.
Karine Tuil hat in ihrem mitreißenden Gesellschaftsroman verschiedene brandaktuelle Themen aufgegriffen, die sich trotz ihrer Diversität zu einem großen Ganzen verbinden lassen. Sie streift mit dem Leser durch die Amtszimmer von Paris, lässt Einblicke in das Leben von großen Geschäftsmännern zu und zeigt gleichzeitig das Leben des „kleinen Mannes“, der an vorderster Front gekämpft hat und dafür mit nichts zurück in den normalen Alltag geworfen wird. Ihre Charaktere sind sehr lebendig geraten, vielschichtig und spielen mit so manchen Vorurteilen. Vorurteile, gegen die sie einen ähnlich erfolgreichen Kampf kämpfen wie einst Don Quijote gegen seine berühmten Windmühlen. Tuils Roman ist kein Wohlfühlroman, es werden harte Fakten und unbequeme Wahrheiten auf den Tisch gelegt, erzählt in einem nüchternen Ton, der seinen Teil zu der fast soghaften Wirkung der Geschichte beiträgt. Klug geschrieben, authentisch erzählt und geschickt konstruiert; Die Zeit der Ruhelosen bereitet dem Leser so manchen ruhelosen Moment, gilt es doch viele Denkanstöße zu verarbeiten. Ein Roman, der unterhält und bewegt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ein Spinnennetz
Zum Inhalt:
Drei Männer in Frankreich befinden sich an ihrem persönlichen Scheideweg:
Francois - ein erfolgreicher Manager, begeht einen Fauxpas, der die Inquisition der politischen Korrektheit auf den Plan ruft. Seine Frau Marion hat ein Verhältnis …
Mehr
Ein Spinnennetz
Zum Inhalt:
Drei Männer in Frankreich befinden sich an ihrem persönlichen Scheideweg:
Francois - ein erfolgreicher Manager, begeht einen Fauxpas, der die Inquisition der politischen Korrektheit auf den Plan ruft. Seine Frau Marion hat ein Verhältnis mit
Romain - Afghanistan-Heimkehrer, traumatisiert von den Erlebnissen dort und zu einem normalen Leben in Paris unfähig, immer noch befreundet mit
Osman - ein französischer Farbiger, der es in den Dunstkreis des Präsidenten gebracht hat, nur um dort umso schmerzhafter auf den Boden der Tatsachen zurückzufallen, dass in der Politik keine Freundschaften, sondern Seilschaften zählen. Deshalb bemüht er sich um
Francois - und der Kreis schließt sich.
Mein Eindruck:
Wie ein Spinnennetz hat die Autorin ihre Geschichte gewoben, - so exakt, so fein, so präzise und so tödlich. Ihr Buch teilt sie in vier große Abschnitte, welche ihrerseits Kapitel von zumeist relativ wenigen Seiten enthalten. Diese Kapitel schildern die Sicht einer der drei Hauptpersonen, auch dann, wenn mehrere der Männer in ihnen agieren. So bleibt das Buch immer spannend, immer in Bewegung, selbst, wenn gar nicht so viel passiert.
Ein weiteres Plus ist die Fähigkeit von Tuil, Sympathien für ihre Figuren zu wecken. Egal wie schäbig sich einer der drei verhält, - immer kann man ihn verstehen bzw. steht fassungslos vor der Wucht der Ereignisse, die ihn treffen und hat danach zumindest Mitleid. Die starken Nebencharaktere sind nie nur Staffage, sondern bringen die Geschichte voran, schenken neue Perspektiven und zeigen echte Persönlichkeit – im Guten wie im Schlechten.
Zu guter Letzt sei noch der Schreibstil Tuils gelobt. Sie weiß, die Wörter zu setzen, - ohne zu langweilen, aber auch nicht zu überfordern. So fliegt man förmlich durch die Geschichte und ist trotz der vielen Seiten überrascht, wie schnell sie ihr differenziertes Ende findet.
Mein Fazit:
Großartig! Ohne Wenn und Aber!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die Ruhelosen, Menschen die getrieben sind von Ehrgeiz, Perfektion, Kampfgeist, sind in dem Roman von Karine Tuil der erfolgreiche, von sich überzeugte Geschäftsmann Francois Vely, der nach dem Selbstmordtod seiner Frau inzwischen mit Marion, einer Schriftstellerin verheiratet ist. Sein …
Mehr
Die Ruhelosen, Menschen die getrieben sind von Ehrgeiz, Perfektion, Kampfgeist, sind in dem Roman von Karine Tuil der erfolgreiche, von sich überzeugte Geschäftsmann Francois Vely, der nach dem Selbstmordtod seiner Frau inzwischen mit Marion, einer Schriftstellerin verheiratet ist. Sein Vater Paul trug bei seiner Geburt den Namen Levy, die gesamte Familie wurde von den Nazis umgebracht, nur Paul überlebte. Da ihm die Religion nie wichtig war und er mit einer Katholikin verheiratet war wurde Francois im christlichen Glauben erzogen. Doch Jahre später holt ihn die jüdische Vergangenheit ein.
Ein weiterer Protagonist ist Romain, gerade erst traumatisiert aus Afghanistan zurück. Bei einem Erholungsaufenthalt auf Zypern lernt er Marion kennen und lieben. Doch beide sind anderweitig gebunden.
Osman Diboula stammt aus armen Verhältnissen, aufgewachsen im Randgebiet von Paris. Seine Eltern sorgten für eine gute Ausbildung, er arbeitete sich hoch bis in den Elyseepalast in dem er auf Sonia trifft, wie er schwarzer Hautfarbe, jedoch mit einem gänzlich anderen Hintergrund. Er, der als Sozialarbeiter versuchte, hoffnungslosen Menschen eine Zukunft zu geben soll nun im Außenministerium politisch aktiv werden.
Verschiedenste Biografien und Persönlichkeiten werden in diesen Roman beschrieben, allen eint der Wunsch nach Erfolg, die Welt zu verbessern und persönlichem Glück. Anspruchsvoll und doch leicht lesbar, teilweise erschütternd und immer nachdenklich machend, ist dieses ein ganz hervorragend geschriebener Roman.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Es beginnt ein Jahr vor 9/11. Die Euphorie von zwei Menschen, die einen der begehrten Jobs im World Trade Center bekommen haben, wird deutlich. Wenn sie wüssten, was sie ein Jahr später erwartet.
Dann lernen wir drei unterschiedliche Menschen kennen, die sehr unterschiedliche Leben haben …
Mehr
Es beginnt ein Jahr vor 9/11. Die Euphorie von zwei Menschen, die einen der begehrten Jobs im World Trade Center bekommen haben, wird deutlich. Wenn sie wüssten, was sie ein Jahr später erwartet.
Dann lernen wir drei unterschiedliche Menschen kennen, die sehr unterschiedliche Leben haben und denen gemein ist, dass sie nach Anerkennung streben und weiterkommen wollen.
François Vély ist ein erfolgreicher Manager, dessen weiterer Aufstieg von einer Medienkampagne ausgebremst wird, in der ihm vorgeworfen wird, er sei rassistisch und beute Menschen aus. Seine Frau verliebt sich in Romain Roller.
Romain Roller wurde Soldat, weil er, der aus einem Armenviertel stammt, keine anderen Perspektiven hatte. Doch traumatisiert kehrt er von seinen Kriegseinsätzen nach Frankreich zurück
Osman Diboula stammt ebenfalls aus einem Armenviertel, hat es aber geschafft nach oben zu kommen. Nun gehört er im Kreis um den französischen Präsidenten an, doch seine Position ist nicht sicher.
Die Autorin schreibt nüchtern und dennoch eindringlich und zeigt ein realistisches Bild der französischen Gesellschaft. Die Herkunft der Menschen sorgt für ihre Positionen in der Gesellschaft, und die Grenzen in dieser Klassengesellschaft sind nur schwer zu überwinden. Rassismus ist immer wieder ein Thema, das in alle Richtungen funktioniert.
Es macht betroffen, wenn einem so vor Augen geführt wird, wie die Menschen getrieben werden von ihren Sehnsüchten und dem Wunsch nach Anerkennung und Erfolg. Auf der Strecke bleiben dabei häufig Menschlichkeit und Moral.
Ein guter gesellschaftskritischer Roman, der nachdenklich stimmt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Im Roman von Karine Tuil stehen vier Menschen im Vordergrund. Romain Roller, Soldat der französischen Armee und traumatisierter Afghanistan-Heimkehrer. Francoise Vely, reicher Unternehmer, mit einem außergewöhnlichen Kunstinteresse und jüdischen Wurzeln,und seine zweite Frau …
Mehr
Im Roman von Karine Tuil stehen vier Menschen im Vordergrund. Romain Roller, Soldat der französischen Armee und traumatisierter Afghanistan-Heimkehrer. Francoise Vely, reicher Unternehmer, mit einem außergewöhnlichen Kunstinteresse und jüdischen Wurzeln,und seine zweite Frau Marion. Die Beziehung der beiden fing durch den Selbstmord von Francoise erster Frau kurz vor der Heirat an zu bröckeln.
Der Vierte, der hier im Blickpunkt steht, ist der farbige Mitarbeiter im Elysee-Palast, Osman Diboula. Aufgewachsen im sozialen Brennpunkt, im Banlieue, den Vororten Paris, hat Osman als Streetworker, Vermittler und Schlichter auf sich aufmerksam gemacht und danach eine steile Karriere im politischen Geschäft begonnen.
Anfangs erzählt die Autorin abwechselnd in öfters kurzen Abschnitten von den vier Hauptprotagonisten, die sich anfangs weder kennen noch sonstige Berührungspunkte haben. Doch sie haben eines gemein: richtig glücklich und zufrieden mit sich und seinem Leben ist keiner.
Es geht um die Suche nach Macht, weil manche der Protagonisten das Gefühl haben, nur dann glücklich/anerkannt/zufrieden zu sein. Es geht um die eigenen Wurzeln (bei Osman Diboula, aber auch bei Francoise Vely), die man abschütteln möchte, weil man dazu gehören möchte, nicht anders sein will.
Es geht auch um das eigene Gewissen. Um das Abschütteln der Vergangenheit, nur mit dem Blick nach vorne zu leben. Ist das möglich ?
Es geht um Beziehungen, Liebe und Ehen. Ehen, die aufgrund der Verschiedenheit der Ehepartner oder auch durch die Selbstsucht der Protagonisten zum Scheitern verurteilt sind.
Es geht aber auch um die sozialen Netzwerke, Meinungsmache, Medien. Und um ihre Macht, die das Leben eines Einzelnen nicht nur verändern können.
Und es ist eine Suche nach einem glücklichen Leben, das eigentlich jeder der Protagonisten sich wünscht.
Als Leser verfolgt man gespannt ihre Anstrengungen, ihre Fehltritte, ihre Entscheidungen. Manchmal kann man als Leser Symphatiepunkte verteilen um diese im nächsten Augenblick wieder zu streichen. Es gibt bei den Protagonisten keine eindeutigen Helden oder Antihelden - irgendwie steckt in jedem beides.
Anfangs sind es vier Erzählstränge, die aber nach und nach sich immer mehr verwickeln, nach und nach berühren sich die Leben der vier Protagonisten, am Ende kennen sich alle Protagonisten und sind in unterschiedlichen Konstellationen auch voneinander abhängig.
Am Ende muss man tief durchatmen und das Ganze Geschehen, die ganze Geschichte erst einmal sacken lassen.
Der Schreibstil ist sehr flüssig, wenn man sich mit den Protagonisten vertraut gemacht hat, ist man gespannt auf den Fortgang. Auch wenn alles aus der Erzählwarte eher kühl, diagnostisch, seziert erzählt wird, verfolgt man als Leser gespannt das Auf und Ab der Protagonisten mit. Irgendwie herrscht in ihrem Leben auch nie Ruhe, es ist immer Entwicklung, immer Bewegung - egal in welche Richtung - vorhanden. "Die Zeit der Ruhelosen" - ein Roman aus unserer heutigen Zeit, den ich empfehle kann.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für