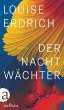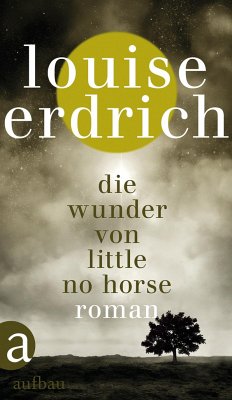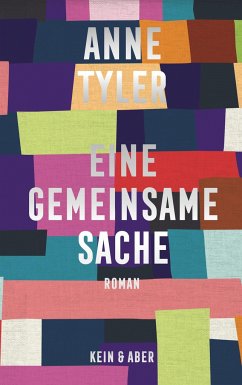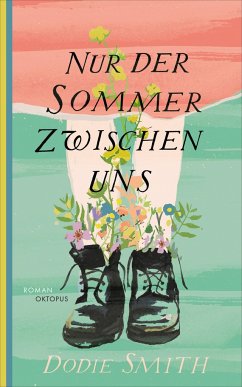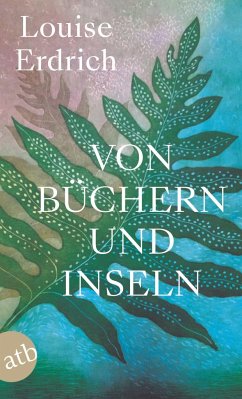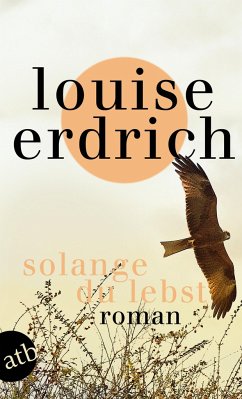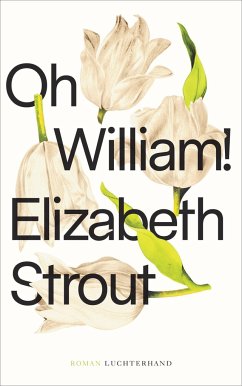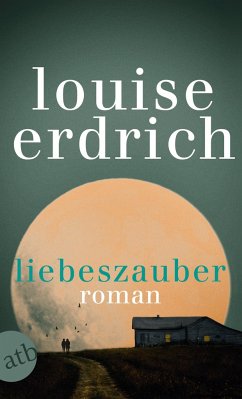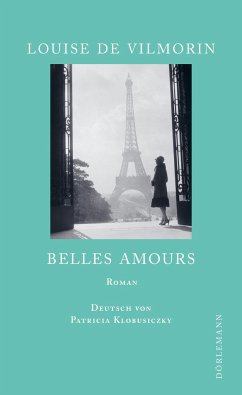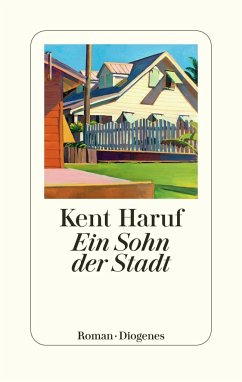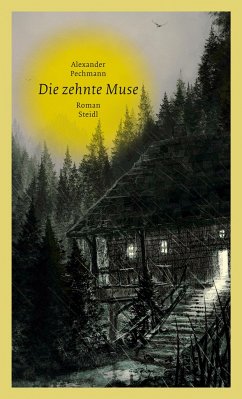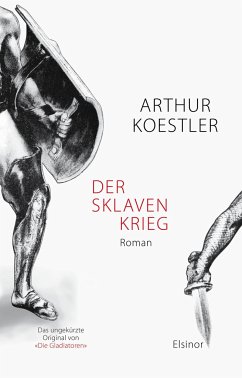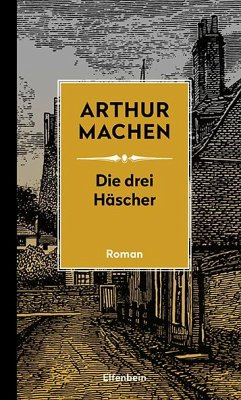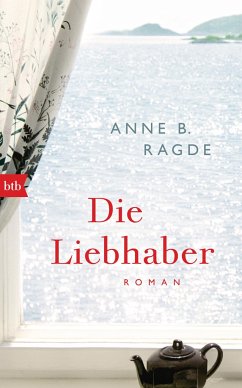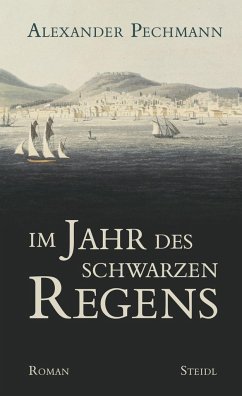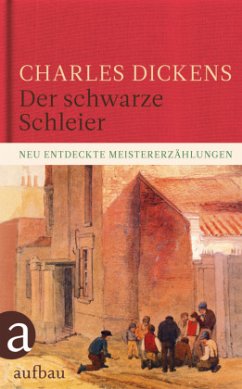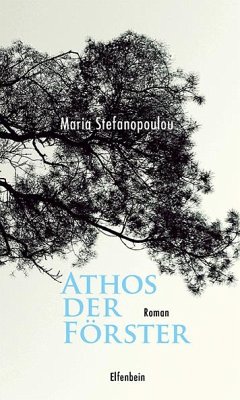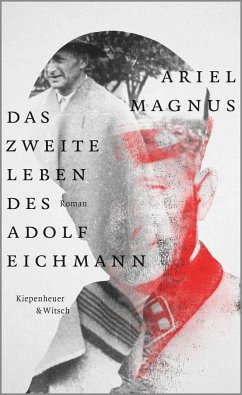Nicht lieferbar
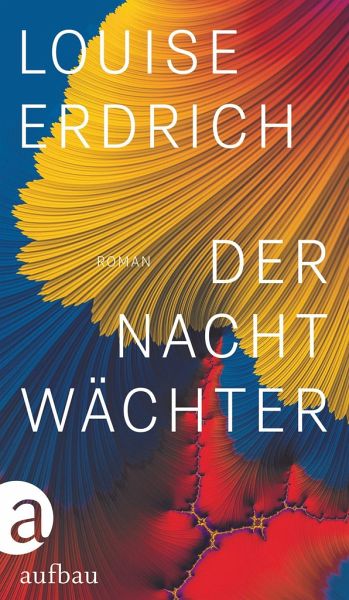





Pulitzer Prize for Fiction 2021.Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Elegant, humorvoll und emotional mitreißend führt Louise Erdrich vor, warum sie zu den bedeutendsten amerikanischen Auto...
Pulitzer Prize for Fiction 2021.
Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Elegant, humorvoll und emotional mitreißend führt Louise Erdrich vor, warum sie zu den bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart gezählt wird - und zeigt, dass wir alle für unsere Überzeugungen kämpfen sollten und dabei manchmal sogar etwas zu verändern vermögen.
»Mir stockte der Atem, als ich begriff, was meinem Großvater von seinem Nachtwächter-Schreibtisch aus gelungen war.« Louise Erdrich
»Ein meisterhaftes Epos. Nach der Lektüre ist man tief bewegt und vermisst diese Figuren, als wären sie echte Menschen.« New York Times Book Review
»Mit diesem Roman ist Louise Erdrich auf der Höhe ihrer genialischen Schaffenskraft angelangt.« Washington Post
Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Elegant, humorvoll und emotional mitreißend führt Louise Erdrich vor, warum sie zu den bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart gezählt wird - und zeigt, dass wir alle für unsere Überzeugungen kämpfen sollten und dabei manchmal sogar etwas zu verändern vermögen.
»Mir stockte der Atem, als ich begriff, was meinem Großvater von seinem Nachtwächter-Schreibtisch aus gelungen war.« Louise Erdrich
»Ein meisterhaftes Epos. Nach der Lektüre ist man tief bewegt und vermisst diese Figuren, als wären sie echte Menschen.« New York Times Book Review
»Mit diesem Roman ist Louise Erdrich auf der Höhe ihrer genialischen Schaffenskraft angelangt.« Washington Post
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau-Verlag
- Originaltitel: The Night Watchman
- Artikelnr. des Verlages: 641/13857
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 496
- Erscheinungstermin: 12. Juli 2021
- Deutsch
- Abmessung: 217mm x 132mm x 42mm
- Gewicht: 624g
- ISBN-13: 9783351038571
- ISBN-10: 3351038577
- Artikelnr.: 61447321
Herstellerkennzeichnung
Aufbau Verlagsgruppe GmbH
Neue Promenade 6
10178 Berlin
info@aufbau-verlag.de
www.aufbau-verlag.de
+49 (030) 28394-0
»Ruhm hat diese Autorin verdient, Ruhm und Ehre und Triumphe.« Hamburger Abendblatt 20210909
!4,5 Sterne!
Klappentext:
„Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin …
Mehr
!4,5 Sterne!
Klappentext:
„Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug…“
Wie mag es wohl sein, wenn der eigene Großvater ein Indianer ist? Wenn man ganz besondere Gene in sich trägt? Autorin Louise Erdrich berichtet in diesem Buch von ihrem Großvater Thomas, Vorsitzender des Stammesrats, des Turtle Mountain Advisory Commitee. Die Welt der Stämme wird vom eigenen Land aus den Fugen gebracht, als plötzlich Worte wie „Eingliederung“ oder Terminierung fallen. Die Indianer sollen ihre Heimat aufgeben um das Land von ihnen zu befreien und dafür erhalten sie anderweitig einen Platz zum leben. Nein, wir befinden uns nicjt im Mittelalter sondern im Jahr 1953. Thomas geht Nacht für Nacht in seinem Job auch seiner Herkunft hinterher und versucht anhand von unzähligen Briefen, Protestschreiben gegen diese Taten vorzugehen. Wem gehört das Land? Warum wird man umgesiedelt, wenn man doch niemanden stört? Wer war zuerst hier? Was haben Ureinwohner überhaupt noch für eine Bedeutung? Wer gibt einem das Recht das eigene Land zu enteignen und anderen zur Verfügung zu stellen? Indianer sind doch keine Spinner! Sie haben das Land doch zudem gemacht! Unweigerlich kommen einem beim lesen die eigenen Gedanken in den Sinn und man kann Thomas nur zu gut verstehen warum er so agiert. Erdrich wählt hierfür die passenden Worten und hält einen geschmeidigen Lesefluss und Wortklang für den Leser bereit, der das eigene Denken und gleichzeitige Lesen ermöglicht. Manchmal liegt es in der Kraft eines Einzelnen etwas zu bewegen, das war schon immer so, aber manchmal braucht es auch ein paar mehr Stimmen. Thomas‘ Geschichte ist ein Meilenstein in der amerikanischen Geschichte und wirkt selbst heute noch nicht beruhigt oder gar abgeschlossen. Leider sind zu viele Parallelen selbst für die heutige Zeit im 21. Jahrhundert sichtbar und lassen immer wieder sie Frage aufkommen: Wem gehört das Land und wer hat das Recht dazu, die eigene Heimat neu auszurichten?
Diese Geschichte ist ein extrem feinstimmiges Buch, das Geschichte enthält, einen nachdenklichen Blick auf die Gesellschaft freigibt und nachhallt. Da ich mich sehr viel mit den alten Indianer-Stämmen befasse, war dies ein sehr guter und authentischer Weitblick in eine längst verdrängte Thematik. Ein nachhallendes Buch mit besonderer Geschichte - 4,5 von 5 Sterne.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Louise Erdrich zählt zu den erfolgreichsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwartsliteratur. Die in Minneapolis lebende Schriftstellerin mit deutschen und indigenen Wurzeln wurde schon mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award.
Ihr neustes Werk „Der …
Mehr
Louise Erdrich zählt zu den erfolgreichsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwartsliteratur. Die in Minneapolis lebende Schriftstellerin mit deutschen und indigenen Wurzeln wurde schon mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award.
Ihr neustes Werk „Der Nachtwächter“ wurde mit dem Pulitzer Preis 2021 ausgezeichnet und ist am 12.07.2021 beim Aufbau Verlag erschienen.
„Der Nachtwächter“ basiert auf das eindrucksvolle Leben von Louise Erdrich´s Großvater, Häuptling der Chippewa. Wie die Romanfigur Thomas Wazhushk protestierte er in den 50er Jahren gegen die Enteignung der amerikanischen Ureinwohner. Der Kampf hierfür führte ihn von ländlichen North Dakota nach Washington.
Neben der politischen Seite schildert Louise Erdrich in „Der Nachtwächter“ das bewegende Leben von Thomas Wazhushk Nichte Patrice. Die kluge und starke Frau arbeitet in der Fabrik, da sie sich um ihre Mutter und Bruder zu kümmern hat. Als ihre ältere Schwester verschwindet, macht sich Patrice auf die Suche nach ihr.
Die Charaktere in „Der Nachtwächter“ sind hervorragend und komplex. Louise Erdrich zeigt glaubhaft die Probleme, die Misshandlungen, die schrecklichen Schicksale vieler Frauen, aber auch den Zusammenhalt des Stammes. Gleichzeitig geht die Autorin auf die spirituelle Verbundenheit der Chippewa mit der Natur und den Bräuchen ein. Das Leben jedes Charakters fesselt einen so sehr, dass man wissen möchte, wie es weitergeht.
„Der Nachtwächter“ von Louise Erdrich ist faszinierend durch seine Charaktere und deren Geschichte. Beim Lesen gewinnt man einen eindrucksvollen Einblick in das Leben der Ureinwohner Amerikas.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Die amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich hat Wurzeln im Volk der Chippewa, eine der heute größten indigenen Ethnien Nordamerikas. Erdrich erzählt darin vom politischen Kampf ihres Großvaters Thomas Wazhashk. Er ist der titelgebende Nachtwächter, der seinen Dienst …
Mehr
Die amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich hat Wurzeln im Volk der Chippewa, eine der heute größten indigenen Ethnien Nordamerikas. Erdrich erzählt darin vom politischen Kampf ihres Großvaters Thomas Wazhashk. Er ist der titelgebende Nachtwächter, der seinen Dienst in einer Lagerfabrik in der Nähe des Turtle Mountain-Reservats im ländlichen North Dakota verrichtet.
Im Jahr 1953 versuchte der Kongress der Vereinigten Staaten, die Rechte der amerikanischen Ureinwohner unter dem Deckmantel der Integrationspolitik weiter zu beschneiden. Doch um Integration geht es nicht, soviel ist Wazhashk, der Mitglied des Chippewa-Rates ist, klar. Bisher besitzen die Weißen schon die Flächen mit den fruchtbarsten Böden, während die Chippewa kaum über brauchbare Brunnen verfügen. Nun sollen die bisherigen Verträge zwischen dem Bundesstaat und den Indianerstämmen noch einmal geändert werden, natürlich nur zum Vorteil der weißen Bewohner. Im Auftrag des Stammesrates hat Wazhashk schon zahlreiche Schreiben verfasst – bisher ohne Erfolg.
Eine weitere Protagonistin des Romans ist Patrice Paranteau, genannt Pixie, die trotz Highschool-Abschluss nur Arbeiterin in der Lagerfabrik arbeitet. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Schwester Vera in Minneapolis. Bei ihrer Suche gerät Pixie allerdings in das Milieu von Prostitution und Drogen und bringt sich dabei selbst in Lebensgefahr.
Erdrich versteht es sehr gut, die unterschiedlichen (privaten und politischen) Handlungsstränge zu verbinden. Neben ihrer Familiengeschichte hat die Autorin dazu auch umfangreiche Recherchen zur Geschichte der Chippewa unternommen. Für den Roman wurde Erdrich just mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Louise Erdrich, Autorin mit Chippewa-Wurzeln, 2021 mit dem Pulitzer 2021 für diesen Roman ausgezeichnet, zeigt in „Der Nachtwächter“ das dunkle Kapitel der „Termination Bill“ auf, die ihren Anfang zu Beginn der fünfziger Jahre hat. Verträge, die seit …
Mehr
Louise Erdrich, Autorin mit Chippewa-Wurzeln, 2021 mit dem Pulitzer 2021 für diesen Roman ausgezeichnet, zeigt in „Der Nachtwächter“ das dunkle Kapitel der „Termination Bill“ auf, die ihren Anfang zu Beginn der fünfziger Jahre hat. Verträge, die seit langem Bestand haben, werden gebrochen mit dem Ziel, die Stämme zu zerschlagen, die Ureinwohner von ihrem Land zu vertreiben und in Städte umzusiedeln. Schlussendlich Landraub mit legitimen Mitteln. Druck wird im Wesentlichen über die finanzielle Schiene aufgebaut. Den Stämmen wird der autonome Status aberkannt, die Entschädigungszahlungen für die Besiedlung von Stammesland eingestellt. Die Auswirkungen, die dies hat, sind bis heute deutlich zu sehen: Armut, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven und nicht zuletzt der Identitätsverlust der Vertriebenen.
Erdrichs Großvater wurde im Turtle Mountain Reservat in North Dakota geboren, und seine Geschichte ist Inspiration und Grundlage für diesen Roman, in dessen Zentrum Thomas Wazhushk steht. Nachts bewacht er eine Fabrik, in der tagsüber die Frauen des Turtle-Mountain-Clans arbeiten, unter anderem auch seine Nichte Pixie. Thomas ist ein guter, ein mitfühlender Mensch und will die anstehende Vertreibung mit allen Mitteln verhindern, weshalb er einerseits innerhalb des Reservats versucht, zu informieren und einen Marsch nach Washington zu organisieren, andererseits aber auch viele Nächte damit verbringt, lange Briefe an die Verantwortlichen in Washington zu schreiben, um seinen Stamm vor der Auslöschung, aber auch den Erfahrungen zu bewahren, die Pixie machen muss, als sie in Minneapolis nach ihrer Schwester sucht, die das Reservat verlassen hat und spurlos verschwunden ist.
Es ist ein buntes Kaleidoskop, zusammengesetzt aus unzähligen Einzelschicksalen, Drama und leisem Humor, übernatürlichen Erscheinungen, Mystik und Spiritualität. Eine liebe- und respektvolle Hommage an die Menschen, die trotz aller Widrigkeiten ihre Würde behalten und mit aller Entschlossenheit für ihre Traditionen und ihre Existenz kämpfen. Lesen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
1953 in den USA. Der Staat hat gerade die Umsetzung des „Termination Acts“ beschlossen, eines Gesetzes, das die Verwaltung die Reservate der amerikanischen Ureinwohner durch die Regierung aufheben, und erstere den anderen US-Bürgern gleichstellen soll. In der Konsequenz würde …
Mehr
1953 in den USA. Der Staat hat gerade die Umsetzung des „Termination Acts“ beschlossen, eines Gesetzes, das die Verwaltung die Reservate der amerikanischen Ureinwohner durch die Regierung aufheben, und erstere den anderen US-Bürgern gleichstellen soll. In der Konsequenz würde das die Aufhebung der Rechte auf die Nutzung der ihnen zugesprochenen Ländereien und den Entzug der Lebensgrundlagen bedeuten. Das Turtle Mountain Reservat der Chippewa ist eins der ersten, die diesem neuen Gesetz zum Opfer fallen soll. Hier lebt Thomas Wazhashk (als dessen Vorbild Louise Erdrichs Großvater gedient hat), der als Nachtwächter in der örtlichen Lagersteinfabrik arbeitet und sich bei Tag für die Rechte seines Stammes einsetzt, unermüdlich Anfragen, Einsprüche und Bittbriefe verfasst und schließlich maßgeblich an der Bildung eines Komitees beteiligt ist, dass sich mit den zuständigen Politikern trifft, um das Gesetz zu verhindern.
Auch seine Nichte Patrice arbeitet in der Fabrik, um ihre Mutter und ihren kleinen Bruder finanziell zu unterstützen. Der Vater ist ein Trinker, der für den Alkohol seine eigene Familie bestiehlt und zu Handgreiflichkeiten neigt. Die ältere Schwester ist vor Monaten schwanger mit dem Kindsvater nach Minneapolis gegangen, seitdem ist der Kontakt zu ihr abgebrochen, die junge Frau verschwunden. Patrice beschließt, ihr nachzureisen, um sie und das Kind nach Hause zu bringen.
Für mich war „Der Nachtwächter“ nach „Liebeszauber“ der zweite Roman von Louise Erdrich. Und er hat mir noch ein wenig besser gefallen, als letzterer. Erdrich ist eine Meisterin im kreieren von Charakteren, im Erschaffen einer Welt, die so greifbar und lebendig wird, dass man meint, Orte und Personen persönlich zu kennen. Gleichzeitig präsentiert sie eine große Bandbreite an verschiedenen Schicksalen, ohne diese groß aufzuarbeiten oder zu kommentieren, ein subtiler Weg, den Leser in erster Linie über das Erfühlen der Atmosphäre zum Nachdenken anzuregen, die ich beachtlich fand. Gut gefallen hat mir auch die Einarbeitung mystischer Elemente, die so differenziert und natürlich ist, dass man sie kaum in Frage stellt, sondern als festen Teil des Lebens der Chippewa begreift.
Was ich nicht wirklich nachempfinden konnte, war die einzigartige Rolle, die Thomas im Kampf gegen das Terminierungsgesetzes im Covertext zugesprochen wird. Er setzt sich ein, er hat eine führende Rolle, aber die Rettung eines Dorfes durch einen einzigen Mann habe ich nicht wirklich gesehen, eher das Werk einer Gemeinschaft. Auch waren mir ab und an die Zufälle, die zum Treffen verschiedener Figuren an unwahrscheinlichen Orten geführt haben, etwas zu unwahrscheinlich. Fragwürdig, aber akzeptabel.
2021 hat „Der Nachtwächter“ den Pulitzer Preis gewonnen, meiner Meinung nach verdient. Nicht nur wegen seiner literarischen Stärke, sondern auch, weil er sich einem Thema widmet, dass in unserer Zeit zwischen #metoo, #blacklivesmatter und den LGBTQ-Bewegungen – jedes, ohne Frage, ein sehr wichtiges Thema – ein wenig unterzugehen zu scheint. Die Lage der amerikanischen Ureinwohner ist nach wie vor vielerorts fatal und ihre Geschichte noch lange nicht aufgearbeitet. Ich empfehle dieses Buch gerne weiter.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dieses Buch hat mich aufgrund seiner vielen positiven Rezensionen neugierig gemacht. Und natürlich auch, weil es 2021 den Pulitzer Preis gewonnen hat. Aber ich muss direkt sagen, dass es mir leider nicht gefallen hat.
Das Thema, die Aufarbeitung der Geschichte eines Stammes der native …
Mehr
Dieses Buch hat mich aufgrund seiner vielen positiven Rezensionen neugierig gemacht. Und natürlich auch, weil es 2021 den Pulitzer Preis gewonnen hat. Aber ich muss direkt sagen, dass es mir leider nicht gefallen hat.
Das Thema, die Aufarbeitung der Geschichte eines Stammes der native Americans, fand ich spannend. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Autorin einfach zu viel in das Buch hineinpacken wollte. Viele Situationen und Handlungsstränge verlaufen einfach irgendwie, ohne eine Zusammenführung oder einen Abschluss zu erfahren.
Es gibt 2 große Erzählstränge (Patrice und Thomas), die sich nie wirklich treffen. Dadurch hatte ich das Gefühl, man hätte auch einfach zwei unabhängige Bücher daraus machen können. Das hat mich sehr gestört. Und auch das Ende fand ich unbefriedigend.
Ja, es ist ein wichtiges Thema, und ich hatte auch den Eindruck, dass die Autorin über viel Hintergrundwissen verfügt, aber überzeugen konnte es mich nicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Louise Erdrich schreibt in ihrem neuen Roman über den Großvater. Der setzte sich für seine Leute ein und wehrte sich gegen die Enteignung der Ureinwohner Amerikas. Was Einzelne damals zuwege brachten und wie schwer ihr Kampf für Gerechtigkeit war, das kommt in
„Der …
Mehr
Louise Erdrich schreibt in ihrem neuen Roman über den Großvater. Der setzte sich für seine Leute ein und wehrte sich gegen die Enteignung der Ureinwohner Amerikas. Was Einzelne damals zuwege brachten und wie schwer ihr Kampf für Gerechtigkeit war, das kommt in
„Der Nachtwächter“ eindrücklich zum Vorschein.
Die Autorin lebt mit der Natur und für sie. Sie beschreibt den Glauben an eine Himmelsfrau und in welcher Weise Pflanzen miteinander kommunizieren. Das Buch ist ein beeindruckendes Zeugnis einer Frau, die ihre Wurzeln bei den Ureinwohnern Amerikas hat. Nein, das bedarf für mich keines Beweises durch wissenschaftlichen Studien, dass Bäume, in welcher Weise auch immer, „Gespräche“ führen. Ihre Weisheit ist legendär und nicht nur bei diesem Thema kann ich viel von den „Indianern“ lernen.
Welchen Einfluss hat die durch Menschenhand arg ausgenutzte Umwelt auf das Klima und das Wachstum der lebenswichtigen Pflanzen? Auch das beschreibt Frau Erdrich sehr deutlich. Das Buch faszinierte mich und das lag nicht nur an den Ausführungen. Die Sprache gefiel mir nämlich ebenfalls sehr gut und hier hat die Übersetzerin Gesine Schröder wirklich ganze Arbeit geleistet. Einzig Ruhe und Konzentration aufs Lesen sollten Interessierte mitbringen. Dann erleben sie nämlich kostbare und lehrreiche Stunden, wobei am Ende des Buches viele Themen zum Nachdenken übrig sind.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
In ihrem Roman „Der Nachtwächter“ weckt die bekannte amerikanische Autorin Louise Erdrich nicht nur die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Epoche in der Geschichte der Native Americans, sondern ehrt auch den Einsatz ihres Großvaters für sein Volk.
Seit dem 19.Jahrhundert …
Mehr
In ihrem Roman „Der Nachtwächter“ weckt die bekannte amerikanische Autorin Louise Erdrich nicht nur die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Epoche in der Geschichte der Native Americans, sondern ehrt auch den Einsatz ihres Großvaters für sein Volk.
Seit dem 19.Jahrhundert wurden die amerikanischen Ureinwohner in Reservaten zusammengedrängt, oft auf zu kleinen Landflächen schlechter Qualität. Dort kämpfen sie ums Überleben, sind gezwungen, sich dem Lebenswandel und den Ideologien der Weißen anzupassen, und versuchen dabei, ihre eigene Identität und ihre Gebräuche aufrechtzuerhalten. Anfang der 1950er Jahre wird vom Kongress ein Gesetz verabschiedet, dass die zugesicherten Anrechte der Native Americans zurücknimmt, sie zur Zahlung von höheren Steuern verpflichten soll und zur Umsiedelung in die Städte bewegen, was einer Auslöschung der Stämme gleichkommt.
Dies betrifft auch den Stamm der Turtle Mountain Band of Chippewa, dessen Vorsitz Louise Erdrichs Großvater zu dieser Zeit innehatte. Im Roman lebt Thomas Wazhashk diese Rolle, er kümmert sich um seine Farm, die Belange seines Stammes und schreibt während seiner Nachtwachen in der Lagersteinfabrik Briefe an öffentliche Stellen und Personen, um für ihre Rechte einzustehen. Als er von dem geplanten Terminierungsgesetz hört, kann er den Inhalt zunächst nicht glauben, setzt sich dann intensiv damit auseinander und organisiert eine Delegation nach Washington, um dort ihr Anliegen zu vertreten.
Neben diesem Hauptthema gibt die Autorin einen Eindruck in das Leben der Chippewa zu dieser Zeit. Der Leser nimmt an den Gedanken und Eindrücken mehrerer Stammesmitglieder teil aber auch einiger Weißer, die im Reservat leben oder dieses besuchen. Es wird eindrucksvoll vermittelt, wie die verschiedenen Personen und unterschiedlichen Generationen mit dem Umbruch in ihrer Gesellschaft umgehen, sich der Lebensweise der Weißen anpassen oder an den Anforderungen scheitern, sich zum christlochen Glauben bekennen und dennoch ihre alten Gebräuche und Ahnen ehren. In vielen Szenen und Gesprächen zeigt sich, wie unterschiedlich die Werte der Weißen und der Chippewa sind, wie anders ihr Blick auf die Welt und ihr Umgang mit der Natur.
Mich hat das Buch sowohl inhaltlich als auch sprachlich beeindruckt. Trotz der vielen Charaktere hatte ich nie den Eindruck, den Überblick zu verlieren. Die Autorin weckt auf sensible Weise Verständnis für das Leben und Denken der Native Americans für das Leid, dass sie erfahren haben, aber sie zeigt auch die Stärken auf, die in der Gemeinschaft einer Familie oder eines Stammes stecken können. Diese wunderbar feinsinnige Geschichte hat mein Interesse geweckt, noch weitere Geschichten dieser Autorin zu entdecken.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Modernes Indianer-Epos
Mit dem Roman «Der Nachtwächter» öffnet die US-amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich einen aufschlussreichen Einblick in die Kämpfe der indigenen Bevölkerung gegen die geplante Assimilierung. Im Nachlass ihres indianischen …
Mehr
Modernes Indianer-Epos
Mit dem Roman «Der Nachtwächter» öffnet die US-amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich einen aufschlussreichen Einblick in die Kämpfe der indigenen Bevölkerung gegen die geplante Assimilierung. Im Nachlass ihres indianischen Großvaters fand die Autorin viele Briefe von ihm an seine Kinder, die «eine Fundgrube für spannende, lustige, klischeeferne Alltags-Geschichten aus dem Reservat» waren, wie sie im Nachwort schreibt, und die fiktional ergänzt in ihren Roman eingeflossen sind. Die Regierung in Washington verfolgte Anfang der 1950er Jahre Pläne zur Aufhebung der einst vertraglich festgelegten Sonderrechte der indianischen Bevölkerung, die, so lautet der Vertrag, gelten sollen, «solange das Gras wächst und die Flüsse fließen». In den USA gilt die in Deutschland weniger bekannte Louise Erdrich als eine der besten Gegenwarts-Autorinnen, der vorliegende Roman wurde 2021 mit dem begehrten ‹Pulitzer Prize for Fiction› ausgezeichnet.
Am 1. August 1953 wurden in der House Concurrent Resolution 108 die Indianerstämme benannt, die zur «Terminierung» vorgesehen waren, unter ihnen auch der Turtle Mountain Band of Chippewa. Die sogenannte Terminations-Politik sollte angeblich die in prekären Verhältnissen lebende, indianische Bevölkerung wirtschaftlich dem Niveau der weißen Bevölkerung angleichen. Letztendlich aber zielte sie nur darauf ab, endlich die Reservate aufzulösen und damit im Immobilienboom jener Jahre das Land für die großen Konzerne verfügbar zu machen. Männlicher Protagonist des Romans ist Thomas Wazhashk, der titelgebende Nachtwächter. Er kämpft als Vorsitzender des Stammesrates an vorderster Front gegen diese Pläne, beschäftigt sich intensiv mit der listig verklausulierten Gesetzesvorlage, schreibt in den langen Nachtstunden Briefe an das Bureau of Indian Affairs, an den Senator von North Dakota, und er korrespondiert mit den weitverstreut siedelnden, anderen Stammesräten. Als er nach zähem Kampf schließlich erreicht, dass eine Anhörung vor dem zuständigen Unterausschuss im Kongress anberaumt wird, sammelt er auch noch Geld ein bei seinen Leuten, damit eine kleine Delegation mit ihm zusammen für einige Tage nach Washington reisen kann.
Um diesen Handlungsrahmen herum schildert die Autorin in mehreren parallel verlaufenden Handlungssträngen vom Leben der Indianer im Reservat North Dakotas. Einziger Arbeitgeber ist dort eine in der Nähe angesiedelte Lagersteinfabrik, in der viele indigene Frauen beschäftigt sind. Sie bohren winzige Löcher in Edelsteine, die vor allem in der Uhrenindustrie gebraucht werden, eine Präzisionsarbeit, die für Männerhände nicht geeignet ist. Die beste Arbeiterin dort ist Patrice, die weibliche Protagonistin des Romans, eine blitzgescheite, toughe junge Frau, die von ihrem Lohn die ganze Familie ernähren muss. Ihre ältere Schwester ist nach Minneapolis gegangen und hat sich dann nicht mehr gemeldet. Monate später macht Patrice sich auf, um ihre verschollene Schwester und deren Baby zu finden. Sie findet das Baby auch und nimmt es mit nach Hause, ihre Schwester aber ist mutmaßlich in die Hände von Zuhältern geraten und wird irgendwo als Sexsklavin gefangen gehalten. Ein weiterer Handlungsstrang beschäftigt sich mit dem Boxsport, dessen Trainer für die schöne Patrice schwärmt, die ihm aber die kalte Schulter zeigt. In vielen Episoden, die kunstvoll zu einem beeindruckenden Epos miteinander verbunden sind, wird von weiteren Figuren aus dem Stamm der Chippewa erzählt. Sie sind allesamt sympathische Charaktere, die stimmig geschildert werden.
Mit leichter Hand und trotz aller Tragik humorvoll wird hier vom drohenden Verlust der Identität indianischer Stämme berichtet, die alle nicht Farmer werden wollen. In ihnen ist das Erbe ihrer Vorfahren tief verwurzelt, die bekanntlich nomadisierende Jäger waren. Leicht lesbar und mit einem klug aufgebauten Plot ist dieses moderne Indianer-Epos eine bereichernde Lektüre.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
September 1953, North Dakota, Reservat des Turtle Mountain Band of Chippewa. Stammesratsvorsitzender Thomas Wazhashk - benannt nach der tapferen Bisamratte - bewirtschaftet tagsüber sein Farmland und arbeitet nachts als Wächter der Lagersteinfabrik, deren Ansiedlung am Rande des Reservats …
Mehr
September 1953, North Dakota, Reservat des Turtle Mountain Band of Chippewa. Stammesratsvorsitzender Thomas Wazhashk - benannt nach der tapferen Bisamratte - bewirtschaftet tagsüber sein Farmland und arbeitet nachts als Wächter der Lagersteinfabrik, deren Ansiedlung am Rande des Reservats den Bewohnern ein bescheidenes, aber stetes Einkommen ermöglicht. Zwischen den Kontrollgängen erledigt er die Post; Briefe an die Verwandten und die Politik, geschrieben in vollendet schönen Schwüngen und gewähltem Ausdruck. Thomas war einst Schüler in Fort Totten, einem jener Internate, in die viele Kinder der Ureinwohner zum Zwecke der Zivilisierung verschleppt wurden. Unsägliches ist ihnen dort widerfahren. Doch was er lernte, vermag sie jetzt vielleicht zu retten, denn den indianischen Nationen droht die Terminierung.
Der Kongress in Washington hat mit der sogenannten House Concurrent Resolution 108 beschlossen, sie zu "emanzipieren", allen US-Bürgern gleichzustellen. Die Reservate sollen aufgelöst, die Ländereien verkauft, die Bewohner - von der Autorin schlicht Indianer genannt - in die Städte umgesiedelt und damit ausgelöscht werden, als hätte es sie nie gegeben.
"Das ist es dann also, dachte Thomas, als er die nüchternen Satzgirlanden der Gesetzesvorlage vor sich sah. Wir haben die Pocken überlebt, die Winchester-Repetierbüchse, die Hotchkiss-Kanone, die Tuberkulose. Wir haben die Grippeepidemie von 1918 überlebt und in vier oder fünf Kriegen für die USA gekämpft. Und jetzt vernichtet uns diese Ansammlung knochentrockener Wörter. Die Veräußerung, das Einstellen, die Terminierung, Obiges, Folgendes, besagte."
Doch der Legende zufolge war es die tapfere Bisamratte, die ihr Leben gab, um die Welt entstehen zu lassen, auf der sie immer noch lebten. Die Bisamratte, die Thomas Wazhashk seinen Namen gab...
Mit dem vorliegenden Roman hat Louise Erdrich ihrem Großvater, der Ende 1953 den Protest der Ureinwohner mit einer kleinen Delegation von North Dakota bis in den Kongress nach Washington trug und dabei seine Gesundheit ruinierte, ein literarisches Denkmal gesetzt.
Wie sie das tut, hat zu Recht den Pulitzer Preis verdient. Ihre bild- und detailreichen Schilderungen der indianischen Lebenswelt zeugen von intimer Milieukenntnis, tiefer Liebe und Verwurzelung. Der Roman ist mit vielen wunderschönen poetischen Details - etwa der Geschichte von Thomas' Flickendecke - und zarten lyrischen Bildern ausgestattet, die Gesine Schröder ebenso sanft ins Deutsche übertragen hat. Mir fallen jetzt zur Nachtzeit nicht mehr nur die Augen zu, sondern ich "treibe auf den Flusslauf des Schlafes hinaus".
Obwohl ihre Charaktere, Lebende wie Geister, alle auffallend empathisch sind, zeichnet die Autorin sie keineswegs als idealisierte Heroen, sondern auch als Menschen in Zweifel und Zwiespalt. Sie irren, treffen fragwürdige, aber selten eigennützige Entscheidungen. Die Gemeinschaft, so die Botschaft, ist das einzige, was sie letztlich retten wird. Ein feiner untergründiger Humor durchdringt dabei fast den gesamten Text und lässt vor allem die Dialoge sehr lebendig wirken.
Louise Erdrich hat die historisch verbürgte Handlung mit einer fiktiven Story rund um die starken Frauenfiguren Patrice 'Pixie' Paranteau und ihre Mutter Zhaanat verknüpft. Deren (auch übersinnliche) Suche nach Pixies verschollener Schwester Vera (TW: sexuelle Gewalt) verleiht der Geschichte einen zusätzlichen Spannungsbogen und macht sie auch zu einem Familien- und Entwicklungsroman.
Ich habe das Buch fast atemlos und in einem Rutsch gelesen und wollte am Ende gleich wieder von vorn beginnen, um die Menschen nicht verlassen zu müssen, die einem wie Freunde ans Herz wachsen.
Unbedingte Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für