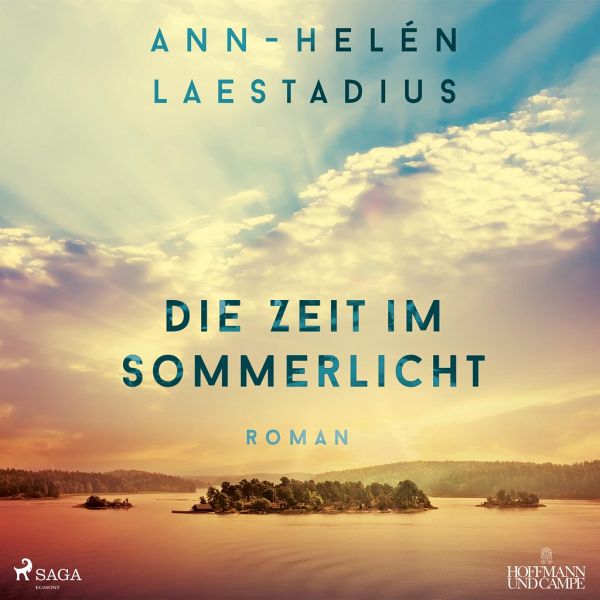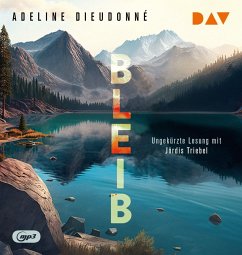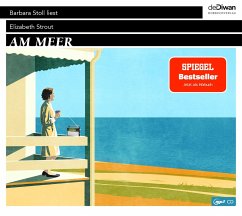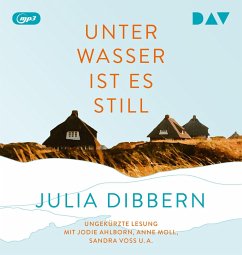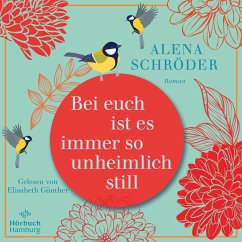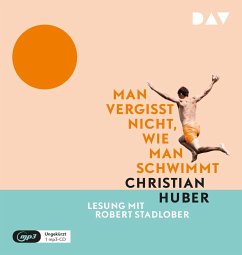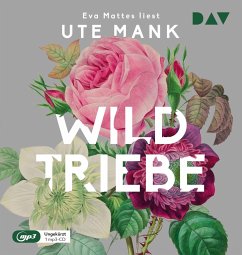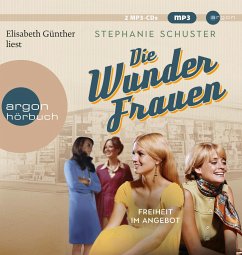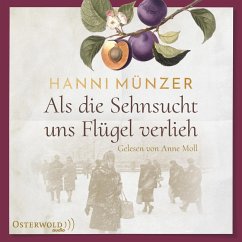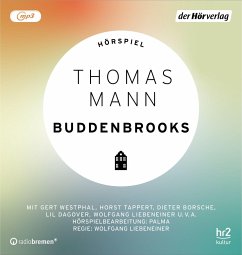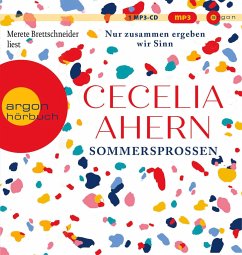Ann-Helén Laestadius
MP3-CD
Die Zeit im Sommerlicht
688 Min.. Ungekürzte Ausgabe.Lesung
Übersetzung: Mißfeldt, Dagmar; Barth, Maike;Gesprochen: Backhaus-Tors, Jana Marie
Sofort lieferbar
Statt: 26,00 €**
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!





Im Land der Rentiere wird eine Gruppe von Kindern ihrer Welt entrissen und in ein entlegenes Internat verbracht, wo sie sich großen Herausforderungen stellen müssen. Eine unvergessliche Geschichte über dunkle Geheimnisse, Hoffnung und Zusammenhalt und die Rückkehr ins Licht.Schweden in den 1950er Jahren. Else-Maj ist sieben Jahre alt, als sie das vertraute Leben im Sámi-Dorf und die wärmende Gegenwart ihrer geliebten Rentiere hinter sich lassen und in ein sogenanntes Nomadeninternat gehen muss. Hier trifft sie auf Jon-Ante, Marge und andere Sámi-Kinder, die wie Else-Maj von nun an all d...
Im Land der Rentiere wird eine Gruppe von Kindern ihrer Welt entrissen und in ein entlegenes Internat verbracht, wo sie sich großen Herausforderungen stellen müssen. Eine unvergessliche Geschichte über dunkle Geheimnisse, Hoffnung und Zusammenhalt und die Rückkehr ins Licht.Schweden in den 1950er Jahren. Else-Maj ist sieben Jahre alt, als sie das vertraute Leben im Sámi-Dorf und die wärmende Gegenwart ihrer geliebten Rentiere hinter sich lassen und in ein sogenanntes Nomadeninternat gehen muss. Hier trifft sie auf Jon-Ante, Marge und andere Sámi-Kinder, die wie Else-Maj von nun an all das verleugnen sollen, was sie von der Welt kennen. Allein die gutmütige Erzieherin Anna, eine Sámi wie sie, hält eine schützende Hand über die Kinder. Doch eines Tages verschwindet sie ohne jede Spur. Erst viele Jahre später erfahren die einstigen Schüler die Antwort und mit ihr endlich eine Chance auf Genugtuung - und Heilung.
Ann-Helén Laestadius, geboren 1971, ist eine schwedische Journalistin und Autorin und gebürtige Sámi. In Schweden war sie bereits für ihre vielfach preisgekrönten Kinder- und Jugendbücher sehr bekannt, bevor sie mit ihrem ersten Roman für ein erwachsenes Publikum, Das Leuchten der Rentiere, auf Anhieb einen Nummer-1-Bestseller landete. Der Roman wurde in Schweden u.a. als Buch des Jahres 2021 ausgezeichnet, stand in Deutschland etliche Wochen in Folge auf der Spiegel-Bestsellerliste und wird aktuell von Netflix verfilmt. Auch Die Zeit im Sommerlicht stand auf Platz 1 der schwedischen Bestsellerliste. Ann-Helén Laestadius lebt in der Nähe von Stockholm.
Produktdetails
- Verlag: Steinbach Sprechende Bücher
- Anzahl: 2 MP3-CDs
- Gesamtlaufzeit: 688 Min.
- Erscheinungstermin: 29. Mai 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783987360756
- Artikelnr.: 69988663
Herstellerkennzeichnung
Steinbach Sprechende
Panoramaweg 22
74547 Untermünkheim
vertrieb@sprechendebuecher.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.05.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.05.2024Die Peinigerin als Pflegefall
Ann-Helén Laestadius erzählt in ihrem Roman "Die Zeit im Sommerlicht", wie die Samen in Schweden unterdrückt wurden
Wem gehören die nach wie vor sehr dünn besiedelten und für europäische Verhältnisse riesigen Regionen weit nördlich des Polarzirkels, und wer darf und soll von ihnen leben? Es ist die Gegend der Samen, der einzig überlebenden indigenen Menschen des ganz alten Europas. Ihre Auseinandersetzungen mit den Nationalstaaten Norwegen, Schweden und Finnland reichen weit zurück in die Geschichte und sind doch hochaktuell. Denn die wertvollen Bodenschätze des sehr hohen Nordens könnten für die Mobilitätswende Europas eine wichtige Rolle spielen. Was wird aber dann aus der Kultur
Ann-Helén Laestadius erzählt in ihrem Roman "Die Zeit im Sommerlicht", wie die Samen in Schweden unterdrückt wurden
Wem gehören die nach wie vor sehr dünn besiedelten und für europäische Verhältnisse riesigen Regionen weit nördlich des Polarzirkels, und wer darf und soll von ihnen leben? Es ist die Gegend der Samen, der einzig überlebenden indigenen Menschen des ganz alten Europas. Ihre Auseinandersetzungen mit den Nationalstaaten Norwegen, Schweden und Finnland reichen weit zurück in die Geschichte und sind doch hochaktuell. Denn die wertvollen Bodenschätze des sehr hohen Nordens könnten für die Mobilitätswende Europas eine wichtige Rolle spielen. Was wird aber dann aus der Kultur
Mehr anzeigen
der Rentierleute in Lappland (in dessen Namen noch die verächtliche Benennung der Samen erhalten ist).
Der neue Roman der 1971 geborenen Schriftstellerin, Journalistin. Kinderbuchautorin und Trägerin des August-Preises (der höchsten literarischen Auszeichnung Schwedens nach dem Nobelpreis) Ann-Helen Laestadius nimmt seine Leser mit in eine ebenso bedrückende wie berührende Geschichte in dieser Gegend. Schweden hatte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts "Nomadskolor" (Nomadenschulen) eingerichtet, in die samische Kinder zwangseingewiesen wurden, um angemessen "schwedisiert" werden zu können. Die erzählte Zeit des Romans sind die erste Hälfte der Fünfzigerjahre und die Achtziger.
Das Schlimmste muss die Sprachunterdrückung in diesen Schulen gewesen sein. Die Kinder wurden unter Androhung und Ausübung schwerer Prügelstrafen von ihrer Muttersprache, den vielen samischen Sprachvarianten, entfremdet. In der Gegend einiges nördlich von Kiruna, aus der sie alle kommen, hatten sie Samisch gelernt, etwas Mienkiäli (eine finnische Varianz) und Finnisch, aber nie Schwedisch. Was bei ihren weiteren Sozialisationen zu nie zu bewältigenden soziokulturellen Traumata führte. Wovon im Roman die Kapitel erzählen, die in den Achtzigerjahren spielen. Wir begegnen den Kindern in den Schulen, und wir treffen sie wieder als Erwachsene in einem Leben, das viele von ihnen als stigmatisierend empfinden und in dem sie in vielen Teilen heimatlos sind. Was sich in Alkoholismus, Unfähigkeit zu lieben, Verdrängungen aller Spielarten niederschlägt. Man hatte ihnen sogar den Joik ausgetrieben, jene spezielle samische Art zu singen, sich draußen zu verständigen und Gefühle zu äußern.
Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Rentierzüchterkinder Jon-Ante, Else-Maj, Nilsa, Marge und Anne-Risten, die mit sieben Jahren aus ihren Familien genommen wurden. Die Geborgenheit der größeren samischen Familienverbände wurde ausgetauscht gegen eiskalte Disziplinübungen bei Verbot von allem, was Freude machte. Die Prügelei der "Hausmutter" Rita Olsson, einem wirklich sadistischen Ungeheuer, führt bei manchen zu körperlichen Verletzungen, die ein Leben lang zu spüren sind. Und alle versuchen dreißig Jahre später, zu überleben und die tiefsitzenden Wunden zu heilen. Was keinem richtig gelingt. Rita Olsson taucht gegen Schluss des Romans in einem Altersheim als Pflegefall wieder auf. Nilsa konfrontiert sie dort mit ihrer Vergangenheit als Schlägerin; sie umzubringen schafft er genau so wenig wie Anne-Risten und Marge, die für das Pflegeheim arbeiten. Sie sind erschüttert von der sturen Uneinsichtigkeit der Alten; sie führt ihnen ihr eigenes Leid nochmals brutal vor Augen.
Schwedens Umgang mit dieser Minorität ist ein inzwischen auch in der dortigen Gesellschaft als schwierig und bedrückend empfundenes Thema; massive Einwirkungsversuche auf die Samen gehen jedoch bis weit zurück in die Geschichte. Schon Gustav Wasa, Begründer der schwedischen Monarchie und des Zentralstaates, ließ Maßnahmen zur Schwedisierung der Samen ergreifen. Und die Kirche war immer engagiert mit dabei.
Man könnte durch die Lektüre des Romans verführt werden, alles Schwedische in ihm als das absolute Böse zu verstehen, durch Rita Olsson handgreiflich vor Augen geführt. Doch handelt der Roman auch davon, und das macht seinen versöhnlichen Schluss aus, wie die Welten zusammenkommen können und was man tun sollte, um sich gerecht und angemessen zu begegnen.
In jedem Fall ist der Roman berührend - so bedrückend manches in ihm auch sein mag. Überhaupt nicht berührend allerdings ist der Titel der deutschen Übersetzung (der sicher nicht von den beiden sehr guten Übersetzerinnen stammt) - "Die Zeit im Sommerlicht" transportiert nur Inga Lindström und Konsorten. Aber nichts, was der Titel des Originals mitteilt. Der lautet "Straff", was soviel wie Strafe, Bestrafung heißt und die beiden Dimensionen des Buchs klarmacht: die Notwendigkeit der Bestrafung von Leuten wie Rita Olsson und die Strafe, die die Kinder erlitten und mit der sie als Erwachsene fertig werden müssen. Abgesehen davon spielt der Roman auch mehr im Winterlicht. STEFAN OPITZ
Ann-Helen Laestadius: Die Zeit im Sommerlicht". Roman.
Aus dem Schwedischen von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt. Hoffmann & Campe, Hamburg 2024. 480 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der neue Roman der 1971 geborenen Schriftstellerin, Journalistin. Kinderbuchautorin und Trägerin des August-Preises (der höchsten literarischen Auszeichnung Schwedens nach dem Nobelpreis) Ann-Helen Laestadius nimmt seine Leser mit in eine ebenso bedrückende wie berührende Geschichte in dieser Gegend. Schweden hatte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts "Nomadskolor" (Nomadenschulen) eingerichtet, in die samische Kinder zwangseingewiesen wurden, um angemessen "schwedisiert" werden zu können. Die erzählte Zeit des Romans sind die erste Hälfte der Fünfzigerjahre und die Achtziger.
Das Schlimmste muss die Sprachunterdrückung in diesen Schulen gewesen sein. Die Kinder wurden unter Androhung und Ausübung schwerer Prügelstrafen von ihrer Muttersprache, den vielen samischen Sprachvarianten, entfremdet. In der Gegend einiges nördlich von Kiruna, aus der sie alle kommen, hatten sie Samisch gelernt, etwas Mienkiäli (eine finnische Varianz) und Finnisch, aber nie Schwedisch. Was bei ihren weiteren Sozialisationen zu nie zu bewältigenden soziokulturellen Traumata führte. Wovon im Roman die Kapitel erzählen, die in den Achtzigerjahren spielen. Wir begegnen den Kindern in den Schulen, und wir treffen sie wieder als Erwachsene in einem Leben, das viele von ihnen als stigmatisierend empfinden und in dem sie in vielen Teilen heimatlos sind. Was sich in Alkoholismus, Unfähigkeit zu lieben, Verdrängungen aller Spielarten niederschlägt. Man hatte ihnen sogar den Joik ausgetrieben, jene spezielle samische Art zu singen, sich draußen zu verständigen und Gefühle zu äußern.
Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Rentierzüchterkinder Jon-Ante, Else-Maj, Nilsa, Marge und Anne-Risten, die mit sieben Jahren aus ihren Familien genommen wurden. Die Geborgenheit der größeren samischen Familienverbände wurde ausgetauscht gegen eiskalte Disziplinübungen bei Verbot von allem, was Freude machte. Die Prügelei der "Hausmutter" Rita Olsson, einem wirklich sadistischen Ungeheuer, führt bei manchen zu körperlichen Verletzungen, die ein Leben lang zu spüren sind. Und alle versuchen dreißig Jahre später, zu überleben und die tiefsitzenden Wunden zu heilen. Was keinem richtig gelingt. Rita Olsson taucht gegen Schluss des Romans in einem Altersheim als Pflegefall wieder auf. Nilsa konfrontiert sie dort mit ihrer Vergangenheit als Schlägerin; sie umzubringen schafft er genau so wenig wie Anne-Risten und Marge, die für das Pflegeheim arbeiten. Sie sind erschüttert von der sturen Uneinsichtigkeit der Alten; sie führt ihnen ihr eigenes Leid nochmals brutal vor Augen.
Schwedens Umgang mit dieser Minorität ist ein inzwischen auch in der dortigen Gesellschaft als schwierig und bedrückend empfundenes Thema; massive Einwirkungsversuche auf die Samen gehen jedoch bis weit zurück in die Geschichte. Schon Gustav Wasa, Begründer der schwedischen Monarchie und des Zentralstaates, ließ Maßnahmen zur Schwedisierung der Samen ergreifen. Und die Kirche war immer engagiert mit dabei.
Man könnte durch die Lektüre des Romans verführt werden, alles Schwedische in ihm als das absolute Böse zu verstehen, durch Rita Olsson handgreiflich vor Augen geführt. Doch handelt der Roman auch davon, und das macht seinen versöhnlichen Schluss aus, wie die Welten zusammenkommen können und was man tun sollte, um sich gerecht und angemessen zu begegnen.
In jedem Fall ist der Roman berührend - so bedrückend manches in ihm auch sein mag. Überhaupt nicht berührend allerdings ist der Titel der deutschen Übersetzung (der sicher nicht von den beiden sehr guten Übersetzerinnen stammt) - "Die Zeit im Sommerlicht" transportiert nur Inga Lindström und Konsorten. Aber nichts, was der Titel des Originals mitteilt. Der lautet "Straff", was soviel wie Strafe, Bestrafung heißt und die beiden Dimensionen des Buchs klarmacht: die Notwendigkeit der Bestrafung von Leuten wie Rita Olsson und die Strafe, die die Kinder erlitten und mit der sie als Erwachsene fertig werden müssen. Abgesehen davon spielt der Roman auch mehr im Winterlicht. STEFAN OPITZ
Ann-Helen Laestadius: Die Zeit im Sommerlicht". Roman.
Aus dem Schwedischen von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt. Hoffmann & Campe, Hamburg 2024. 480 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Die Auseinandersetzung mit dem Unrecht einer in Schweden lange marginalisierten Volksgruppe - auf einer sehr persönlichen Ebene, die einen schnell in die Handlung zieht.« Agnes Bührig NDR Kultur
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Die in Skandinavien lebenden Samen sind das letzte indigene Volk Europas, weiß Rezensent Stefan Opitz, Ann-Helén Laestadius hat einen Roman über den oftmals gewaltvollen Umgang mit ihnen geschrieben. Von den "Nomadenschulen" handelt das Buch und von den Kindern, die zwangsweise dort eingeschult wurden und denen man mit Prügel versucht, ihre Muttersprache auszutreiben, aber auch über ihr späteres Erwachsenenleben und ihr Umgang mit den Traumata wird Opitz berührend und eindringlich geschildert. Zu keinem Zeitpunkt verfällt die Autorin der Versuchung, alles Schwedische per se als schlecht darzustellen, stattdessen liest der Kritiker eine ausgewogene Auseinandersetzung, bei der ihn ausschließlich der unpassende deutsche Titel stört, für den wohl nicht die Übersetzer verantwortlich zeichnen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
In den 1950er Jahren in Schweden muss die erst siebenjährige Sámi Else-Maj ihr Zuhause sowie Familie und Freunde verlassen und wird in ein Nomadeninternat geschickt. Dort wird sie mit anderen Kindern von Rentierhirten unterrichtet, bekommt einen schwedischen Vornamen und darf ihre …
Mehr
In den 1950er Jahren in Schweden muss die erst siebenjährige Sámi Else-Maj ihr Zuhause sowie Familie und Freunde verlassen und wird in ein Nomadeninternat geschickt. Dort wird sie mit anderen Kindern von Rentierhirten unterrichtet, bekommt einen schwedischen Vornamen und darf ihre Muttersprache nicht mehr sprechen. Die furchteinflössende Hausmutter Rita Olsson führt das Internat mit eisernen Hand, Verfehlungen oder andere Ungehorsamkeiten werden strengstens bestraft. Einzig die Erzieherin Anna versucht, die Kinder zu beschützen, verschwindet jedoch eines Tages spurlos. Dreißig Jahre später taucht Anna wieder auf, bringt die Leben ihrer früheren Schützlinge durcheinander, aber auch die Chance auf Heilung der Wunden mit.
Bereits im Jahr 1909 hatte Bischof Olof Bergkvist die Idee zu einer »Lappenschule«, die dazu gegründet wurde, um die samischen Rentierhalter an die schwedische Leitkultur anzupassen. Diese grausame Vorgehensweise wurde fast fünf Jahrzehnte lang praktiziert, Kinder im Alter von sieben Jahren ihren Eltern förmlich entrissen, ihrer Muttersprache beraubt und zur Umerziehung gezwungen. Lange Zeit haben die betroffenen Familien geschwiegen, sich oft geschämt, geschuldet dem Stolz, kein Opfer gewesen zu sein. Die Mutter der Autorin war selbst auf einer Nomadenschule gewesen, dies nahm Ann-Helén Laestadius zum Anlass, darüber ihr zweites Buch für Erwachsene zu schreiben. Vieles habe sie eigener Aussage nach jedoch ausgelassen, weil manche Vorkommnisse schlicht und ergreifend zu grausam gewesen seien, um diese aufzunehmen.
Mehrere Perspektiven bemüht die Autorin, springt zwischen den Zeiten zusätzlich hin und her. Dabei sind die Erlebnisse der Kinder gleich, das Ergebnis jedoch unterschiedlich. Da wäre Marge, die sich ein Kind wünscht, und als das adoptierte Kind endlich da ist, nicht in der Lage ist, sich vernünftig um das kleine Mädchen zu kümmern. Oder Jon-Ante, am liebsten Jonne genannt, der darauf förmlich beleidigt reagiert, wenn man ihn aus Spaß mit dem verächtlichen Begriff „Lappe“ betitelt, und der nicht in der Lage war und ist, eine Beziehung mit einer Frau einzugehen. Da ist aber auch Anne-Risten, die sich Anne nennt und einen Schweden geheiratet hat, die ihre Herkunft gänzlich verleugnet, um anerkannt zu werden und damit fast ihre Identität verliert. Sie, Else-Maj und weitere Erwachsene verbinden ihre Erlebnisse in der Kindheit, gleichzeitig aber geht jeder von ihnen unterschiedlich mit den erlittenen Traumata um.
Der zweite Roman von Ann-Helén Laestadius berührte mich, auch wenn er leider an den großartigen Vorgänger »Das Leuchten der Rentiere« nicht ganz heranreicht. Das Buch ist ruhig, stellenweise zu ruhig, im Leben der beteiligten Menschen passiert einfach nicht viel. Die zurückliegenden Geschehnisse sind grausam, aber auch diese Grausamkeit nutzt sich ein wenig ab, wenn sie sich wiederholt. Die samischen Wörter und Sätze hätte ich mir dabei sofort übersetzt gewünscht, das Glossar hinten zu platzieren, hat meinem Lesefluss eher geschadet als genutzt. Letztlich hielt mich der Umstand bei der Stange, dass es um wahre Schicksale geht und dies erschütterte mich wirklich sehr. Insgesamt ein guter Roman, der durch die nüchterne Sprache ein bisschen an Authentizität einbüßt.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nachdem sich die Autorin in ihrem ersten Roman "Das Leuchten der Rentiere" mit den Problemen und der Diskriminierung schwedischer Rentierzüchter auseinandergesetzt hat, erzählt sie in ihrem zweiten Buch "Die Zeit im Sommerlicht" über die Erfahrungen samischer …
Mehr
Nachdem sich die Autorin in ihrem ersten Roman "Das Leuchten der Rentiere" mit den Problemen und der Diskriminierung schwedischer Rentierzüchter auseinandergesetzt hat, erzählt sie in ihrem zweiten Buch "Die Zeit im Sommerlicht" über die Erfahrungen samischer Kinder, die im Grundschulalter von ihren Familien und ihrer gewohnten Umgebung getrennt und in sog. Nomadenschulen (Internatsschulen) gesteckt wurden. Dort durften sie alles, was sie und ihre Kultur bisher ausgemacht haben, nicht mehr ausüben: sie durften kein Samisch sprechen, sie mussten stattdessen Schwedisch lernen; ihre samischen Namen wurden in schwedische Namen umgewandelt; ihr Jojk - der traditionelle samische Gesang - wurde verboten und galt als Sünde.
So begleiten wir die Kinder Else-Maj, Jon-Ante, Anne-Risten, Marge und Nilsa Anfang der 50er Jahre durch ihre Schulzeit, die durch die "Schreckensherrschaft" der Hausmutter Rita Olsson noch verschlimmert wurde. Diese übte körperliche und psychische Gewalt an den Kindern aus. Wer nicht gehorchte, wurde verprügelt und körperlich misshandelt. Die bedrückende Stimmung, die durch die Angst, Wut, Verzweiflung und Trauer in dem Internat herrschte, war beim Lesen spürbar und hat mir die Kehle zugeschnürt. Wie oft hätte ich Rita Olsson gern geschüttelt und ihr all das angetan, was sie mit den Kindern getan hat. Bei all diesen negativen Erfahrungen ist es nicht überraschend, dass diese Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben.
30 Jahre später erhalten wir einen Einblick in das Erwachsenenleben von Else-Maj, Jon-Ante, Anne-Risten, Marge und Nilsa. Was ist aus ihnen geworden? Wie haben sie die Erfahrungen in der Nomadenschule verarbeitet? Konnten sie dies überhaupt?
Nach Angaben der Autorin erzählt sie zwar eine fiktive Geschichte, die aber auf realen Gegebenheiten beruht. Dabei konnte sie auf die Erfahrungen, Berichte und Unterstützung ihrer Mutter zurückgreifen. Auch in ihrer Familie wurde die schreckliche Zeit in der Nomadenschule und die damit verbundenen Geschehnisse totgeschwiegen.
Ein spannender und eindringlich erzählter Roman über die Samen, den ich sehr gern weiterempfehle!
Nur die deutsche Übersetzung des Titels - auf Schwedisch heißt das Buch "Straff" (Strafe) - ist wie schon beim ersten Roman unpassend und nicht dem Thema entsprechend gewählt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Das Schicksal der Kinder
In den 50iger Jahren werden viele Sami-Kinder aus ihrer gewohnten ruhigen Umgebung gerissen und in Internate gesteckt. Hier sollen sie nicht nur ihre Sprache verleugnen, sondern ihre ganze Kultur und Herkunft in Frage stellen. Diese Geschichte befasst sich mit den …
Mehr
Das Schicksal der Kinder
In den 50iger Jahren werden viele Sami-Kinder aus ihrer gewohnten ruhigen Umgebung gerissen und in Internate gesteckt. Hier sollen sie nicht nur ihre Sprache verleugnen, sondern ihre ganze Kultur und Herkunft in Frage stellen. Diese Geschichte befasst sich mit den Schicksalen von einigen dieser Kinder. Die Autorin erzählt in eindringlichen aber ruhigen Worten von dem damaligen Geschehen. Die Kinder erleben Ablehnung, ja sogar Hass, Gewalt und noch viele schlimme Dinge, die sie einfach auszuhalten lernen müssen. Ein Buch das zum Nachdenken, zu Tolleranz und zum Umdenken anregt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Jon-Ante, Else-Maj, Anne-Risten, Marge und viele andere samische Kinder mussten schon mit sieben Jahren ihr Elternhaus verlassen. Sie wurden ins Internat der Nomadenschule gezwungen, wo sie nicht mehr samisch reden durften und schwedische Namen verpasst bekamen. Und wo Hausmutter ein …
Mehr
Jon-Ante, Else-Maj, Anne-Risten, Marge und viele andere samische Kinder mussten schon mit sieben Jahren ihr Elternhaus verlassen. Sie wurden ins Internat der Nomadenschule gezwungen, wo sie nicht mehr samisch reden durften und schwedische Namen verpasst bekamen. Und wo Hausmutter ein überstrenges Regiment geführt hat. Schläge gehörten zur Tagesordnung genauso wie seelische Gewalt. Einziger Lichtblick für die Kinder war bei Betreuerin Anna, die tröstende Worte und Umarmungen in aller Heimlichkeit für sie hatte.
Ann-Helén Laestadius hat eine traurige Beziehung zu diesem Roman, denn auch ihre Mutter musste diese Schule besuchen. Nach ihren Erlebnissen ist dieser Roman entstanden.
Die Autorin erzählt diese Geschichte aus der Sicht der verschiedenen Kinder und lässt uns gleichzeitig teilhaben, an ihrem Erwachsenenleben. Wir lesen parallel von ihren Traumata in der Schule und wie diese ihren Alltag später beeinflussten. Wir lesen vom Versuch, das Erlebte zu Verdrängen, im Alkohol zu ertränken oder mit Schmerztabletten zu betäuben. Nur reden wollen sie alle nicht darüber, dann das würde die Dinge zu sehr aufrühren.
Manche der Kinder tragen ein lebenslanges Zeichen mit sich. Die Narben am Körper verschwinden nicht und erinnern für immer an die Gewalt. Dennoch schaffen es die meisten ein gutes Leben zu führen, ihren Kindern gute Eltern zu sein und zu lieben, auch wenn manche von ihnen länger dafür brauchen.
Beim Begräbnis von Anna kommen sie alle wieder zusammen und erste Mauern beginnen zu bröckeln. Die erwachsenen Schüler und Schülerinnen der Nomadenschule beginnen in Worte zu fassen, was ihre Leben so lange beschwert hat. Somit ist das Buch auch eine Ode an die Resilienz!
Ich fand dieses Buch hervorragend erzählt. Die wechselnden Perspektiven halten die Geschichte abwechslungsreich und spannend und es hat mich beeindruckt, wie viel manche Menschen tragen können. Über das traurige Schicksal der samischen Bevölkerung habe ich schon öfter gelesen und immer wieder macht es mich traurig, wie viel dieses beeindruckende Volk zu erleiden hatte. Leider begegnen sie wohl noch immer Rassismus und Ablehnung, dabei sollten wir von den Traditionen dieses naturverbundenen Volkes lernen.
Von mir gibt es eine uneingeschränkte Leseempfehlung für dieses Buch, dass auch irgendwie die Geschichte der Mutter der Autorin erzählt und die bestimmt viel Mut brauchte, um ihre Tochter in ihre Erlebnisse einzuweihen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Ann-Helén Laestadius’ aktueller Roman ‚Die Zeit im Sommerlicht’ ist wieder im Umfeld der Sami angesiedelt, im hohen Norden Skandinaviens. Er behandelt ein besonders unrühmliches Kapitel der schwedischen Geschichte. In den 50er Jahren wurden Kinder der Sami im …
Mehr
Ann-Helén Laestadius’ aktueller Roman ‚Die Zeit im Sommerlicht’ ist wieder im Umfeld der Sami angesiedelt, im hohen Norden Skandinaviens. Er behandelt ein besonders unrühmliches Kapitel der schwedischen Geschichte. In den 50er Jahren wurden Kinder der Sami im Grundschulalter in sogenannte Nomadenschulen geschickt, ein geschönter Name für Umerziehungsheime, in denen die Kinder im Grundschulalter ihrem familiären Umfeld entrissen wurden, um ihnen ihre samische Kultur abzuerziehen. Sie werden als ‚Lappen‘ beschimpft, Ihre samische Muttersprache wird ihnen ebenso verboten wie das Joiken, die Hausmutter schreckt dabei nicht vor physischer und psychischer Gewalt zurück.
Im Roman stehen 5 Kinder im Mittelpunkt, deren Geschichte in zwei ineinander verwobenen Zeitschienen erzählt wird, zum einen aus der Kindheit in der Mitte der 50er Jahre, sowie 30 später im Erwachsenenalter. Alle eint das Trauma, das sie seit ihrer Kindheit mit sich tragen, da sie nie die Gelegenheit bekommen haben, die Erlebnisse zu verarbeiten. Die meisten versuchen, ihre dunklen Erinnerungen zu vergessen und vermeiden es, über ihre Vergangenheit zu sprechen.
Man spürt in dem Roman, wie sehr das Thema die Autorin am Herzen liegt, sie schildert sehr eindringlich, wie sehr die Unterdrückungen und Misshandlungen aus der Zeit in der Nomadenschule die Protagonisten auch nach 30 Jahren noch in ihrem Alltag belasten. Dabei schlagen sie sehr unterschiedliche Wege ein, einige kehren zu ihren Traditionen zurück, andere verleugnen ihre samischen Wurzeln. Ihre innerlichen Qualen und Selbstzweifel sind mir beim Lesen ebenso nahe gegangen wie die unfassbaren Misshandlungen in der Nomadenschule.
Mich hat die Geschichte sehr berührt, wie schon in Ann-Helén Laestadius Roman ‚Das Leuchten der Rentiere‘ und anderen Geschichten aus dem Umfeld der Sami ist es auch hier wieder kaum begreiflich, wie die Sami seit vielen Jahren diskriminiert und ihrer Traditionen beraubt wurden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Mein Lese-Eindruck:
Fünf samische Kinder sind es, die die ebenfalls samische Autorin uns vorstellt. Fünf Kinder im Grundschulalter, die ihren Familien entzogen werden und in sog. Umerziehungsschulen zu Schweden geformt werden sollen. Eine harte Zeit! Ihre Muttersprache wird ihnen …
Mehr
Mein Lese-Eindruck:
Fünf samische Kinder sind es, die die ebenfalls samische Autorin uns vorstellt. Fünf Kinder im Grundschulalter, die ihren Familien entzogen werden und in sog. Umerziehungsschulen zu Schweden geformt werden sollen. Eine harte Zeit! Ihre Muttersprache wird ihnen verboten, ihr traditioneller Gesang, das Joiken, wird als Sünde bezeichnet, ihre samischen Namen werden geändert, kurz: sie werden ihrer Kultur, ihrer Familie und ihrer Identität entfremdet. Dazu müssen sie mit der Verachtung der Lehrer klarkommen, die sie verächtlich als Lappen bezeichnen, und vor allem sind sie der Grausamkeit der Heimleiterin ausgesetzt. Ebenso hilflos stehen sie einer Bande älterer samischer Jungen gegenüber, die die erlittenen Grausamkeiten ungefiltert an die Jüngeren weitergeben.
Der Autorin geht es aber nicht nur darum, das Unrecht dieser Nomadenschulen zu zeigen, sondern es geht ihr vielmehr um die Folgen dieser Maßnahmen. Und daher springt sie immer wieder von den 50er in die 80er Jahre hinein und zeigt die Folgen. Die Kinder, inzwischen Erwachsene, sind sichtlich traumatisiert. Alkoholismus, Medikamentensucht, Gewalttätigkeit, Anpassung, Verleugnung der Ethnie, Landflucht, Hypochondrie, Bindungsangst, Einsamkeit, Sinnsuche bei der Erweckungsbewegung der Laestadianer, aber auch Verdrängung und übersteigerte Anpassung an die schwedische Umgebung: die Zöglinge der Nomadenschulen sind für ihr Leben gezeichnet, und nicht jedem gelingt ein zufriedenes Leben. Allen gemeinsam ist das Verschweigen ihrer Erlebnisse.
Die Autorin wirft nur einzelne Schlaglichter und erzählt in Episoden, und das Füllen der Zwischenräume bleibt dem Leser überlassen. Und so erfährt er eher am Rande von den Schädelvermessungen der 20er Jahre, von den aktuellen Problemen der Rentierzüchter, vom nach wie vor virulenten Rassismus und der Ausgrenzung der Samen. Laestadius erzählt das alles in einer eher spröden Sprache, und ihr Roman weist (leider) einige Längen auf, aber trotzdem entstehen hier sehr eindringliche Lebensbilder, und die seelische Not vor allem der Kinder ist berührend.
Wer die Romane von Richard Wagamese und Zeitungsberichte über die Residential Schools in Kanada gelesen hat, kennt das unmenschliche System solcher Umerziehungsanstalten. Aber bislang war mir unbekannt, dass es solche Anstalten auch für die Samen, das letzte und einzige indigene Volk Europas, gegeben hat.
Laestadius hält der schwedischen Gesellschaft selbstbewusst einen Spiegel vor, ohne aber in Schwarz-Weiß-Malerei zu verfallen.
Lesenswert!!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ann-Helén Laestadius ist mit "Die Zeit im Sommerlicht" ein zutiefst berührender und zugleich schonungsloser Roman gelungen. In eindringlicher Sprache erzählt sie von der Unterdrückung der samischen Bevölkerung in Schweden – einem düsteren Kapitel, das …
Mehr
Ann-Helén Laestadius ist mit "Die Zeit im Sommerlicht" ein zutiefst berührender und zugleich schonungsloser Roman gelungen. In eindringlicher Sprache erzählt sie von der Unterdrückung der samischen Bevölkerung in Schweden – einem düsteren Kapitel, das viel zu lange im Verborgenen lag.
Besonders erschütternd ist die Schilderung der sogenannten Nomadenschulen, in die Kinder samischer Familien bis in die 1960er Jahre zwangsweise geschickt wurden. Auch die Mutter der Autorin war davon betroffen. Fern von ihren Familien waren die Kinder völlig ausgeliefert und litten unter psychischem und physischem Missbrauch durch das Lehrpersonal. Das Sprechen der eigenen Sprache war verboten, das traditionelle Joiken – der samische Gesang – wurde als „Teufelswerk“ diffamiert.
Laestadius lässt fünf Kinder zu Wort kommen, deren Perspektiven sich kapitelweise abwechseln – sowohl in ihrer Kindheit in den 1950ern als auch rund 30 Jahre später. So entfaltet sich ein vielstimmiges, berührendes Bild davon, welche Spuren diese traumatischen Erfahrungen in ihrem späteren Leben hinterlassen haben. Zugegeben: Die vielen Perspektivwechsel fordern zu Beginn ein wenig Geduld, ich tat mich anfangs etwas schwer, den Überblick über die handelnden Personen zu behalten. Doch wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt.
Die Sprache des Romans ist direkt und schnörkellos – und trifft mitten ins Herz. Besonders hervorheben möchte ich die sehr gelungene Übersetzung von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt. Auch das angefügte Glossar mit samischen Begriffen ist eine wertvolle Ergänzung und lädt dazu ein, tiefer in die samische Kultur einzutauchen.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt der deutsche Titel. "Die Zeit im Sommerlicht" klingt poetisch, verfehlt aber die Härte und Klarheit des schwedischen Originaltitels "Straff" – was übersetzt „Bestrafung“ bedeutet. Ein passenderes Wort für das, was den Kindern angetan wurde, hätte man kaum wählen können.
Immer wieder habe ich mich beim Lesen gefragt: Warum empfand der schwedische Staat die samische Kultur samt ihrer nomadischen Lebensweise als so bedrohlich, dass man sie als minderwertig brandmarkte und systematisch auslöschen wollte? Die Antwort darauf bleibt offen, doch das Buch gibt wichtige Impulse zum Nachdenken.
Zum Glück hat sich seitdem Vieles verändert, und eines der letzten indigenen Völker Europas findet zunehmend zu seinen Wurzeln zurück. Doch das Unrecht, das geschah, darf nicht in Vergessenheit geraten. "Die Zeit im Sommerlicht" ist ein bedeutendes literarisches Werk gegen das kollektive Vergessen – und darüber hinaus eine wunderbare Gelegenheit, sich der reichen und stolzen Kultur der Samen anzunähern.
Ein unbedingt lesenswerter Roman. Bewegend, aufrüttelnd und wichtig.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Vor einiger Zeit habe ich eine Reportage über das Volk der Samen gesehen, und so hat mich die Beschreibung des Romans "Die Zeit im Sommerlicht" sofort interessiert. Sehr gefühlvoll erzählt Ann-Helen Laestadius, selbst Samin, anhand der Protagonist*innen Else-Maj, …
Mehr
Vor einiger Zeit habe ich eine Reportage über das Volk der Samen gesehen, und so hat mich die Beschreibung des Romans "Die Zeit im Sommerlicht" sofort interessiert. Sehr gefühlvoll erzählt Ann-Helen Laestadius, selbst Samin, anhand der Protagonist*innen Else-Maj, Marge, Jon-Ante, Nilsa und Ann-Risten von den Nomadenschulen und den lebenslangen psychischen und auch körperlichen Folgen, an denen die ehemaligen Schüler und Schülerinnen dieser Einrichtungen litten. Bis in die 1960er Jahre hinein mussten Kinder samischer Rentierzüchter gesonderte Nomadenschulen besuchen, auf denen sie nur nach vereinfachtem Lehrplan unterrichtet wurden und wo Ihnen die samische Sprache und Kultur verboten war. Die Personen des Romans sind fiktiv, doch die Autorin schreibt in ihrem Nachwort, dass ihre Mutter noch eine solche Schule besuchen musste und die erzählte Geschichten auf realen Begebenheiten beruhen. Demnach waren die Kinder auf den Internaten der Nomadenschulen systematischer Diskriminierung, Rassismus, Willkür und körperlicher Gewalt ausgesetzt.
Der Roman springt immer wieder zwischen zwei Zeitebenen hin und her: In den frühen 50er Jahren begleitet er die noch jungen Protagonist*innen auf die Nomadenschule, und 1985/1986 zeigt er das Leben der inzwischen ca. 40jährigen Erwachsenen und ihrer Familien. Die Erfahrungen der Schulzeit haben bei allen tiefe Spuren hinterlassen, wirken bis in die nächste Generation hinein, und jede*r versucht auf seine eigene Weise damit umzugehen. In jedem der 54 Kapitel steht eine/einer der fünf Protagonist*innen im Mittelpunkt, und wir erleben die Geschehnisse aus seiner bzw. ihrer Sicht. Besonders ans Herz gewachsen sind mir hier Marge und Jon-Ante. Mit viel Liebe beschreibt die Autorin den Familienzusammenhalt der Samen und die tiefe Zuneigung zwischen Eltern, Großeltern und Geschwistern, die ohne große Worte auskommt. Ebenso deutlich wird, welch hohen Stellenwert die Rentiere nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional und kulturell für die Samen haben. Die Bedrohung des Lebensraums der Rentiere durch Bergbau, Forstwirtschaft, Tourismus und Umweltverschmutzung ist daher für die Samen von existenzieller Bedeutung und klingt auch im Roman immer wieder an. So führt Jon-Antes Tätigkeit als Bergmann zu innerfamiliären Diskussionen, und auch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wird thematisiert.
Der Schreibstil des Romans hat mir sehr gut gefallen. Er ist voller Wärme und Zuneigung für die Figuren und das Volk der Samen, und dabei gleichzeitig klar und direkt. Deutlich spürbar ist die Kritik an den Verantwortlichen der Nomadenschulen und der schwedischen Kirche, die Trägerin der Schulen war. Das Schicksal der Kinder hat mich sehr bewegt, und die Misshandlungen der Kinder erinnern an ähnliche Berichte aus Kinderheimen und Internaten auch in Deutschland. Es macht mich immer wieder sprachlos, mit welcher Gefühlskälte sogenanntes pädagogisches Personal den Kindern begegnet ist.
Ein sehr lesenswertes Buch, das die Minderheit der Samen und ihre systematische Unterdrückung in den skandinavischen Ländern bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts in den Mittelpunkt rückt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Berührend und aufklärend zugleich
Ich bin in den 60er Jahren im tiefsten Mecklenburg aufgewachsen und Leute die damals noch Plattdeutsch sprachen, wurden immer seltener. An die Jugend wurde diese Sprache, ja es handelt sich beim Plattdeutschen wirklich um eine eigenständige …
Mehr
Berührend und aufklärend zugleich
Ich bin in den 60er Jahren im tiefsten Mecklenburg aufgewachsen und Leute die damals noch Plattdeutsch sprachen, wurden immer seltener. An die Jugend wurde diese Sprache, ja es handelt sich beim Plattdeutschen wirklich um eine eigenständige Sprache, nicht weitergegeben, es war offiziell nicht erwünscht. Daran musste ich denken, als ich diesen Roman zu lesen begann.
Ann-Helén Laestadius führt mich zurück in die 50er Jahre zu den Samen in Nordschweden. Die Samen waren ursprünglich ein Nomadenvolk. Mit Druck und Repressalien bekämpfte Schweden das Volk der Samen. Am Beispiel der kleinen Else-Maj muss ich miterleben wie sie ihre Familie verlassen muss und in ein Internat kommt. Sie wird ihrer Sprache beraubt, ebenso ihrer Sitten und Bräuche.
Das harte Leben im Internat beschreibt Ann-Helén Laestadius ebenso hart und menschenunwürdig wie die Kinder es erlebt haben und ich frage mich, wie dies in jener Zeit so noch möglich war, aber die Samen gehörten halt zu einer Minderheit für die sich scheinbar niemand interessierte.
Sehr schön finde ich, das Ann-Helén Laestadius von Anfang an zweigleisig fährt. Ich bin hautnah dabei und erleide gemeinsam mit Else-Maj das Internatsleben und werde von jeder ihrer vielen im Internat geweinten Tränen berührt und im Wechsel dazu erzählt die Autorin wie die Heldin und ihre ehemaligen Schulfreunde 30 Jahre später im Leben zurechtkommen.
Ein unheimlich berührender Roman der erzählt werden musste, weil er mit einer Geschichte bekannt macht, die nicht in Vergessenheit geraten und sich auch nicht wiederholen darf. Vielen Dank Ann-Helén Laestadius.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Mir war nach dem Klappentext klar, dass dies hier keine Wohlfühllektüre wird, aber ich muss sagen Holla die Waldfee, hier ist viel Schmerz und Brutalität enthalten. Das Cover und der Titel lassen auf eine leichtere Lektüre schließen, besonders mit diesem Bild was nach so …
Mehr
Mir war nach dem Klappentext klar, dass dies hier keine Wohlfühllektüre wird, aber ich muss sagen Holla die Waldfee, hier ist viel Schmerz und Brutalität enthalten. Das Cover und der Titel lassen auf eine leichtere Lektüre schließen, besonders mit diesem Bild was nach so viel Hoffnung schreit. Auch der Titel ist aus meiner Sicht nicht so gut gewählt, heißt es auf Schwedisch im Original „Straff“ übersetzt Strafe. Das passt um Längen besser.
Denn dies hier ist ein Roman über die Unterdrückung der samischen Minderheit in Schweden und wie mit dem nomadisch lebenden Volk, das Renntiere züchtet, umgegangen wurde. Das Buch hat zwei zeitliche Ebenen. Zum einen spielt es in den 50er Jahren und wir lernen in Summe fünf Kinder kennen, die in eine Nomadenschule kommen, ein Internat. Klein sind sie alle, grade mal 7 Jahre alt. Dort sind sie physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt und ertragen viel. Zu viel. Brutal geht es zu. Es ist keine Schule, es ist im Grunde ein Umerziehungslager, sie dürfen nur noch Schwedisch sprechen und wenn die tyrannische Leiterin ungehorsam wittert gibt es Schläge.
Der Sprung in die 80er Jahre macht deutlich mit was für Traumata die nun Erwachsenen sich plagen, Suchtverhalten entwickeln, Emotionen nicht zulassen und vieles mehr. Wirklich beklemmend ist das Gefühl bei der Lektüre.
Auch wenn die Lage etwas anders ist, musste ich an die Kanadischen Indigenen Völker denken, deren Kinder auch viel Unrecht angetan wurde. Und hier erinnere ich mich auch plastisch an: Richard Wagamese mit „Der gefrorene Himmel“.
Ein Roman, der in Schweden eine Diskussion entfacht hat und lange auf deren Bestsellerliste stand. Ein Roman der einen blinden Fleck der Geschichte in den Fokus nimmt. Ungeschönt erzählt von Ann-Helén Laestadius, eine Halb-Samin, die durch das tiefe Schweigen der eigenen Familie hier Aufarbeitung betrieben hat und dem Thema Raum gibt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für