BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 162 Bewertungen| Bewertung vom 19.09.2024 | ||

|
Annis, die Ich-Erzählerin, wird in der Sklaverei geboren. Ihre Mutter hält die Erinnerungen an ihre Herkunft aus einer afrikanischen Kriegerinnen-Familie in Dahomey lebendig, und die Erinnerung v. a. an ihre Großmutter Aza bedeuten für Annis die Sicherung ihrer eigenen Identität, geben ihr Selbstbewusstsein und auch das Vermögen, ihre jetzige Lage zu ertragen. Der Verkauf ihrer Mutter löst bei ihr eine Trauerphase aus, die mit hoher Empathie und in eindrücklichen, fast lyrischen Bildern erzählt wird. |
|
| Bewertung vom 08.09.2024 | ||

|
Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 29.08.2024 | ||
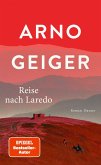
|
„In jedem Menschen steckt ein zurückgetretener König.“ |
|
| Bewertung vom 26.08.2024 | ||
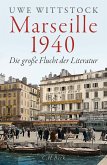
|
Man muss sich wundern: Wurde bisher tatsächlich der Fluchthelfer Varian Fry in der deutschen Geschichte so gut wie vergessen? Wittstock ruft mit seinem Buch nicht nur diesen mutigen und engagierten Journalisten in die Erinnerung zurück, sondern auch die unmenschlichen Zustände, denen die Kulturelite Deutschland auf der Flucht vor den Nationalsozialisten ausgesetzt war. Marseille 1940 ist ein markantes Eckdatum, denn hier sammeln sich die Unerwünschten und „Entarteten“, die zunächst ins sicher geglaubte Frankreich (sehr beliebt: Sanary-sur-Mer) geflohen waren und sich dann von der heranrückenden Wehrmacht in Marseille sammelten in der Hoffnung auf Ausreise. |
|
| Bewertung vom 21.08.2024 | ||

|
Das Haus in dem Gudelia stirbt Im Mittelpunkt des Romans steht Gudelia, und sie steckt in einer Situation, die dem Hochwasser-Unglück an der Ahr im Jahre 2021 nachgebildet wurde. Aus Gudelias Leben werden drei Jahre herausgegriffen: das Jahr 1984, in dem sie Tod ihres Sohnes Nico hinnehmen muss, dann das Jahr 1998, in dem sie ihren alkoholkranken Mann dazu bewegen kann, ihr das Haus zu überschreiben, und schließlich 2024, das Jahr des Hochwassers. Ihr Haus ist unterspült und einsturzgefährdet, aber sie weigert sich beharrlich, das Haus zu verlassen. |
|
| Bewertung vom 18.08.2024 | ||
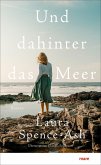
|
Mein Hör- und Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 18.08.2024 | ||
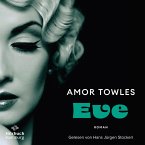
|
30er Jahre. Ein Mann und eine Frau im Zug nach Los Angeles: Charlie, eher alt, ein ehemaliger Polizist, und Eve, die durch eine große Narbe im Gesicht auffällt und nicht viel von sich preisgibt. In Los Angeles verlieren sich die Beiden aus den Augen, und auch der Leser muss zunächst auf sie verzichten. |
|
| Bewertung vom 11.08.2024 | ||
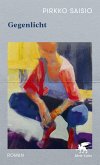
|
Pirkko ist 19 Jahre jung und hat Träume. Gerade hat sie ihr Abitur gemacht und will die Welt sehen, v. a. ihr Traumland Schweiz. Und da macht sie ihre ersten Gegenlicht-Erfahrungen: die Schweiz mag durchaus ein Gegenentwurf zu Finnland sein, aber ein Traumland ist sie nicht. Frauen dürfen hier nicht wählen, die Schulbücher erzählen dummes Zeug über die Finnen, und den Nationalstolz der Schweizer empfindet sie als arrogant. |
|
| Bewertung vom 04.08.2024 | ||
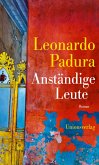
|
Krimi? Das ist dieser Roman nur vordergründig. Er erzählt vom kubanischen Lebensgefühl, der Geschichte der Insel und der kubanischen Gesellschaft, die durch extreme Gegensätze gespalten wird und die vor allem geprägt ist von der Unterdrückung durch Diktatoren und ihre korrupten Nutznießer. Sehr eingängig zeigt Padura auf, dass man die Gegenwart nur versteht, wenn man die Vergangenheit kennt und wie die Gegenwart immer bestimmt wird von der Vergangenheit. |
|
| Bewertung vom 23.07.2024 | ||
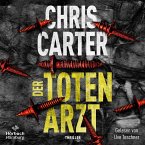
|
Der Totenarzt / Detective Robert Hunter Bd.13 (2 CDs) Ein Mord, der als Selbstmord bzw. als Unfall getarnt wird – das ist vielleicht keine neue Idee für einen Krimi, aber auf alle Fälle ein Ausgangspunkt, der funktioniert. Chris Carter nutzt die Möglichkeiten sehr geschickt aus, wenn er beschreibt, wie sich das Ermittlerduo dem Mörder anhand von kleinsten Indizien und einem glücklichen Zufall annähert. Hier erzählt ein Profi, der weiß, wie man Spannung aufbaut und wie man seine Leser mitnimmt. Seine Erzählung ist immer fokussiert, die Dialoge sind gekonnt ausgebaut, und die meisten Kapitel schließen mit einem effektvollen Cliffhanger. Dazu nutzt er die Möglichkeiten des Perspektivenwechsel, wenn er abwechselnd die Jäger und das Opfer des Gejagten sprechen lässt und damit seinen Leser immer nahe am Geschehen hält. |
|