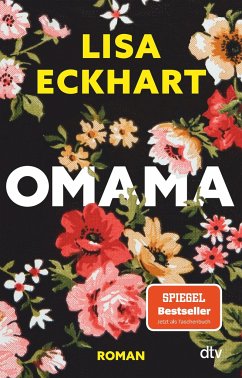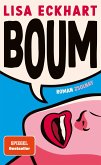Bitterbös-witzig, schonungslos und rabenschwarz
»Von Zeit zu Zeit sehe ich die Alte gern.« »Die Alte«, das ist Lisa Eckharts Oma Helga, die während der Nachkriegszeit in der tiefsten österreichischen Provinz aufwächst, die den Dorfwirt heiraten soll, die sich als Köchin und schließlich als Schmugglerin durchschlägt, die keine Tabus kennt und ihre Macken hat. Sowohl die konservative Dorfgemeinschaft als auch die Großmutter werden gnadenlos unter die Lupe genommen und wortgewaltig analysiert. Dennoch: Die Enkelin liebt und schätzt ihre Omama, sogar dann, als die beiden beim Buhlen um die Gunst eines attraktiven Kreuzfahrtkapitäns plötzlich zu Rivalinnen werden.
»Von Zeit zu Zeit sehe ich die Alte gern.« »Die Alte«, das ist Lisa Eckharts Oma Helga, die während der Nachkriegszeit in der tiefsten österreichischen Provinz aufwächst, die den Dorfwirt heiraten soll, die sich als Köchin und schließlich als Schmugglerin durchschlägt, die keine Tabus kennt und ihre Macken hat. Sowohl die konservative Dorfgemeinschaft als auch die Großmutter werden gnadenlos unter die Lupe genommen und wortgewaltig analysiert. Dennoch: Die Enkelin liebt und schätzt ihre Omama, sogar dann, als die beiden beim Buhlen um die Gunst eines attraktiven Kreuzfahrtkapitäns plötzlich zu Rivalinnen werden.
Der schwarze, hübsch gedrechselte Wiener Humor der Kabarettistin Lisa Eckhart durchzieht auch ihren Roman 'Omama'. Sebastian Loskant Nordsee-Zeitung 20211213
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Für Rezensent Adam Soboczynski geht es ein bisschen zu deutlich zu in Lisa Eckharts Oma-Geschichte. Vom Krieg, als die Russen in die Steiermark kamen, von Großmutterpsychologie, Österreichs Minderwertigkeitskomplexen, Schlachtfesten und Saufgelagen in der Provinz erzählt die Autorin "kalorienreich", "fäkalfreudig", allzu pointenlastig und mit einem mächtigen Schuss Lebensweisheit, meint der Rezensent. Auf der Strecke bleiben für ihn leider: differenzierte Figuren und entscheidende Handlungsdetails. Die dauernde Leseransprache nervt Soboczynski (wie "schon bei Doderer"), und die Moral von der Geschicht' scheint ihm "etwas überdeutlich".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Skandal um die Kabarettistin Lisa Eckhart. Jetzt kommt auch noch ihr Roman. Wie liest sich der?
„Lisa Eckhart muss sterben.“ Schmissiger Satz. Er kommt, natürlich, von Eckhart selbst, gesprochen gegenüber dem Spiegel und will sagen, dass die Kabarettistin, die Bühnenfigur also, demnächst der Schriftstellerin zu weichen hat. Wenn das wirklich passiert, hieße es: Abschiedstour mit Ende zwanzig. Neubeginn spätestens Anfang 30. Bis dahin Karenzzeit, in der die Kabarettistin noch die Zigaretten verdient, die die Schriftstellerin rauchen kann.
Zur Kunstfigur, der versace-gewandeten, gerade wieder etwas umstritteneren Kältekammer von einem Charakter, und der realen Person, die mit Nachnamen etwas anders heißt und vermutlich auch ein wenig anders auf die Welt blickt, wenn womöglich auch nicht sehr, gibt es nun also noch eine dritte Persona: die Autorin.
Die Autorin, so soll man Eckhart wohl verstehen, lebt ausschließlich in ihrem Werk – frei vom Schmutz und dem Gezeter der realen Welt. Frei damit auch von den Rassismus- und Antisemitismus-Vorwürfen, die man der Kabarettistin gerade macht. Die Trennung ist natürlich Unfug. Aber sie hätte viel Schönes, weil man das literarische Werk damit abseits vom Buhei um seine Schöpferin betrachten und als das sehen könnte, was es ist: überflüssig.
Wobei man festhalten muss, dass die Autorin Eckhart immerhin weniger von der Provokation lebt als die Kabarettistin. Sie, respektive die Erzählerin ihres Romans, hat stattdessen eine Oma, Helga, die in nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Jugend durchlebt. Helga ist das Zentrum des Debüts, was „Omama“ tatsächlich zu einem latent feministischen Roman macht. Es reden und handeln fast nur Frauen. Die Männer sind in Summe leidenschaftlich arbeitslos, blödgesoffen und nutzlos. Oder wie es da heißt: „Jede Mutter ist alleinerziehend. Insbesondere die mit Mann.“
Und das wäre denn auch einer der sehr vielen, sehr schmissigen Sätze, die das Buch – einem Battle-Rap-Song gar nicht unähnlich – durchziehen: „Die Mutter würde ihrem Kind wohl auch den Muttermord verzeihen, wäre sie dazu noch imstande.“ Oder: „Womöglich hat man hier sogar das famose Problem um Henne und Ei. Was war zuerst da? Der Deutsche oder der Hass auf den Deutschen?“ Menschen haben eine Nase „wie ein Aktienkurs, für den es sich lohnt, aus dem Fenster zu springen.“ Und in Wirtshäusern liegen „keine Zeitungen aus, weil eh jeder weiß, dass der Ausländer schuld ist.“
Ein-Satz-Milieustudien. Die kann Eckhart sehr, sehr gut. Auch im Buch. Da ist zwischen den Punchlines aber leider sehr viel Text. Text, der keine Geschichte erzählt. „Helga, schnell, die Russen kommen!“, hebt die fehlende Geschichte also an, und soll von dort aus wohl so etwas wie eine Groteske werden: Helga, die Oma mit der Aktienkurs-Nase, soll sich nämlich so auf dem Bett drapieren, dass der nahende Russe sie sieht und nicht ihre Schwester, die schöne, aber wirklich heillos dumme Inge, die sich unter dem Bett versteckt. Die hässliche Helga sitzt da also und „winkt und zwinkert, dass er der Sau graust“, und die dumme Inge verrät sich mit ihrem Genieße. Und trotzdem wird niemand vom Russen „durchfaschiert“, worüber alle dann doch ein bisschen traurig sind. Es folgen Landverschickung und unterschiedlich grausige Aushilfsjobs, mit denen die Schwestern die Schulden der Eltern abarbeiten müssen.
Und es folgen, leider, immer wieder traktathafte Zwischensequenzen, in denen Eckhart nicht mehr erzählt, sondern welterklärt. Und immer, wenn sie das tut, scheint plötzlich die Kabarettistin zu übernehmen, mit ihrem gestelzten Wesen und ihren Lexikon-Fremdwörtern, mit ihrer aggressiven Künstlichkeit und den Plastik-Extension-Sprachpirouetten. Von ihr selbst rezitiert funktioniert das. Auch, weil Eckhart neben anderem eine sehr unterschätzte Schauspielerin ist. Geschrieben liest sich die simple Information, Stuhlgang sei bereits direkt nach der Geburt nicht das Ihre gewesen, so: „Offenbar sah ich nicht ein, von der ausreichend unwürdigen Existenz eines uteralen Mitessers sogleich mit der nächsten Unzumutbarkeit des menschlichen Daseins konfrontiert zu werden – jener, fortan täglich zu koten, die herrlichsten Speisen zu Stuhl zu entstellen und in Scham zurückgezogen aus meinem Leib zu exorzieren.“ Sie schreibt dann nicht mehr, die Leute würden darum bitten, das Gesagte nicht weiterzutratschen. Sie schreibt „Das Proömium der Heimlichkeit, in welchem an Diskretion appelliert wird, hat einen reichlich inflationären Gebrauch zu beklagen.“
Ein Proömium ist übrigens, der Duden weiß das, „eine kleinere Hymne, die von den altgriechischen Rhapsoden vor einem großen Epos vorgetragen wurde“. Hieße hier womöglich: Das nächste große Ding kommt jetzt dann erst. Was gut möglich ist. Auf Twitter hat sich gerade die österreichische Autorin Stefanie Sargnagel gemeldet. Sie fände „nicht alle witze von der eckhart schlecht“, schreibt sie da, in Kleinbuchstaben. „z.b. der, den sie bei mir gefladert hat, der is schon ganz witzig.“ Darunter eine Zitatkachel, mit dem vermeintlich gestohlenen Kalauer: „Fast Food: Das ist keine Ernährung, sondern Ritzen von innen.“ Kein ganz naheliegender Witz. Unwahrscheinlich jedenfalls, dass zwei Menschen ihn sich unabhängig voneinander wortgleich ausdenken.
JAKOB BIAZZA
Lisa Eckhart: Omama. Roman. Zsolnay, Wien 2020. 384 Seiten, 24 Euro.
Zu trennen: Kunstfigur und Romanautorin Lisa Eckhart.
Foto: Hans Punz/dpa
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Über Lisa Eckharts Roman "Omama" wurde bereits viel gestritten, nun kann man ihn auch lesen
Am Beginn des zweiten Teils von Lisa Eckharts Debütroman "Omama" steht eine Art essayistische Abhandlung über die historische Entwicklung von Dorfgemeinschaften. Die sakralen Säulen dörflicher Gemeinschaften, heißt es da, seien "Schönling, Matratze, Depp und Trinker. Die vierfache Einfältigkeit. Heute stehen an ihrer Stelle lust-, genuss-, humorbefreite Sitten und Moralapostel und eine primitive Heerschar ungustiöser Epigonen." Nun, da sich die Zeiten geändert hätten, gelte der Depp als Behinderter, und niemand lache mehr über seinen "bunten Irrwitz". Und der Dorftrinker? Komme als "Süchtler" in die Entzugsklinik. "So hieß man früher nur solche, welche gerne Rauschgift nahmen. Und Rauschgift hieß man etwas nur, wenn ein Schwarzer es verkaufte." Heute sei alles Rauschgift und jeder Süchtler, so die bedauernde Schlussfolgerung der Erzählerin, die mit den Worten schließt: "Früher war alles besser, weil man wusste, wie schlecht alles war. Heute ist alles schlechter, weil man glaubt, dass alles gut sei."
Daran ließe sich ohne Umschweife die Dreifaltigkeit der Kabarettistin Lisa Eckhart konstatieren: Missmut, Selbstüberhöhung, Provokation. Aber man befindet sich ja nicht in einer öffentlich-rechtlichen Kabarettsendung, sondern in einem Roman, dem ersten der für ihre satirischen Grenzgänge im Gebiet des Sagbaren bekannten Eckhart. Die eine Kunstfigur muss nicht zwangsläufig die andere sein. Kurz vor seinem Erscheinen stand "Omama" im Zentrum einer Diskussion, die seinen Inhalt gar nicht betraf, sondern einen Auftritt der Autorin damit bei einem Hamburger Literaturwettbewerb. Über all dies wurde berichtet.
Die Diskussion war ziemlich überhitzt wie bei Netzdebatten üblich. Aber sie hatte auch ihr Gutes. Den Veranstaltern zeigte sie, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen: im Umgang mit Autoren, die nicht mit Kollegen auftreten wollen, deren Arbeit sie ablehnen, und im Umgang mit der Angst vor der Eskalation. Sie bewies, dass eine Abgrenzung zwischen sogenannter cancel culture und berechtigter bis hysterischer Kritik im Netz in der Debatte dringend nötig ist. Und sie hat Eckharts Roman einem gewissen Erwartungsdruck ausgesetzt - was einer Autorin, die moralische Korsetts unserer Gesellschaft beklagt, nicht ungelegen kommen dürfte.
"Omama" allerdings ist gar kein Stoff für Skandale. Es ist eine ambitionierte Geschichte über Großmutter Helga, die in der österreichischen Provinz aufwächst und den Lesern als wirkliche Oma der Erzählerautorinnenkunstfigur Eckhart präsentiert wird: "Dem gemeinen Leser mag das freilich imponieren, da er, für Kunst so taub wie blind, stets Wahres dem Erdachten vorzieht."
Die chronisch lügende Helga und ihre schöne Schwester Inge erwarten wenige Wochen nach Kriegsende voll gespannter Angst die Ankunft der Russen. Ihre Eltern haben wenig mehr im Sinn, als die Mädchen zu verprügeln und zu arbeitswilligen Frauen zurechtzubiegen. Das und vieles mehr in ihrem Leben ist in den Worten der selten teilnahmsvollen Erzählerin grausig, auch wenn "der Russe" die Mädchen am Ende verschont, bei der Familie einzieht, Rührei zubereitet, mit dem Vater trinkt und nachts in die Spüle pinkelt.
Später werden die Töchter als ausgeliehene Arbeitssklavinnen weggeschickt. Weil das Leben hart ist, wird Vertrauen spärlich vergeben. Eigentlich kämpft jede und jeder für sich. Dieser Kampf liest sich mal abgeklärt, mal überdreht, immer detailreich im Dienste sprachlicher Pointen. Ständig wendet sich das Blatt, meistens ins Groteske, wobei oft einer oder etwas mit Fäkalien beschmiert wird. Es liegt an Eckharts Beobachtungsgabe für sonst aus Anstand übersehene Unerfreulichkeiten, dass nicht alles am Dorfleben konstruiert wirkt. Dafür steigert sich die Erzählung in eine aufgeputschte Suche nach dem Unbehagen. Als die Russen kamen, erzählt die Oma der Enkelin, hätten sich ihnen Heerscharen junger Frauen an den Hals geworfen, die "dem Russen gar nicht geheuer waren". Und eine Großcousine erzählt von Vergewaltigungen, die ihr erspart blieben - um dann anzufügen: "Doch ich war früher auch sehr hübsch."
Bei ihrem grausamen Ringen um die Gunst von Männern und Enkeln sind sich die Frauen die ärgsten Feinde. Großmütter wünschen sich gegenseitig den Tod, Helga wünscht ihrer Schwester einen kahlen Kopf. Andere sind angeblich weniger damit beschäftigt, die Tränen ihrer Kinder zu trocknen, als ihre Männer zum Weinen zu bringen. Die Wirtin, bei der Helga anheuert, regiert als Furie in ihrem traditionellen Reich. Die Männer hingegen sind ausnahmslos schwach. Knödel essend sitzen sie, bar jeder Autorität, bei Tisch oder - je nach Grad der Männlichkeit - auf Motorrädern. Der schönen Inge ist ein Professor verfallen, der rein gar nichts versteht: Würde sie auf seinen Wunsch ihre Matura nachmachen, verlöre er seine Daseinsberechtigung. "Sie wird nie beeindruckend schlau sein. Darum bleibt sie berückend schlicht."
Dann ist da eine Reihe schwarzhumorig komischer Anekdoten, wenn etwa die von den nächtlichen Gelagen bei der Familie verärgerten Dorfbewohner beschließen, den alten Vater bei den Russen als den "Führer" persönlich zu verpfeifen - worauf er am Ende besser behandelt wird als je zuvor. Oder wenn der Anwalt, der Helga aus der Vormundschaft ihrer Eltern befreien soll, versichert, im Gerichtssaal gehe es nicht darum, ob man gewinne oder verliere: "Ein Prozess ist wie ein Walzer. Mal führt der eine, mal der andre." In diesem ihren Spezialgebiet bewegt sich die Autorin so ausgiebig, bis irgendwann nur noch Deppen und Trinker unterwegs sind und der Überdruss einsetzt.
Fein und gerissen in den Kontext der Zeit gesetzt, hat Eckharts von "Hoserln", "Lottern", "Watschen" und "Zumpferln" durchsetzte, über mehrere Jahrzehnte angelegte Dorfgeschichte etwas Nostalgisch-Sehnendes nach einer Zeit, in der Frauen noch kräftig angefasst werden durften und Zigeuner (ganz ohne Neid) noch das beste Gulasch machten. Aber selbst wer in dieser Zeit eine vermeintlich tröstliche Klarheit zu erkennen glaubt, muss von der Geschwätzigkeit und beharrlich nach Effekten heischenden Erzählung spätestens im letzten Teil, der die Enkelin mit der vorbildlich backenden, Ordnung haltenden, angeschmachteten Großmutter vereint, genug haben.
Der Wiener Tageszeitung "Standard" hat Lisa Eckhart gesagt, ihr Buch sei ein "semantischer Terrorangriff", bei dessen Lektüre sich ihre Leser um den Verstand interpretieren sollen. Aber wo liegt der Mehrwert eines literarischen Werks, das sich allein in Provokation ergeht? Was bleibt abzüglich der Groteske von der Zeit und ihren Zeugen zu erfahren? Und regt sich Unbehagen womöglich nicht nur angesichts der Provokation, sondern auch gegenüber einer Erzählerin, die alles weiß und verstanden hat, die Figuren und Lesern gleichermaßen zusetzt und die Reproduktion von Vorurteilen als Avantgarde verkauft?
Im Epilog schreibt die Erzählerinnenkunstfigur, sie vermisse die Zeiten, als man noch um Fakten stritt. Als es noch um Wahr und Falsch, nicht nur um Gut und Böse ging, als der Klügere noch nicht nachgeben musste, weil es noch gar keinen Klügeren gab. Lange wurde nicht mehr so umfassend und radikal über Fakten gestritten wie heute. Lisa Eckharts Debüt, das sich in eine andere Zeit zurücksehnt, gibt seinen Lesern nichts zum Streiten. Die Kunstfigur ist altbekannt. Was bei ihr zählt, ist die gefühlte Temperatur.
ELENA WITZECK
Lisa Eckhart: "Omama". Roman.
Zsolnay Verlag, Wien 2020. 384 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main