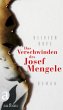Nicht lieferbar
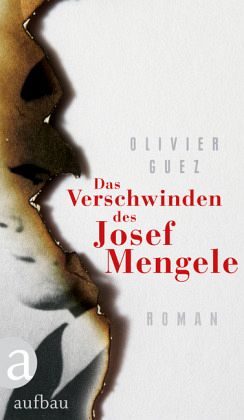
Olivier Guez
Gebundenes Buch
Das Verschwinden des Josef Mengele
Roman. Ausgezeichnet mit dem Prix Renaudot 2017
Übersetzung: Denis, Nicola
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Auf den Spuren des Bösen - der Sensationsbestseller aus Frankreich1949 flüchtet Josef Mengele, der bestialische Lagerarzt von Auschwitz, nach Argentinien. In Buenos Aires trifft er auf ein dichtes Netzwerk aus Unterstützern, unter ihnen Diktator Perón, und baut sich Stück für Stück eine neue Existenz auf. Mengele begegnet auch Adolf Eichmann, der ihn zu seiner großen Enttäuschung nicht einmal kennt. Der Mossad sowie Nazi-Jäger Simon Wiesenthal und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer nehmen schließlich die Verfolgung auf. Mengele rettet sich von einem Versteck ins nächste, lebt isoliert...
Auf den Spuren des Bösen - der Sensationsbestseller aus Frankreich1949 flüchtet Josef Mengele, der bestialische Lagerarzt von Auschwitz, nach Argentinien. In Buenos Aires trifft er auf ein dichtes Netzwerk aus Unterstützern, unter ihnen Diktator Perón, und baut sich Stück für Stück eine neue Existenz auf. Mengele begegnet auch Adolf Eichmann, der ihn zu seiner großen Enttäuschung nicht einmal kennt. Der Mossad sowie Nazi-Jäger Simon Wiesenthal und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer nehmen schließlich die Verfolgung auf. Mengele rettet sich von einem Versteck ins nächste, lebt isoliert und wird finanziell von seiner Familie in Günzburg unterstützt. Erst 1979, nach dreißig Jahren Flucht, findet man die Leiche von Josef Mengele an einem brasilianischen Strand. Dieser preisgekrönte Tatsachenroman von Olivier Guez, der in Frankreich sofort zum Sensationsbesteller wurde, liest sich wie ein rasanter Politthriller und wahrt zugleich die notwendige Distanz."Olivier Guez schuf mit diesem bekannten Verfahren eine phantastische neue Romanform."Frédéric Beigbeder in Le Figaro magazine
Guez, Olivier§
Olivier Guez, 1974 in Straßburg geboren, ist Autor und Journalist. Er arbeitete unter anderem für Le Monde, die New York Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Für das Drehbuch von "Der Staat gegen Fritz Bauer" erhielt er den deutschen Filmpreis. Sein Roman "Das Verschwinden des Josef Mengele" (Aufbau, 2018) wurde zum internationalen Bestseller und stand in Deutschland viele Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Olivier Guez lebt in Paris.
Denis, Nicola§
Nicola Denis wurde mit einer Arbeit zur Übersetzungsgeschichte promoviert. Sie übersetzte u. a. Werke von Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Éric Vuillard, Olivier Guez und Anne Dufourmantelle. Nicola Denis lebt seit vielen Jahren in Frankreich.
Olivier Guez, 1974 in Straßburg geboren, ist Autor und Journalist. Er arbeitete unter anderem für Le Monde, die New York Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Für das Drehbuch von "Der Staat gegen Fritz Bauer" erhielt er den deutschen Filmpreis. Sein Roman "Das Verschwinden des Josef Mengele" (Aufbau, 2018) wurde zum internationalen Bestseller und stand in Deutschland viele Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Olivier Guez lebt in Paris.
Denis, Nicola§
Nicola Denis wurde mit einer Arbeit zur Übersetzungsgeschichte promoviert. Sie übersetzte u. a. Werke von Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Éric Vuillard, Olivier Guez und Anne Dufourmantelle. Nicola Denis lebt seit vielen Jahren in Frankreich.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau-Verlag
- Artikelnr. des Verlages: 641/13728
- 5. Aufl.
- Seitenzahl: 224
- Erscheinungstermin: 10. August 2018
- Deutsch
- Abmessung: 220mm x 133mm x 21mm
- Gewicht: 347g
- ISBN-13: 9783351037284
- ISBN-10: 3351037287
- Artikelnr.: 52438521
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
»Guez ist ein sprachgewaltiger Autor - kräftig, ausdrucksstark, atemberaubend. Der Roman fesselt, macht betroffen, verstört« SRF Schweizer Radio und Fernsehen 20181028
»Ohne Schnörkel, ohne Sensationalismus, als hartnäckiger, unerbittlicher Fahnder auf den Spuren des Schlächters.« Transfuge »Olivier Guez meistert die herausragende Biographie einer Inkarnation des Bösen.« L'Humanité Dimanche
Zu diesem Roman habe ich eine gespaltene Meinung.
Einerseits finde ich, dass der Autor sehr gut recherchiert und sich über das Thema informiert hat. Man bekommt auf jeden Fall zu spüren, wie viel Arbeit er in diesen Roman investiert hat.
Andererseits bin ich der Meinung, dass man …
Mehr
Zu diesem Roman habe ich eine gespaltene Meinung.
Einerseits finde ich, dass der Autor sehr gut recherchiert und sich über das Thema informiert hat. Man bekommt auf jeden Fall zu spüren, wie viel Arbeit er in diesen Roman investiert hat.
Andererseits bin ich der Meinung, dass man diese Geschichte viel ,,spannender" und eindringlicher erzählen hätte können. Es ähnelt zu sehr einem Sachbuch, die Fakten wurden ,,langweilig" nacheinander aufgezählt, wenig Spannung etc.
Personen haben kaum geredet, was ich mir persönlich gewünscht hätte. Dementsprechend konnte man sich auch nur sehr schwer mit den einzelnen Charakteren identifizieren. Innere Monologe von Mengele wären auch interessant gewesen, da dadurch mehr Emotiononen ausgelöst worden wären. Was mich auch gestört hat war, dass es zu viele verschiedene Charaktere gab, die alle nicht genau genug beschrieben wurden, weswegen man mit den ganzen Namen kaum mitkam.
Es haben mir hierbei einfach die Hintergrundinformationen gefehlt und der Autor ist bei diesem Punkt viel zu oberflächlich vorgegangen.
Was der Autor aber auf jeden Fall geschafft hat - Aggressionen auszulösen!
Wie man so kaltblütig, eklig und herzlos sein kann, unglaublich.
Erschreckend zudem auch, dass Mengele seine Fehler und gräueltaten nicht eingesehen hat.
Wie sich einfach Gedankengut im Gehirn eines Menschen so festsetzten kann, ist wirklich erschreckend und gefährlich.
Ohne jegliche Gewissensbisse und Reue einfach so etwas hinzunehmen...
Die Frage, die ich mir stelle ist: Wie kann es sein, dass Menschen so extrem von etwas überzeugt bzw. beeinflusst werden können, ohne sich über die Gefahren dieses Denkens bewusst zu werden?
Das, was während dieser Zeit (1939-1945) passiert ist, spiegelt sich pauschal gesagt in der heutigen Zeit wieder (Chemnitz, Berlin, Klima in Europa).
Alleine, dass Menschen bei ,,Demos" sich VOR die Kamera stellen und IN die Kamera den Hitlergruß zeigen, ,,Ausländer" jagen, ohne die geringste Angst vor Konsequenzen zeigt, wie die Aufarbeitung der Geschichte funktioniert hat...
Solche Situationen im Jahr 2018 noch miterleben zu müssen, ist nicht in Worte zu fassen.
Hoffen wir mal, dass so etwas nie wieder passieren wird!!!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Josef Mengele – Todesengel von Auschwitz, der wohl grausamste und rücksichtsloseste Arzt der Geschichte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gelingt ihm die Flucht über mehrere europäische Länder nach Südamerika, wo er dank der Hilfe eifriger Unterstützer und mit …
Mehr
Josef Mengele – Todesengel von Auschwitz, der wohl grausamste und rücksichtsloseste Arzt der Geschichte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gelingt ihm die Flucht über mehrere europäische Länder nach Südamerika, wo er dank der Hilfe eifriger Unterstützer und mit falscher Identität untertauchen kann. Unter Perón führt er in Argentinien zunächst ein sicheres Leben, die deutsche Community ist gut vernetzt und steht unter dem Schutz des Diktators, doch nach dessen Sturz wird die Lage unbequem. Es folgen Jahrzehnte des Irrens über mehrere Länder, immer wieder auf der Flucht und in Angst vor Entdeckung. Mehrfach sind ihm Israelis wie auch andere auf den Spuren, aber dank eines guten Netzes starker Verbündeter gelingt es dem tausendfachen Mörder immer wieder, sich seiner gerechten Strafe zu entziehen.
Olivier Guez‘ Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“ zeichnet die Spuren eines der schlimmsten Verbrecher des Nazi-Regimes nach. Dies gelingt dem Autor eindrucksvoll und dafür wurde er 2017 völlig zurecht mit den renommierten französischen Literaturpreis Prix Renaudot ausgezeichnet. Drei Jahre hat er an dem Buch gearbeitet, das auf wahren Eckdaten basiert, in weiten Teilen jedoch fiktiv bleiben muss, da bis heute das komplette Leben des Arztes nicht lückenlos dokumentiert ist.
In erster Linie besticht der Roman natürlich durch die Person des Josef Mengele. Er ist sicher eine der bekanntesten Figuren des Hitler-Regimes und viel wurde über ihn berichtet und geschrieben. Am beeindruckendsten war für mich jedoch die Haltung, die er bis zum letzten Tag standhaft beibehielt: er leugnete seine Taten nicht, aber die Bewertung dessen, was er getan hat, steht in starkem Kontrast zu Realität. Vermutlich um sich selbst zu schützen und sich nicht dem stellen zu müssen, was er verbrochen hat, sah er sich als Wissenschaftler und Forscher, der der Menschheit einen Dienst erweisen wollte:
„Was ist denn nun mit Auschwitz, Papa? Mengele weist die Schuld von sich. Er hat gekämpft, um „unbestrittene traditionelle Werte“ zu verteidigen, nie jemanden umgebracht. Im Gegenteil: Indem er bestimmte, wer arbeitsfähig ist, konnte er Leben retten. Er verspürt keinerlei Schuld.“
Seine grenzenlose Angst gerade von den Israelis entdeckt zu werden, zeigt jedoch auch, dass ihm trotz allem sehr bewusst gewesen sein muss, dass diese nicht nur Rache an ihm walten lassen würden, sondern durchaus mit guten Grund und Recht eine Verurteilung forderten. Womöglich ist das Leben in Angst schon die irdische Strafe, die ihm mehr zusetzt, als man vermuten mag:
„Nun ist er dem Fluch Kains ausgeliefert, dem ersten Mörder der Menschheit: ein Getriebener, der über die Erde irrt, wer ihm begegnet, wird ihn töten.“
Aber auch Guez Sprachgewalt ist überzeugend. Die nuancierten Zwischentöne, die die Verachtung seines Protagonisten deutlich hervortreten lassen, sind glänzend platziert. Aber auch die Kritik an den nachlässigen deutschen Behörden, die Mengele schon zeitnah nach Kriegsende hätten auffinden können, wird nachhaltig zum Ausdruck gebracht.
Man spürt eine gewisse Fassungslosigkeit ob der Haltung Mengeles, aber auch, weil auf Erden die Taten nicht gesühnt wurden. Auch wenn der Text letztlich eine fiktive Erzählung ist, was jedoch dem Erzählfluss zugutekommt, kann er als Mahnmal verstanden werden, das in breiter Masse gelesen werden sollte, damit die Geschichte sich nicht wiederholt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Todesengel
Josef Mengele wurde nach seinem Fronteinsatz im Jahre 1943 in Ausschwitz als Lagerarzt eingesetzt. Dort kam er durch seine kalt-blütige und unbarmherzige Art zu dem Titel des Todesengels. Er schickte abertausende Juden in den Tod und forschte mit unmenschlichen Methoden an …
Mehr
Der Todesengel
Josef Mengele wurde nach seinem Fronteinsatz im Jahre 1943 in Ausschwitz als Lagerarzt eingesetzt. Dort kam er durch seine kalt-blütige und unbarmherzige Art zu dem Titel des Todesengels. Er schickte abertausende Juden in den Tod und forschte mit unmenschlichen Methoden an Behinderten und Zwillingen, um den Theorien der Rassenhygiene neuen Inhalt zu geben. Seine Gräuel-taten kannten keine Grenzen und so wurde er zum gefürchtetsten Lagerarzt des dritten Reichs. Nach dem Krieg tauch Mengele unter und es gelang ihm, wie vielen anderen hochdotierten Nazis, im Jahre 1949 die Flucht nach Argentinien.
Olivier Guez setzt sich in seinem Buch "Das Verschwinden des Josef Mengele" mit der Zeit, die Josef Mengele in Südamerika auf der Flucht war, auseinander. Er schildert das Leben mit einer solch erzählerischen Kraft und Authentizität, dass es mir beim Lesen schauderte und den Protagonisten real vor Augen führte. Das Gedankengut Mengeles machte mich immer wieder sprachlos, wie emotionslos er über den Tod anderer Menschen sprach und sich selbst noch als aufopferungsvollen und treuen Diener des Staates sah. Seine Flucht entwickelt sich aber zum Trost des Lesers, der es als schreiendes Unrecht empfinden muss, dass dieser Mann für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, anders als gehofft. Die anfängliche Unterstützung vieler Nazis in Südamerika nimmt zunehmend ab und Mengele vereinsamt. Stets getrieben von Angst und Alpträumen wird sein Leben zunehmend unattraktiver und der Mann, für den Hygiene und Disziplin an erster Stelle stand, muss immer mehr Kompromisse machen, um unentdeckt zu bleiben. Hier beschreibt Olivier Guez sehr schön, wie sehr Mengele unter seinen Lebensumständen und seiner fehlenden Anerkennung leidet.
Zudem rechne ich dem Autor hoch an, dass er mit Gräueltaten Mengeles nicht inflationär umgeht, um Effekthascherei zu betreiben, sondern wenige teilweise unglaubliche Taten lediglich kurz schildert und so zumindest bei mir eine viel höhere Wirkung erzielt.
Die historischen Fakten zu dem Buch wirken sehr gut recherchiert und der Autor führt auch im Anhang eine große Anzahl lesenswerter Bücher an, die sein Studium mit der damaligen Zeit begünstigt haben. "Das Verschwinden des Josef Mengele" ist für mich ein äußerst lesenswertes Buch, da es Olivier Guez hervorragend gelingt, das Leben des kaltblütigen Arztes, der sicherlich zu Recht auch als Monster bezeichnet wurde, lebendig zu skizzieren, um so mit dem Mythos abzurechnen und aus den historischen Fakten zu lernen. Ein beeindruckendes und nachwirkendes Buch, welches ich mit den vollen fünf von fünf Sternen bewerte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Der Fluch der bösen Tat
Mag ja sein, dass die Geschichte des Todesarzt von Auschwitz noch spannender zu erzählen ist. Aber auch so hat mich dieses Buch gefesselt. Nachdem ich von der Entführung Eichmanns erfahren habe, wollte ich wissen, wieso Mengele nicht verhaftet wurde.
Und …
Mehr
Der Fluch der bösen Tat
Mag ja sein, dass die Geschichte des Todesarzt von Auschwitz noch spannender zu erzählen ist. Aber auch so hat mich dieses Buch gefesselt. Nachdem ich von der Entführung Eichmanns erfahren habe, wollte ich wissen, wieso Mengele nicht verhaftet wurde.
Und das sieht auch das Buch so. Im ersten Teil „Der Pascha“ ist von seinem Leben in Argentinien unter Perron die Rede. Dass dieser Staatsmann mit der berühmten Ehefrau ein solcher Faschist war, war mir auch neu. Er hoffte, dass die USA und Sowjetunion im kalten Krieg bekämpfen und er mit seinem dritten Weg gewinnen würde.
Aber es kam anders, wie das zweite Kapitel "Die Ratte" beleuchtet. Nach Perrons Entmachtung und der Verhaftung Eichmanns musste Mengele sich verstecken, erst in Paraguay, dann bei einer Familie in Brasilien. Dies ging nur, weil seine Familie fürstlich für seine Unterkunft zahlte. Selbst nach seinem Tod am 7.2. 1979 wurde er weiter gesucht.
Erst der Epilog klärt auf, wie der Tod des Nazi-Arztes öffentlich wurde und wie dann auch die Familie in Günzburg den Namen der Firma Mengele ändern musste, weil die Geschäfte wegen des Terroronkels immer schlechter liefen.
Alles in allem ist doch erstaunlich, wie lang es brauchte, bis in der Geschichtsschreibung sich die wahrhafte Verfolgung des Terrors durchsetzte. 5 Sterne
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Audio CD
Es gibt Zeitzeugen und etliche Bücher, die das Wirken dieses Unmenschen beschreiben. Auch das Buch „Das Verschwinden des Josef Mengele“ gehört dazu. Nach dem Ende des Krieges und Hitlers Suizid floh er nach Argentinien. Das war nur möglich, weil er viel Anhänger und …
Mehr
Es gibt Zeitzeugen und etliche Bücher, die das Wirken dieses Unmenschen beschreiben. Auch das Buch „Das Verschwinden des Josef Mengele“ gehört dazu. Nach dem Ende des Krieges und Hitlers Suizid floh er nach Argentinien. Das war nur möglich, weil er viel Anhänger und Unterstützer hatte. Womit er nicht rechnete, dass auch Nazijäger auf seiner Spur waren. Dazu gehörte der bekannte und geschätzte Simon Wiesenthal und geschulte Mitarbeiter des Mossad. Mengele musst immer wieder flüchten und trotzdem konnten ihn die Verfolger nie dingfest machen. Er hatte schlicht und einfach zu viele Helfer. Er starb bei einem Badeunfall und konnte nie für seine Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden.
Das Buch ist mit Sicherheit gut recherchiert und faktenreich geschrieben. Mir gefiel der Sprecher dabei überhaupt nicht. Für mich leierte die Seiten herunter und das ohne Punkt und Komma. Also ohne Wechsel der Stimmlage bei den unterschiedlichen Akteuren. Schade, aber ich werde mir das Buch kaufen und es lesen. Die historisch belegten Hintergründe interessieren mich sehr. Auch die Tatsache, wie Frau und Sohn auf die Anschuldigungen gegenüber Mengele reagierten sind anschaulich wiedergegeben. Für die Arbeit des Autors gebe ich gerne vier Sterne, für den Sprecher aber nur drei.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich