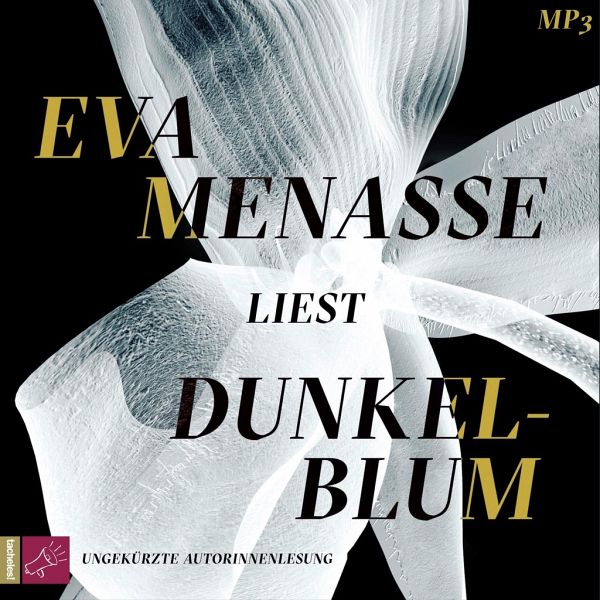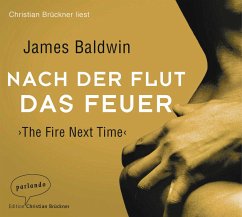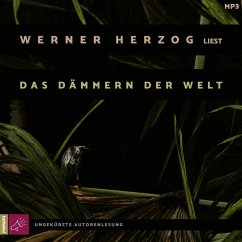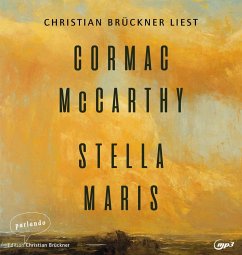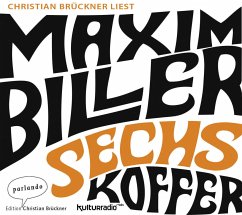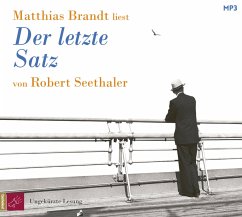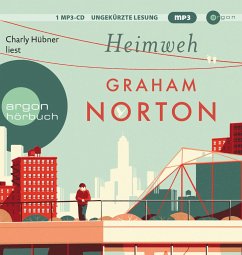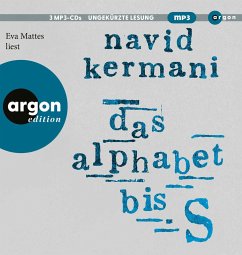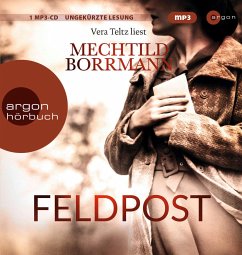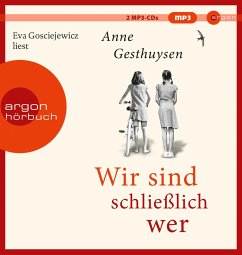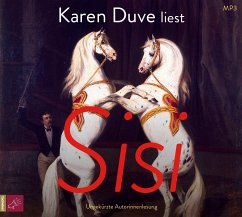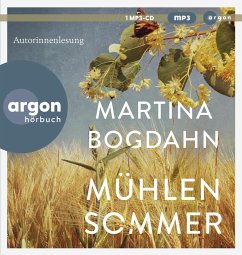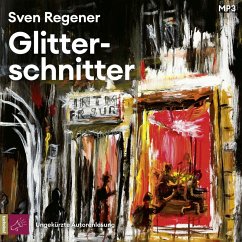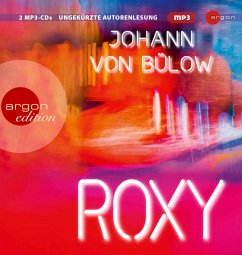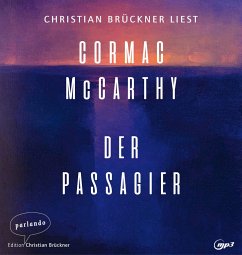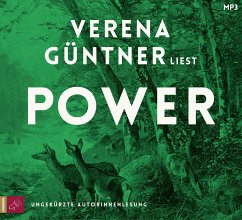Eva Menasse
MP3-CD
Dunkelblum (Restauflage)
900 Min.. Lesung. Ungekürzte Ausgabe
Gesprochen: Menasse, Eva
Sofort lieferbar
UVP: 22,00 €**
Als Restexemplar::
Als Restexemplar::
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Neue Bücher, die nur noch in kleinen Stückzahlen vorhanden und von der Preisbindung befreit sind. Schnell sein!





Jeder schweigt von etwas anderem
August 1989: Im österreichischen Städtchen Dunkelblum taucht ein rätselhafter Besucher auf, eine junge Frau verschwindet, ein Skelett wird gefunden. Und hinter der nahen Grenze zu Ungarn warten bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge. Da kommen wie von selbst die Erinnerungen an ein furchtbares Verbrechen zurück, das die Dunkelblumer gern für immer verdrängt hätten.
Mit Witz und Suspense entwirft Eva Menasse ein großes Geschichtspanorama am Beispiel einer kleinen Stadt und erzählt vom Umgang der Bewohner mit einer historischen Schuld.
August 1989: Im österreichischen Städtchen Dunkelblum taucht ein rätselhafter Besucher auf, eine junge Frau verschwindet, ein Skelett wird gefunden. Und hinter der nahen Grenze zu Ungarn warten bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge. Da kommen wie von selbst die Erinnerungen an ein furchtbares Verbrechen zurück, das die Dunkelblumer gern für immer verdrängt hätten.
Mit Witz und Suspense entwirft Eva Menasse ein großes Geschichtspanorama am Beispiel einer kleinen Stadt und erzählt vom Umgang der Bewohner mit einer historischen Schuld.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin (profil, FAZ) und debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman Vienna. Es folgten Romane und Erzählungen (Lässliche Todsünden, Quasikristalle, Tiere für Fortgeschrittene), die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Preise (Auswahl): Heinrich-Böll-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis, Jonathan-Swift-Preis, Österreichischer Buchpreis, Mainzer Stadtschreiber-Preis und das Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Eva Menasse betätigt sich zunehmend auch als Essayistin und erhielt dafür 2019 den Ludwig-Börne-Preis. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin. Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, begann als Journalistin (profil, FAZ) und debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman Vienna. Es folgten Romane und Erzählungen (Lässliche Todsünden, Quasikristalle, Tiere für Fortgeschrittene), die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Preise (Auswahl): Heinrich-Böll-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis, Jonathan-Swift-Preis, Österreichischer Buchpreis, Mainzer Stadtschreiber-Preis und das Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Eva Menasse betätigt sich zunehmend auch als Essayistin und erhielt dafür 2019 den Ludwig-Börne-Preis. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin.

© Ekko von Schwichow
Produktdetails
- Verlag: Roof Music; Tacheles!
- Anzahl: 2 MP3-CDs
- Gesamtlaufzeit: 900 Min.
- Erscheinungstermin: 19. August 2021
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783864847011
- Artikelnr.: 66302040
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dunkle Geschichte
Eva Menasse liest im Literaturhaus
FRANKFURT Der erste Abend im Frankfurter Literaturhaus nach der Sommerpause: Etwa 70 Gäste dürfen im großen Lesesaal Platz nehmen; ohne Corona wären es 200. Nur die beiden Gäste auf dem Podium und diejenigen, die den Livestream ansehen, brauchen nicht unter der Maske zu hecheln: Eva Menasse stellte ihren Roman "Dunkelblum" (Kiwi) vor, und Literaturwissenschaftler Torsten Hoffmann kitzelte elegant die Brillanz aus der Autorin. Bevor er zum Thema des Abends kam, wollte er aber etwas anderes von ihr wissen: Wie hält sie es mit der Identitätspolitik? Schließlich hat sie ja gerade erst "Gedankenspiele über den Kompromiss" vorgelegt, eine Auftragsarbeit für den Grazer
Eva Menasse liest im Literaturhaus
FRANKFURT Der erste Abend im Frankfurter Literaturhaus nach der Sommerpause: Etwa 70 Gäste dürfen im großen Lesesaal Platz nehmen; ohne Corona wären es 200. Nur die beiden Gäste auf dem Podium und diejenigen, die den Livestream ansehen, brauchen nicht unter der Maske zu hecheln: Eva Menasse stellte ihren Roman "Dunkelblum" (Kiwi) vor, und Literaturwissenschaftler Torsten Hoffmann kitzelte elegant die Brillanz aus der Autorin. Bevor er zum Thema des Abends kam, wollte er aber etwas anderes von ihr wissen: Wie hält sie es mit der Identitätspolitik? Schließlich hat sie ja gerade erst "Gedankenspiele über den Kompromiss" vorgelegt, eine Auftragsarbeit für den Grazer
Mehr anzeigen
Droschl Verlag. "Das ist schmerzhaft", war zu vernehmen. Extremismen existierten halt rechts und links. "AfD - gähn, aber das identitätspolitische Denken ist bedrückend", sagte die Autorin. Es bewege sich "in Richtung Fundamentalismus". Dabei handele es sich nur um kleine, dafür aber laute digitale Gruppen. Menasse bedauerte auch die "Superhysterie" beim Gendern.
Dann gingen sie zum Roman über. "Dunkelblum" alias Rechnitz ist eine Kleinstadt im Burgenland an der Grenze zu Ungarn. Ihr Roman sei also ein "Europa-Roman", so Menasse. Umso mehr als sich sein einwöchiger Plot im August 1989 zuträgt, als DDR-Bürger über die Grenze flohen. Diese Erzählzeit wird durchbrochen von Rückblenden ins Jahr 1944, als die Nazis diese Grenze zum "Südostwall" ausriefen und jüdische Zwangsarbeiter nebst Alten und Frauen diesen befestigen sollten. Bei einem Fest der SS-Lokalprominenz kam es zu einem Massaker an 200 Juden. Die ortsansässige Gräfin hat die Täter gedeckt und einem SS-Bonzen mit ihrem Geld die Flucht ermöglicht. Bis heute wurde das Massengrab nicht gefunden. Rechnitz muss mit dem Ruf einer Nazi-Stadt leben, aber, so Menasse: "Es gab mehr als 120 solcher Vorfälle an dieser Grenze."
Die "Wende" von 1989 ist im Roman der Auslöser der Erinnerung. Ein Museum soll her, eine Stadtchronik. So hat Menasse "Geschichte geschichtet", wie sie wiederholt formulierte. Sie demonstrierte das mit einer Lesepassage über die Fluchthilfe derer, die 1944 Hitlerjungen und Schlägertrupps waren. Wollen sie 45 Jahre später etwas gutmachen, bevor Genschers Busse anrücken? Wohl eher schnelles Geld wollen die "Haberer" verdienen. "Haberer"? "Kumpel", übersetzte die Wiener Schriftstellerin für ihre deutschen Leser, die allenfalls Erdäpfel und Paradeiser von der Speisekarte her kennen. Ja, ihr Buch sei sehr österreichisch, so Menasse, die ihm sicherheitshalber ein Glossar angehängt hat. Erzählungen will sie übrigens nicht mehr schreiben. Die würden ja doch nicht gelesen, deshalb nur noch Romane. Der anregende und kurzweilige Abend war der Autorenstiftung zu verdanken.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dann gingen sie zum Roman über. "Dunkelblum" alias Rechnitz ist eine Kleinstadt im Burgenland an der Grenze zu Ungarn. Ihr Roman sei also ein "Europa-Roman", so Menasse. Umso mehr als sich sein einwöchiger Plot im August 1989 zuträgt, als DDR-Bürger über die Grenze flohen. Diese Erzählzeit wird durchbrochen von Rückblenden ins Jahr 1944, als die Nazis diese Grenze zum "Südostwall" ausriefen und jüdische Zwangsarbeiter nebst Alten und Frauen diesen befestigen sollten. Bei einem Fest der SS-Lokalprominenz kam es zu einem Massaker an 200 Juden. Die ortsansässige Gräfin hat die Täter gedeckt und einem SS-Bonzen mit ihrem Geld die Flucht ermöglicht. Bis heute wurde das Massengrab nicht gefunden. Rechnitz muss mit dem Ruf einer Nazi-Stadt leben, aber, so Menasse: "Es gab mehr als 120 solcher Vorfälle an dieser Grenze."
Die "Wende" von 1989 ist im Roman der Auslöser der Erinnerung. Ein Museum soll her, eine Stadtchronik. So hat Menasse "Geschichte geschichtet", wie sie wiederholt formulierte. Sie demonstrierte das mit einer Lesepassage über die Fluchthilfe derer, die 1944 Hitlerjungen und Schlägertrupps waren. Wollen sie 45 Jahre später etwas gutmachen, bevor Genschers Busse anrücken? Wohl eher schnelles Geld wollen die "Haberer" verdienen. "Haberer"? "Kumpel", übersetzte die Wiener Schriftstellerin für ihre deutschen Leser, die allenfalls Erdäpfel und Paradeiser von der Speisekarte her kennen. Ja, ihr Buch sei sehr österreichisch, so Menasse, die ihm sicherheitshalber ein Glossar angehängt hat. Erzählungen will sie übrigens nicht mehr schreiben. Die würden ja doch nicht gelesen, deshalb nur noch Romane. Der anregende und kurzweilige Abend war der Autorenstiftung zu verdanken.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Das Massaker von Rechnitz im Jahr 1945 war "singulär" - und deshalb kann man auch keine "paradigmatische Menschheitsgeschichte" darüber schreiben, wie Eva Menasse es versucht, wendet Rezensent Paul Jandl nach der Lektüre ein. Die Sprache Menasses, die viele Kritikerkollegen besonders lobten, stellt denn für Jandl auch die eigentliche Problematik des Romans dar: Natürlich erkennt er den "surrealen Witz", die Menge meisterlicher Anekdoten und das Pointenfeuerwerk, das die Autorin zündet. Was dem Roman allerdings fehlt, ist der Wille zur Aufklärung, überhaupt der kritische Blick, den es braucht, damit der Leser hier nicht mit einem "entlastungshumorigen Kuriositätenkabinett" allein gelassen wird, schließt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2021Dunkle Geschichte
Eva Menasse liest im Literaturhaus
FRANKFURT Der erste Abend im Frankfurter Literaturhaus nach der Sommerpause: Etwa 70 Gäste dürfen im großen Lesesaal Platz nehmen; ohne Corona wären es 200. Nur die beiden Gäste auf dem Podium und diejenigen, die den Livestream ansehen, brauchen nicht unter der Maske zu hecheln: Eva Menasse stellte ihren Roman "Dunkelblum" (Kiwi) vor, und Literaturwissenschaftler Torsten Hoffmann kitzelte elegant die Brillanz aus der Autorin. Bevor er zum Thema des Abends kam, wollte er aber etwas anderes von ihr wissen: Wie hält sie es mit der Identitätspolitik? Schließlich hat sie ja gerade erst "Gedankenspiele über den Kompromiss" vorgelegt, eine Auftragsarbeit für den Grazer
Eva Menasse liest im Literaturhaus
FRANKFURT Der erste Abend im Frankfurter Literaturhaus nach der Sommerpause: Etwa 70 Gäste dürfen im großen Lesesaal Platz nehmen; ohne Corona wären es 200. Nur die beiden Gäste auf dem Podium und diejenigen, die den Livestream ansehen, brauchen nicht unter der Maske zu hecheln: Eva Menasse stellte ihren Roman "Dunkelblum" (Kiwi) vor, und Literaturwissenschaftler Torsten Hoffmann kitzelte elegant die Brillanz aus der Autorin. Bevor er zum Thema des Abends kam, wollte er aber etwas anderes von ihr wissen: Wie hält sie es mit der Identitätspolitik? Schließlich hat sie ja gerade erst "Gedankenspiele über den Kompromiss" vorgelegt, eine Auftragsarbeit für den Grazer
Mehr anzeigen
Droschl Verlag. "Das ist schmerzhaft", war zu vernehmen. Extremismen existierten halt rechts und links. "AfD - gähn, aber das identitätspolitische Denken ist bedrückend", sagte die Autorin. Es bewege sich "in Richtung Fundamentalismus". Dabei handele es sich nur um kleine, dafür aber laute digitale Gruppen. Menasse bedauerte auch die "Superhysterie" beim Gendern.
Dann gingen sie zum Roman über. "Dunkelblum" alias Rechnitz ist eine Kleinstadt im Burgenland an der Grenze zu Ungarn. Ihr Roman sei also ein "Europa-Roman", so Menasse. Umso mehr als sich sein einwöchiger Plot im August 1989 zuträgt, als DDR-Bürger über die Grenze flohen. Diese Erzählzeit wird durchbrochen von Rückblenden ins Jahr 1944, als die Nazis diese Grenze zum "Südostwall" ausriefen und jüdische Zwangsarbeiter nebst Alten und Frauen diesen befestigen sollten. Bei einem Fest der SS-Lokalprominenz kam es zu einem Massaker an 200 Juden. Die ortsansässige Gräfin hat die Täter gedeckt und einem SS-Bonzen mit ihrem Geld die Flucht ermöglicht. Bis heute wurde das Massengrab nicht gefunden. Rechnitz muss mit dem Ruf einer Nazi-Stadt leben, aber, so Menasse: "Es gab mehr als 120 solcher Vorfälle an dieser Grenze."
Die "Wende" von 1989 ist im Roman der Auslöser der Erinnerung. Ein Museum soll her, eine Stadtchronik. So hat Menasse "Geschichte geschichtet", wie sie wiederholt formulierte. Sie demonstrierte das mit einer Lesepassage über die Fluchthilfe derer, die 1944 Hitlerjungen und Schlägertrupps waren. Wollen sie 45 Jahre später etwas gutmachen, bevor Genschers Busse anrücken? Wohl eher schnelles Geld wollen die "Haberer" verdienen. "Haberer"? "Kumpel", übersetzte die Wiener Schriftstellerin für ihre deutschen Leser, die allenfalls Erdäpfel und Paradeiser von der Speisekarte her kennen. Ja, ihr Buch sei sehr österreichisch, so Menasse, die ihm sicherheitshalber ein Glossar angehängt hat. Erzählungen will sie übrigens nicht mehr schreiben. Die würden ja doch nicht gelesen, deshalb nur noch Romane. Der anregende und kurzweilige Abend war der Autorenstiftung zu verdanken.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dann gingen sie zum Roman über. "Dunkelblum" alias Rechnitz ist eine Kleinstadt im Burgenland an der Grenze zu Ungarn. Ihr Roman sei also ein "Europa-Roman", so Menasse. Umso mehr als sich sein einwöchiger Plot im August 1989 zuträgt, als DDR-Bürger über die Grenze flohen. Diese Erzählzeit wird durchbrochen von Rückblenden ins Jahr 1944, als die Nazis diese Grenze zum "Südostwall" ausriefen und jüdische Zwangsarbeiter nebst Alten und Frauen diesen befestigen sollten. Bei einem Fest der SS-Lokalprominenz kam es zu einem Massaker an 200 Juden. Die ortsansässige Gräfin hat die Täter gedeckt und einem SS-Bonzen mit ihrem Geld die Flucht ermöglicht. Bis heute wurde das Massengrab nicht gefunden. Rechnitz muss mit dem Ruf einer Nazi-Stadt leben, aber, so Menasse: "Es gab mehr als 120 solcher Vorfälle an dieser Grenze."
Die "Wende" von 1989 ist im Roman der Auslöser der Erinnerung. Ein Museum soll her, eine Stadtchronik. So hat Menasse "Geschichte geschichtet", wie sie wiederholt formulierte. Sie demonstrierte das mit einer Lesepassage über die Fluchthilfe derer, die 1944 Hitlerjungen und Schlägertrupps waren. Wollen sie 45 Jahre später etwas gutmachen, bevor Genschers Busse anrücken? Wohl eher schnelles Geld wollen die "Haberer" verdienen. "Haberer"? "Kumpel", übersetzte die Wiener Schriftstellerin für ihre deutschen Leser, die allenfalls Erdäpfel und Paradeiser von der Speisekarte her kennen. Ja, ihr Buch sei sehr österreichisch, so Menasse, die ihm sicherheitshalber ein Glossar angehängt hat. Erzählungen will sie übrigens nicht mehr schreiben. Die würden ja doch nicht gelesen, deshalb nur noch Romane. Der anregende und kurzweilige Abend war der Autorenstiftung zu verdanken.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Eva Menasse hat mit ihrem Buch 'Dunkelblum' ein Meisterwerk geschaffen.« Ijoma Mangold Die Zeit 20210819
Im Grundriss der Geschichte
Kein Wende- und auch kein Schlüsselroman: Eva Menasses neuer Roman "Dunkelblum" ist etwas Besseres. Auf bitterkomische Weise macht er ein historisches Ereignis zum Hintergrund eines Kleinstadtporträts im Jahr 1989.
Der deutschsprachige Bücherherbst 2021 steht im Zeichen von vier Schriftstellerinnen. Höchst erfolgreichen, aber auch schreibskrupulösen, weshalb deren neue Werke nach jeweils langer Pause ungeduldig erwartet werden. In zehn Tagen erscheint Jenny Erpenbecks Roman "Kairos"; sechs Jahre sind seit dessen Vorgänger "Gehen Ging Gegangen" vergangen. Zwei Wochen danach kommt "Am Menschen muss alles herrlich sein" von Sasha Marianna Salzmann heraus, vier Jahre nach "Außer sich", dem
Kein Wende- und auch kein Schlüsselroman: Eva Menasses neuer Roman "Dunkelblum" ist etwas Besseres. Auf bitterkomische Weise macht er ein historisches Ereignis zum Hintergrund eines Kleinstadtporträts im Jahr 1989.
Der deutschsprachige Bücherherbst 2021 steht im Zeichen von vier Schriftstellerinnen. Höchst erfolgreichen, aber auch schreibskrupulösen, weshalb deren neue Werke nach jeweils langer Pause ungeduldig erwartet werden. In zehn Tagen erscheint Jenny Erpenbecks Roman "Kairos"; sechs Jahre sind seit dessen Vorgänger "Gehen Ging Gegangen" vergangen. Zwei Wochen danach kommt "Am Menschen muss alles herrlich sein" von Sasha Marianna Salzmann heraus, vier Jahre nach "Außer sich", dem
Mehr anzeigen
gefeierten Debütroman dieser Autorin. Und noch einmal einen Monat später folgt Julia Francks "Welten auseinander", ein ganzes Jahrzehnt nach "Rücken an Rücken". Den Auftakt aber zu dieser Sequenz langersehnter Bücher macht heute Eva Menasse mit "Dunkelblum", ihrem dritten Roman. Acht Jahre liegt der zweite, "Quasikristalle", mittlerweile zurück.
Es ist das einzige hochkomische Buch in diesem Quartett, doch zugleich ist es - dem Titel gemäß - eine tieffinstere Geschichte. Eine, die am Epocheneinschnitt von 1989 angesiedelt ist, und das auch noch an der ungarisch-österreichischen Grenze, die im damaligen Sommer zum Sehnsuchtsort wurde: Mit dem Zustrom von Fluchtwilligen aus der DDR hierher und der zeitweisen Öffnung des Eisernen Vorhangs für sie begann der Kollaps des Ostblocks. Aber "Dunkelblum" ist kein Wenderoman. Sein Thema reicht weiter zurück ins zwanzigste Jahrhundert.
Vielen ist angesichts dessen unheimlich zumute in Dunkelblum, einer kleinen Grenzstadt im Burgenland, auch dem Bürgermeister Koreny: "Wahrscheinlich ist das nicht wichtig, aber die Tochter vom Malnitz, die jüngste, die goscherte, weißt eh, die fragt jetzt dauernd herum wegen irgendwelchen uralten Geschichten, die will ein Museum machen oder zumindest eine private Ausstellung auf dem Grundstück ihrer Mutter, in Ehrenfeld. Allerdings ist da gerade der Stadel abgebrannt . . . Unserer Frau Balaskó hat sie gesagt, sie sucht nach Dunkelblumer Kriegsverbrechern, stell dir das vor, Kriegsverbrecher, bei uns! Das Mädel ist Anfang zwanzig, früher haben sich die jungen Leute für was anderes interessiert, für Tanzen und Flirten . . ." An diesem Zitat ist vieles charakteristisch für den ganzen Roman.
Einmal die Mündlichkeit des Stils: "Dunkelblum" ist ein Vielstimmengebilde, ein rundes Dutzend Haupt- und etliche Nebenfiguren kommt in Worten und Gedanken zur Sprache, und nicht selten klingt es, so wie hier, nach den "Brenner"-Kriminalromanen von Wolf Haas - schon der lokalbedingt zwingenden Austriazismen wegen, für deren Verständlichkeit beim bundesdeutschen Publikum ein siebenseitiges Glossar sorgt. Aber es gibt spät im Roman auch eine bewusst gesetzte Hommage an Haas, als dessen signature sentence "Jetzt ist schon wieder was passiert" plötzlich in indirekter Rede aufblitzt. Eva Menasse stellt sich mit Tonfall und Tönung ihres Schreibens in eine lange spezifisch österreichisch schwarzironische Tradition von Kraus und Musil über Doderer und Lernet-Holenia bis hin zu Hans Lebert oder eben Haas, und den epischen Atem dieser Autoren hat sie auch. 524 Seiten beweisen es.
Dann ist in der eben zitierten Passage der Gegensatz des Landsmannschaftlichen in Dunkelblum angesprochen. Das Burgenland kam erst nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich, vorher gehörte es zum ungarischen Reichsteil, und dorther stammen die Familiennamen Balaskó und Koreny. Malnitz dagegen ist slawischer Herkunft, und selbstverständlich hat es in Dunkelblum auch deutsche Namen: Rehberg etwa oder Reschen. Und Grün. Doch Antal Grün, der Greißler (Gemischtwarenhändler) des Ortes, ist der einzige nach dem Krieg zurückgekehrte Jude. "Wir waren einundfünfzig", sagte Antal lächelnd und mit geschlossenen Augen, "darunter ein achtzigjähriger Rabbi und mehrere Kinder. Und er erzählte dem Doktor Sterkowitz von seiner Nacht auf dem Wellenbrecher." Dieser Doktor praktiziert übrigen im Haus seines jüdischen Vorgängers.
Ganz allmählich kehrt im Roman dann auch die Vergangenheit nach Dunkelblum zurück. Vor allem deren Schatten. Der im Zitat angesprochene Brand des Stadels erweist sich als Menetekel, denn in seiner Nähe hatte sich gegen Ende des Krieges etwas abgespielt, was bis heute beschwiegen wird. Hintergrund von Menasses Romanhandlung ist ein tatsächliches Ereignis im Burgenland, das 2007 durch einen F.A.Z.-Artikel ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit trat: das Massaker von Rechnitz an vermutlich zweihundert jüdischen Zwangsarbeitern (F.A.Z. vom 18. Oktober 2007). Ein Jahr später wurde das Drama "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek uraufgeführt, und Eva Menasse begann mit der Vorbereitung ihres Romans. Dunkelblum ist Rechnitz nachempfunden - so weit, dass der Illustrator Nikolaus Heidelbach auf seiner Planskizze des Handlungsortes für die Vorsatzpapiere des Buchs den Grundriss des zerstörten Schlosses von Dunkelblum dem des Sitzes der Grafenfamilie Batthyány in Rechnitz nachbildete. Und auch die Topographie der Umgebung des Romanschauplatzes entspricht dem realen Vorbild.
"Dunkelblum" ist jedoch auch kein Schlüsselroman, es sei denn einer mit einem Schlüssel zu den Dunkelzellen der Geschichte. Menasse bringt einiges daraus ans Licht; bei ihr kann literarisch aus der durch Hans-Jürgen Syberberg dokumentierten Hitler-Begeisterung von Winifred Wagner ein Sermon des örtlichen Altnazis Alois Ferbenz werden, aber ihre eigentliche Absicht ist ein Sittenstück, keine Historiographie. Dazu gehört, dass vieles von dem, was aufgeworfen wird an Schicksalsfragen in "Dunkelblum", persönlichen wie gesellschaftlichen, ungeklärt bleiben wird. Aber auch bezüglich der realen Ereignisse von Rechnitz sind ja etliche Sachverhalte weiterhin offen. Nicht zuletzt, wo die Leichen liegen, obwohl man weiß, dass viel mehr Menschen starben, als man Überreste gefunden hat. Das haben die wirkliche und die Romangeschichte gemein. Und das entspricht dem Naturell der Dunkelblumer, die "böswillig dieses und jenes behaupteten, weil sie gegen Geschichten, die gut ausgehen, seit unvordenklichen Zeiten ein tief eingewurzeltes Misstrauen hegen".
Was sich aber zumindest im Roman "Dunkelblum" klärt, das sind familiäre Konstellationen; vor allem die junge Generation - da hat Bürgermeister Koreny ganz recht - legt großen Aufklärungseifer an den Tag. Und nicht nur seltsam sächselnde Fremdlinge kommen plötzlich von den "Drüberischen", wie man in Dunkelblum die Ungarn nennt, sondern auch Studenten auf Exkursion aus Wien, die sich ungebührlich für die lokalen Geheimnisse interessieren. Menasse entwickelt über die Schilderungen dieser Grabungen nach Gräbern eine allumfassende Wassermetaphorik: Unterirdisch ist alles vernetzt in Dunkelblum, aber auch nichts zu greifen.
Und doch gibt es so etwas wie den tschechowschen Revolver. Das ist hier ein Zeitungsartikel, der sehr früh im Roman von einem Fremden, der sich verdächtig lange im Grenzkaff herumtreiben wird, auf der Anreise im Bus gelesen wurde und 450 Seiten später einen Skandal ins Rollen bringt. Menasse inszeniert ihr Kleinstadtspiegelbild unserer Gesellschaft unendlich viel subtiler als Juli Zeh, deren Romane "Unterleuten" und "Über Menschen" ein ähnlich sozialkritisches Ziel verfolgen.
Menasse hat Zeh auch den Schmäh voraus, ihr Buch ist bitterkomisch. "Jedes Mal, wenn Gott von oben in die Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen", steht gleich auf der ersten Seite. Aber wo bleibt da neben Gott und Teufel die dritte Baumeisterin von Dunkelblum, die Autorin des Romans? Sie ist nur zwei Sätze später in all ihrem Sarkasmus da: "Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen." Den Einblick in dunkle Seelen soll eben nur die Literatur wagen. Solche Literatur. ANDREAS PLATTHAUS.
Eva Menasse: "Dunkelblum". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 524 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Es ist das einzige hochkomische Buch in diesem Quartett, doch zugleich ist es - dem Titel gemäß - eine tieffinstere Geschichte. Eine, die am Epocheneinschnitt von 1989 angesiedelt ist, und das auch noch an der ungarisch-österreichischen Grenze, die im damaligen Sommer zum Sehnsuchtsort wurde: Mit dem Zustrom von Fluchtwilligen aus der DDR hierher und der zeitweisen Öffnung des Eisernen Vorhangs für sie begann der Kollaps des Ostblocks. Aber "Dunkelblum" ist kein Wenderoman. Sein Thema reicht weiter zurück ins zwanzigste Jahrhundert.
Vielen ist angesichts dessen unheimlich zumute in Dunkelblum, einer kleinen Grenzstadt im Burgenland, auch dem Bürgermeister Koreny: "Wahrscheinlich ist das nicht wichtig, aber die Tochter vom Malnitz, die jüngste, die goscherte, weißt eh, die fragt jetzt dauernd herum wegen irgendwelchen uralten Geschichten, die will ein Museum machen oder zumindest eine private Ausstellung auf dem Grundstück ihrer Mutter, in Ehrenfeld. Allerdings ist da gerade der Stadel abgebrannt . . . Unserer Frau Balaskó hat sie gesagt, sie sucht nach Dunkelblumer Kriegsverbrechern, stell dir das vor, Kriegsverbrecher, bei uns! Das Mädel ist Anfang zwanzig, früher haben sich die jungen Leute für was anderes interessiert, für Tanzen und Flirten . . ." An diesem Zitat ist vieles charakteristisch für den ganzen Roman.
Einmal die Mündlichkeit des Stils: "Dunkelblum" ist ein Vielstimmengebilde, ein rundes Dutzend Haupt- und etliche Nebenfiguren kommt in Worten und Gedanken zur Sprache, und nicht selten klingt es, so wie hier, nach den "Brenner"-Kriminalromanen von Wolf Haas - schon der lokalbedingt zwingenden Austriazismen wegen, für deren Verständlichkeit beim bundesdeutschen Publikum ein siebenseitiges Glossar sorgt. Aber es gibt spät im Roman auch eine bewusst gesetzte Hommage an Haas, als dessen signature sentence "Jetzt ist schon wieder was passiert" plötzlich in indirekter Rede aufblitzt. Eva Menasse stellt sich mit Tonfall und Tönung ihres Schreibens in eine lange spezifisch österreichisch schwarzironische Tradition von Kraus und Musil über Doderer und Lernet-Holenia bis hin zu Hans Lebert oder eben Haas, und den epischen Atem dieser Autoren hat sie auch. 524 Seiten beweisen es.
Dann ist in der eben zitierten Passage der Gegensatz des Landsmannschaftlichen in Dunkelblum angesprochen. Das Burgenland kam erst nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich, vorher gehörte es zum ungarischen Reichsteil, und dorther stammen die Familiennamen Balaskó und Koreny. Malnitz dagegen ist slawischer Herkunft, und selbstverständlich hat es in Dunkelblum auch deutsche Namen: Rehberg etwa oder Reschen. Und Grün. Doch Antal Grün, der Greißler (Gemischtwarenhändler) des Ortes, ist der einzige nach dem Krieg zurückgekehrte Jude. "Wir waren einundfünfzig", sagte Antal lächelnd und mit geschlossenen Augen, "darunter ein achtzigjähriger Rabbi und mehrere Kinder. Und er erzählte dem Doktor Sterkowitz von seiner Nacht auf dem Wellenbrecher." Dieser Doktor praktiziert übrigen im Haus seines jüdischen Vorgängers.
Ganz allmählich kehrt im Roman dann auch die Vergangenheit nach Dunkelblum zurück. Vor allem deren Schatten. Der im Zitat angesprochene Brand des Stadels erweist sich als Menetekel, denn in seiner Nähe hatte sich gegen Ende des Krieges etwas abgespielt, was bis heute beschwiegen wird. Hintergrund von Menasses Romanhandlung ist ein tatsächliches Ereignis im Burgenland, das 2007 durch einen F.A.Z.-Artikel ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit trat: das Massaker von Rechnitz an vermutlich zweihundert jüdischen Zwangsarbeitern (F.A.Z. vom 18. Oktober 2007). Ein Jahr später wurde das Drama "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek uraufgeführt, und Eva Menasse begann mit der Vorbereitung ihres Romans. Dunkelblum ist Rechnitz nachempfunden - so weit, dass der Illustrator Nikolaus Heidelbach auf seiner Planskizze des Handlungsortes für die Vorsatzpapiere des Buchs den Grundriss des zerstörten Schlosses von Dunkelblum dem des Sitzes der Grafenfamilie Batthyány in Rechnitz nachbildete. Und auch die Topographie der Umgebung des Romanschauplatzes entspricht dem realen Vorbild.
"Dunkelblum" ist jedoch auch kein Schlüsselroman, es sei denn einer mit einem Schlüssel zu den Dunkelzellen der Geschichte. Menasse bringt einiges daraus ans Licht; bei ihr kann literarisch aus der durch Hans-Jürgen Syberberg dokumentierten Hitler-Begeisterung von Winifred Wagner ein Sermon des örtlichen Altnazis Alois Ferbenz werden, aber ihre eigentliche Absicht ist ein Sittenstück, keine Historiographie. Dazu gehört, dass vieles von dem, was aufgeworfen wird an Schicksalsfragen in "Dunkelblum", persönlichen wie gesellschaftlichen, ungeklärt bleiben wird. Aber auch bezüglich der realen Ereignisse von Rechnitz sind ja etliche Sachverhalte weiterhin offen. Nicht zuletzt, wo die Leichen liegen, obwohl man weiß, dass viel mehr Menschen starben, als man Überreste gefunden hat. Das haben die wirkliche und die Romangeschichte gemein. Und das entspricht dem Naturell der Dunkelblumer, die "böswillig dieses und jenes behaupteten, weil sie gegen Geschichten, die gut ausgehen, seit unvordenklichen Zeiten ein tief eingewurzeltes Misstrauen hegen".
Was sich aber zumindest im Roman "Dunkelblum" klärt, das sind familiäre Konstellationen; vor allem die junge Generation - da hat Bürgermeister Koreny ganz recht - legt großen Aufklärungseifer an den Tag. Und nicht nur seltsam sächselnde Fremdlinge kommen plötzlich von den "Drüberischen", wie man in Dunkelblum die Ungarn nennt, sondern auch Studenten auf Exkursion aus Wien, die sich ungebührlich für die lokalen Geheimnisse interessieren. Menasse entwickelt über die Schilderungen dieser Grabungen nach Gräbern eine allumfassende Wassermetaphorik: Unterirdisch ist alles vernetzt in Dunkelblum, aber auch nichts zu greifen.
Und doch gibt es so etwas wie den tschechowschen Revolver. Das ist hier ein Zeitungsartikel, der sehr früh im Roman von einem Fremden, der sich verdächtig lange im Grenzkaff herumtreiben wird, auf der Anreise im Bus gelesen wurde und 450 Seiten später einen Skandal ins Rollen bringt. Menasse inszeniert ihr Kleinstadtspiegelbild unserer Gesellschaft unendlich viel subtiler als Juli Zeh, deren Romane "Unterleuten" und "Über Menschen" ein ähnlich sozialkritisches Ziel verfolgen.
Menasse hat Zeh auch den Schmäh voraus, ihr Buch ist bitterkomisch. "Jedes Mal, wenn Gott von oben in die Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen", steht gleich auf der ersten Seite. Aber wo bleibt da neben Gott und Teufel die dritte Baumeisterin von Dunkelblum, die Autorin des Romans? Sie ist nur zwei Sätze später in all ihrem Sarkasmus da: "Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen." Den Einblick in dunkle Seelen soll eben nur die Literatur wagen. Solche Literatur. ANDREAS PLATTHAUS.
Eva Menasse: "Dunkelblum". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 524 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Gebundenes Buch
Es passiert einiges 1989, was die Bewohner von Dunkelblum beunruhigt. Sie hatten schon immer ihre Probleme mit den Drüberen und nun sammeln sich erneut hinter der Grenze Flüchtlinge. Außerdem taucht ein Fremder auf, der überall Fragen stellt, und dann gibt es noch die …
Mehr
Es passiert einiges 1989, was die Bewohner von Dunkelblum beunruhigt. Sie hatten schon immer ihre Probleme mit den Drüberen und nun sammeln sich erneut hinter der Grenze Flüchtlinge. Außerdem taucht ein Fremder auf, der überall Fragen stellt, und dann gibt es noch die Differenzen zum Thema Wasserversorgung. Zu allem Übel kommen dann noch junge Menschen, die den verschlossenen und verwahrlosten „dritten Friedhof“ in Ordnung bringen wollen. Die Bewohner von Dunkelblum waren in stiller Übereinkunft davon ausgegangen, dass niemand an der Vergangenheit rührt, doch nun kommen die Erinnerungen hoch.
Dunkelblum ist ein fiktiver Ort mit fiktiven Bewohnern, der in der Nähe zur ungarischen Grenze angesiedelt ist, genau in dem Teil des Burgenlandes, wo sich in den letzten Kriegstagen das Massaker von Rechnitz zugetragen hat.
Eva Menasse hat es mir am Anfang nicht leicht gemacht mit ihrem Roman, denn es gibt reichlich Personen und sie springt zwischen den Personen und den Zeiten hin und her. Es taten sich unzählige Fragen auf und sobald sich eine beantwortet hatte, gab es weitere Fragen. Doch je länger ich gelesen habe, umso mehr konnte sie und die Dunkelblumer mich packen. Die Autorin fabuliert mit Lust und legt so viele Fäden aus, dass man sich wundert, wie daraus am Ende etwas Ganzes entstehen kann. Doch diese Zweifel sind nicht angebracht, denn der Autorin gelingt es vorzüglich diese losen Fäden zu verknüpfen.
Die Figuren sind sehr gut und facettenreich gezeichnet. Auch wenn die Dunkelblumer nicht unbedingt sympathisch sind, so sind sie doch menschlich, denn jeder hat wohl seine hellen und seine dunklen Seiten. Die, welche die Vergangenheit miterlebt haben, sind wahre Meister im Verdrängen, Vergessen und Vertuschen. Dabei wissen nicht alle, was da wirklich geschehen ist, das wissen laut Eva Menasse nur „alle Beteiligten gemeinsam“. Doch ihnen allen ist gemein, dass sie an der Vergangenheit nicht rühren wollen. Gleichwohl erfahren wir Leser, was geschehen ist, wie man sich schuldig gemacht oder weggesehen hat, wie man eingesteckt und ausgeteilt hat, wie dies so zurechtgerückt wurde, dass das Leben weitergehen konnte, als sei nichts geschehen.
Die Atmosphäre in Dunkelblum ist ziemlich düster und die Geheimnisse sind es auch.
Ich bin froh, dass mich meine Anfangsschwierigkeiten mit „Dunkelblum“ nicht abgeschreckt haben, denn dieser Roman ist wirklich ein Highlight und er schreit förmlich danach, nochmal gelesen zu werden, weil es in dieser komplexen Geschichte sicherlich noch einiges zu entdecken gibt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Dorfromane fluten bereits seit einiger Zeit den Büchermarkt, und spätestens seit Juli Zeehs „Unterleuten“ zeigen sie auch jenseits der Heimeligkeit die Untiefen, die in diesem geschlossenen Mikrokosmos lauern. Seit Generationen schwelende Streitigkeiten, aber auch gravierende …
Mehr
Dorfromane fluten bereits seit einiger Zeit den Büchermarkt, und spätestens seit Juli Zeehs „Unterleuten“ zeigen sie auch jenseits der Heimeligkeit die Untiefen, die in diesem geschlossenen Mikrokosmos lauern. Seit Generationen schwelende Streitigkeiten, aber auch gravierende Ereignisse, deren Einfluss auf das Miteinander im Endeffekt für das Zusammengehörigkeitsgefühl gegenüber allem Fremden verantwortlich ist.
Eva Menasses neuer Roman hat einen realen Hintergrund, auch wenn Dunkelblum ein fiktiver Ort ist (steht stellvertretend für Rechnitz). Aber die Ereignisse in dieser Gemeinde im Burgenland, unweit der ungarischen Grenze, fungieren als Beispiel für eine geografischen Region, die sich als das letzte westliche Bollwerk versteht und in der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs unzählige Massaker an Zwangsarbeitern verübt wurden. Verscharrt in eilig ausgehobenen Massengräbern. Totgeschwiegen. Aus der kollektiven Erinnerung gestrichen. Verleugnet, verschwiegen und vergessen. Und dennoch eingegraben in die Biografie jedes Einzelnen.
Aber die Zeiten ändern sich, 1989 fällt der eiserne Vorhang fällt, die Grenzen nach Osten sind offen, die Vergangenheit hält Einzug in das Leben der Dörfler. Flüchtlinge aus der ehemaligen DDR drängen in die Freiheit, werden mit Tritten und nicht mit offenen Armen empfangen. Eine Studentengruppe aus Wien kümmert sich um den verwahrlosten jüdischen Friedhof, stellt unangenehme Fragen, wie der Besucher aus Übersee. Und plötzlich ist die Vergangenheit wieder präsent.
Eine Unzahl von Personen, Stimmen und Meinungen sowie wechselnde Erzählperspektiven stellen hohe Anforderungen an die Leser*in, machen die Lektüre zu Beginn sperrig und verwirrend. Aber je tiefer man in diesen dörflichen Kosmos eintaucht, desto klarer wird die Dynamik innerhalb der Gruppe, der Umgang jedes Einzelnen mit der Schuld, die dieses Dorf in dunklen Zeiten auf sich geladen hat und die bis in die heutige Zeit hineinreicht. Vergangenheitsbewältigung? Fehlanzeige.
Dunkelblum ist überall, nicht nur im österreichischen Burgenland.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Klappentext:
„Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten …
Mehr
Klappentext:
„Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter. In den Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein. Da geraten die Dinge plötzlich in Bewegung: Auf einer Wiese am Stadtrand wird ein Skelett ausgegraben und eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk tauchen Spuren des alten Verbrechens auf – und konfrontieren die Dunkelblumer mit einer Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten.“
Autorin Eva Menasse nimmt den Leser hier mit nach Dunkelblum - ein Ort, in dem ein dunkles Geheimnis von allen gehütet wird…Das dieses Geheimnis irgendwann bricht und an die Oberfläche will, ahnt man und man verfolgt diese Geschichte sehr genau. Menasse hat einen speziellen Sprachstil und Ausdruck. Ich persönlich mag dies sehr und find dies zu ihrer Geschichte mehr als passend, aber ich denke, es wird Leser geben, die sich damit schwer tun. Eva Menasse beleuchtet hier wieder ein Stück Weltpolitik und hält mit vielen Fakten auch einfach nicht hinter‘m Berg. Die Art und Weise wie sie die Bewohner zeichnet und wie sie dieses Geheimnis eingewoben hat, ist großartig. Hier geht es um Schuld und Sühne, um Schweigen und die Frage, ob dies so richtig war und gerechtfertigt. Dieses Geheimnis sitzt auf den Seelen der Dorfbewohner wie ein Fluch und die langsame Auflösung, nicht nur beim Leser, bringt ein gewisses Bild, ein gewisses Licht ins Dunkel. Der Spannungsbogen ist hier enorm und hat mich echt begeistert. Hier steht: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen - was ich nicht sage, kann niemand kennen und wissen, was ich nicht weiß, können andere auch nicht wissen. Dunkelblum nimmt einen ein und man muss gewaltig aufpassen, nicht in die Fänge der Dorfbewohner zu gelangen…Denn hier stellt sich die Frage, was passiert wohl wenn das Geheimnis gelüftet wird?? Ach ja! Welches Geheimnis? Haben Sie etwas von einem Geheimnis gelesen? Doch nicht in Dunkelblum!
Ich vergebe 5 von 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Fehlende Spannung
Lange habe ich überlegt, ob ich dieses Buch überhaupt lesen soll. Aber da ich Eva Menasse als gute Autorin kenne und wegen der Vielzahl guter Kritiken, habe ich mich dazu entschlossen.
Dennoch war es recht mühsam. In diesem Dorfroman kommen unzählige …
Mehr
Fehlende Spannung
Lange habe ich überlegt, ob ich dieses Buch überhaupt lesen soll. Aber da ich Eva Menasse als gute Autorin kenne und wegen der Vielzahl guter Kritiken, habe ich mich dazu entschlossen.
Dennoch war es recht mühsam. In diesem Dorfroman kommen unzählige Figuren vor. Mitgefiebert habe ich nur mit zweien: Horka, das Nazi-Ungeheuer, das Ende des Krieges noch zwei Russen platt machte, dann erst Polizeichef wurde, um sich dann ins Ausland abzusetzen.
Und Flocke, die die Kriegsverbrechen an jüdischen Zwangsarbeitern aufklären will, aber auf Widerstand stößt und dann vermisst wird.
Einerseits ist es nicht nötig, sich alle Figuren zu merken, andererseits geht durch diese umfassende Erzählweise die Spannung verloren, so dass 512 Seiten zu harter Arbeit werden. 3 Sterne
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Dieses Buch klang im Klappentext sehr vielversprechend, aber leider konnte es meine Erwartungen nicht erfüllen.
Ich fand es wahnsinnig anstrengend, dieses Buch zu lesen! So viele Personen, dass man kaum den Überblick behalten kann - und trotzdem kommen noch immer mehr dazu! Aber keine …
Mehr
Dieses Buch klang im Klappentext sehr vielversprechend, aber leider konnte es meine Erwartungen nicht erfüllen.
Ich fand es wahnsinnig anstrengend, dieses Buch zu lesen! So viele Personen, dass man kaum den Überblick behalten kann - und trotzdem kommen noch immer mehr dazu! Aber keine dieser Personen bleibt wirklich im Gedächtnis, alle kamen mir zu oberflächlich vor.
Ständig gibt es Cliffhanger, die dann aber entweder nicht aufgeklärt werden oder einfach im Nichts verlaufen. Irgendwie fehlt der ganzen Geschichte das Fundament. Die letzten 200 Seiten habe ich nur noch quergelesen, in der Hoffnung, dass es zu einem spannenden Finale kommt. Aber auch das war nicht der Fall.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Und schon wieder ein Buch über die Nazivergangenheit - hat man doch bereits -zigmal gelesen, mag so Manche/r denken.
Aber dieses Buch ist etwas Besonderes und unbedingt lesenswert, auch wenn der Inhalt vielleicht nicht ganz so überraschend sein mag.
Dunkelblum ist eine fiktive …
Mehr
Und schon wieder ein Buch über die Nazivergangenheit - hat man doch bereits -zigmal gelesen, mag so Manche/r denken.
Aber dieses Buch ist etwas Besonderes und unbedingt lesenswert, auch wenn der Inhalt vielleicht nicht ganz so überraschend sein mag.
Dunkelblum ist eine fiktive Kleinstadt in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Ungarn, dort "wissen die Einheimischen alles voneinander, und die paar Winzigkeiten, die sie nicht wissen, die sie nicht hinzuerfinden können und auch nicht einfach weglassen, die sind nicht egal, sondern spielen die allergrößte Rolle: Das was nicht allseits bekannt ist, regiert wie ein Fluch."
Meist sind es Dinge aus der Vergangenheit, damals als der Horka der Schrecken des Ortes war. Während der Naziherrschaft konnte dieser ohne Folgen seinen sadistischen Neigungen nachgehen und als die Russen das Sagen hatten, brachte er es sogar zum Polizeichef. Doch nun, es ist 1989, beginnt die junge Generation sich für längst Vergangenes zu interessieren: Die jüngste Tochter des Biobauern plant mit dem Dorfchronisten ein Heimatmuseum und beginnt, unangenehme Fragen zu stellen. Und aus der Hauptstadt reisen Studierende an, um den örtlichen jüdischen Friedhof zu restaurieren. Als auf einer Wiese ein Skelett gefunden wird und die Presse davon Wind bekommt, wird das Interesse an Dunkelblums Vergangenheit immer größer, die wider Willen der BewohnerInnen deutlich bis in die Gegenwart reicht.
Eva Menasse präsentiert uns hier eine Vielzahl von Menschen eines Ortes, die aufgrund ihrer Herkunft alle miteinander verbunden sind, im Guten wie im Schlechten. Einen solchen Mikrokosmos zu entwerfen haben bereits Andere vor ihr gemacht (beispielsweise Juli Zeh in Unterleuten oder Raphaela Edelbauer in Das flüssige Land), doch nicht mit derart feinen Verflechtungen innerhalb eines sozialen Netzes und ebenso wenig mit diesem wundervoll schwarzhumorig-ironischen Tonfall.
"Unserer Frau Balaskó hat sie gesagt, sie sucht nach Dunkelblumer Kriegsverbrechern, stell dir das vor, Kriegsverbrecher, bei uns! Das Mädel ist Anfang zwanzig, früher haben sich die jungen Leute für was anderes interessiert, für Tanzen und Flirten . . .".
Auch wenn die Geschichte auf der des realen Ortes Rechnitz beruht, ist es keine Aufarbeitung der dortigen Geschehnisse. Es geht um den Umgang mit der Vergangenheit Jahrzehnte danach: Verdrängung, Rechtfertigung, Verleugnung ... Und was mit den Menschen geschehen ist und geschieht, wenn sich die Wahrheit ans Licht drängt. Ein grandioses Buch!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für