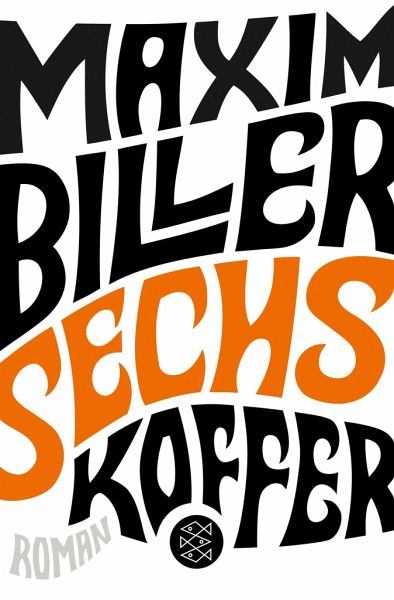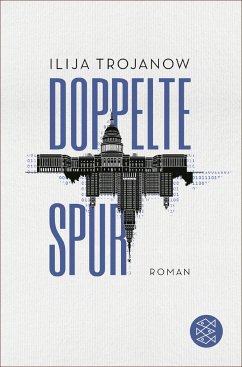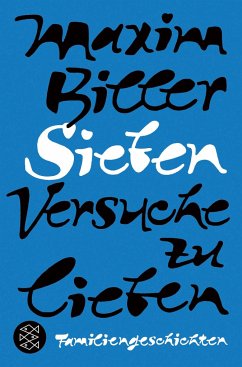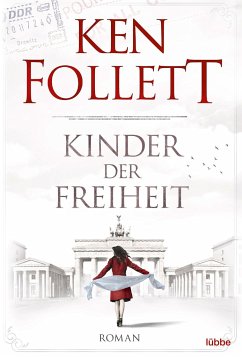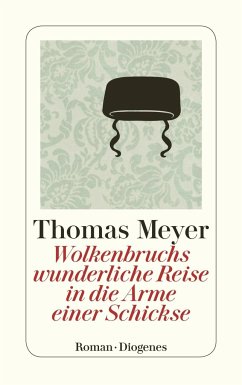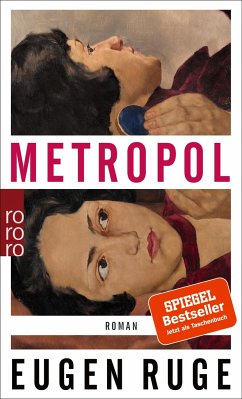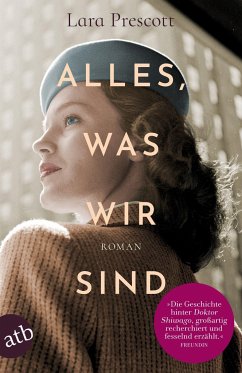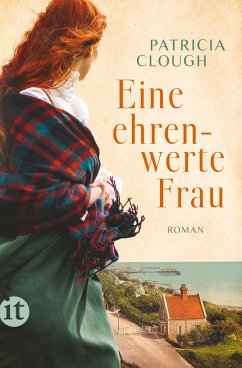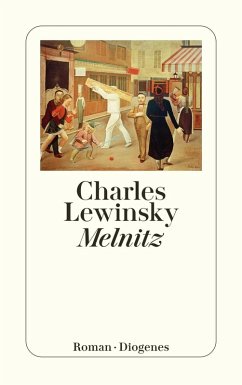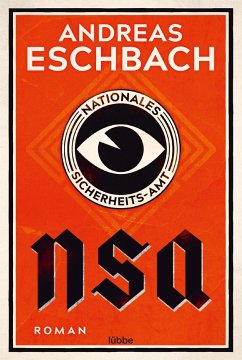Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Im Frühjahr 1960 wird der Großvater des Erzählers am Moskauer Flughafen verhaftet und bald darauf hingerichtet. Der Vorwurf: Devisenschmuggel. Aber nur jemand aus der eigenen Familie kann den Schwarzhändler und gütigen Patriarchen Schmil Grigorewitsch verraten haben. War es einer seiner schönen Söhne? Die ehrgeizige Schwiegertochter? Oder war er selbst schuld? Die Frage, wer es gewesen sein könnte, wird zum Gerücht und Geheimnis, das von Generation zu Generation weiterlebt - in Maxim Billers eigener Familie. Sein Roman »Sechs Koffer« erzählt davon - literarisch virtuos, spannend wi...
Im Frühjahr 1960 wird der Großvater des Erzählers am Moskauer Flughafen verhaftet und bald darauf hingerichtet. Der Vorwurf: Devisenschmuggel. Aber nur jemand aus der eigenen Familie kann den Schwarzhändler und gütigen Patriarchen Schmil Grigorewitsch verraten haben. War es einer seiner schönen Söhne? Die ehrgeizige Schwiegertochter? Oder war er selbst schuld? Die Frage, wer es gewesen sein könnte, wird zum Gerücht und Geheimnis, das von Generation zu Generation weiterlebt - in Maxim Billers eigener Familie. Sein Roman »Sechs Koffer« erzählt davon - literarisch virtuos, spannend wie ein Krimi und mit der Intensität eines psychologischen Familiendramas.»Wie hütet man ein Familiengeheimnis? Indem man es allen erzählt. Maxim Biller ist mit diesem Buch ein wahres Kunststück gelungen.« Durs Grünbein»Dieser Roman ist ein kunstvoll geschliffener Edelstein. Immer wieder blitzt eine andere Facette auf, bricht ein anderer Schein hervor, eine neue geschliffene Seite. Eine Epoche ist darin eingeschlossen, die Härte einer Zeit, so rätselhaft klar.«Robert Menasse
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Er ist Autor der Romane 'Esra' und 'Die Tochter', der Erzählbände 'Liebe heute', 'Bernsteintage', 'Land der Väter und Verräter' und 'Wenn ich einmal reich und tot bin', der Essaybände 'Die Tempojahre' und 'Deutschbuch' sowie des autobiographischen Bands 'Der gebrauchte Jude'; darüber hinaus schreibt er Theaterstücke ('Kanalratten') und Kolumnen. Zuletzt erschienen seine Novelle 'Im Kopf von Bruno Schulz', sein monumentaler Roman 'Biografie', der Roman 'Sechs Koffer', der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand, der Erzählband 'Sieben Versuche zu lieben. Familiengeschichten' sowie der Roman 'Der falsche Gruß'.
Produktdetails
- Fischer Taschenbücher 70016
- Verlag: FISCHER Taschenbuch / S. Fischer Verlag
- Artikelnr. des Verlages: 1024519
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 196
- Erscheinungstermin: 29. Juli 2020
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 125mm x 14mm
- Gewicht: 230g
- ISBN-13: 9783596700165
- ISBN-10: 3596700167
- Artikelnr.: 57954688
Herstellerkennzeichnung
FISCHER Taschenbuch
Hedderichstr. 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
»Große Literatur« David Baum stern 20180809
Der Erzähler wächst auf mit einer Schwester, seinen Eltern, einem Bruder des Vaters, dessen Frau und deren Tochter. Ein weiterer Bruder des Vaters ist im Ausland. Der Großvater starb vor seiner Geburt. Der Erzähler ist mal im Vordergrund, mal im Hintergrund. Die Eltern mag er, …
Mehr
Der Erzähler wächst auf mit einer Schwester, seinen Eltern, einem Bruder des Vaters, dessen Frau und deren Tochter. Ein weiterer Bruder des Vaters ist im Ausland. Der Großvater starb vor seiner Geburt. Der Erzähler ist mal im Vordergrund, mal im Hintergrund. Die Eltern mag er, einen Onkel sieht er, den zweiten nicht; die Gefühle bekommen keinen Namen, die Personen schon. Es scheint, als sei der Großvater für alle in der Familie ein lebendiger Großvater, auch für den Erzähler, der ihn nicht traf. West-Berlin, Zürich, Ost-Berlin, Hamburg, Prag - eine europäische Familie. Ist die im Buch erzählte Ablehnung des Wahrens von Familiengeheimnissen echt oder wird sie durch das Buch widerlegt? Diese ungelöste Frage gefiel mir.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
„Wäre ich geblieben, wäre ich geflohen, hätte ich selbst meine engsten Freunde und Verwandten verraten, wenn die Kommunisten mich erwischt hätten?“ (Zitat Seite 90)
Inhalt:
Der Großvater der Familie wird 1960 auf dem Flughafen von Moskau verhaftet und wegen …
Mehr
„Wäre ich geblieben, wäre ich geflohen, hätte ich selbst meine engsten Freunde und Verwandten verraten, wenn die Kommunisten mich erwischt hätten?“ (Zitat Seite 90)
Inhalt:
Der Großvater der Familie wird 1960 auf dem Flughafen von Moskau verhaftet und wegen seiner verbotenen Devisengeschäfte hingerichtet. Kurz danach war einer seiner Söhne, Dima, ebenfalls verhaftet worden, weil er, in Prag lebend, nach Westberlin flüchten wollte. Seither stellt sich in der Familie durch die Jahre und Generationen die Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt, war es Dima, der damals den Großvater verraten hatte?
Thema und Genre:
Der Autor erzählt einen biografischen Generationenroman, eingebettet in eine Zeit der Geheimdienste, der Vertreibungen – eine Flucht quer durch Europa und darüber hinaus. Kernpunkt ist die Familie und ein Verdacht, der ihre Mitglieder entzweit. Es geht auch um die zeitlose Frage, wie man selbst sich verhalten hätte, unter extremem Druck und Lebensgefahr.
Handlung und Schreibstil:
Jemand hat den Großvater verraten, was diesen das Leben gekostet hat und der Verdacht und die Suche nach der Wahrheit zieht sich über die Generationen. Der Zeitablauf ist chronologisch, in Einzelkapitel und Einzelgeschichten gegliedert. Die Personen im Mittelpunkt wechseln, wie auch die Erzählform vom Ich zur personalen Erzählperspektive dort, wo der Ich-Erzähler eine vergangene Geschichte selbst nur kennt, weil sie ihm erzählt wurde. Die Frage nach dem Verräter aus dem Kreis der Familie baut den Spannungsbogen auf und bringt Elemente eines Kriminalromans in dieses Buch.
Fazit:
Das Schicksal einer russisch-jüdischen Familie, Verrat, Flucht, Ankommen und die Frage nach einem Verrat. Erzählt auf verhältnismäßig wenigen Seiten, aber so lebendig und packend, dass die Geschichte den Leser sofort in ihren Bann zieht.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
Was man so mit sich rumträgt
Das sind in diesem Falle die Päckchen einer ganzen Familie, der Vater, der Tate, Schmil Grigorewitsch nämlich und dessen vier Söhne, von denen zwei eine eigene Familie haben. Jedenfalls eine, die in diesem Roman vorkommt. Maxim Biller selbst ist ein …
Mehr
Was man so mit sich rumträgt
Das sind in diesem Falle die Päckchen einer ganzen Familie, der Vater, der Tate, Schmil Grigorewitsch nämlich und dessen vier Söhne, von denen zwei eine eigene Familie haben. Jedenfalls eine, die in diesem Roman vorkommt. Maxim Biller selbst ist ein Enkel: Sohn von Sjoma, dem jüngsten Sohn. Es sind russische Juden, der Tate selbst wurde 1960 in der Sowjetunion hingerichtet.
Im Geburtsjahr Maxim Billers, dessen Wiege allerdings in Prag stand. Man sieht, die Verhältnisse in diesem kurzen, keine zweihundert Seiten langen Roman sind überaus komplex. Zunächst deswegen, weil die Protagonisten alle echt sind: die tatsächlichen Familienmitglieder des Autors, hauptsächlich seine Vorfahren.
Und sie alle stehen im Kreuzfeuer, wenn es um die zentrale Frage geht: wer trägt die Schuld am Tode des Taten, wer hat ihn denunziert? Einer der Söhne? Wenn ja, welcher?
Denn diese sind zum Todeszeitpunkt des Vaters bereits weit in der Welt verstreut, zwei befinden sich in Tschechien, die beiden anderen in Berlin (West) und in Brasilien.
Der Autor spielt sowohl mit den Ereignissen als auch mit den Figuren und mir als Leserin blieb seine Intention ein wenig fremd. Auch er selbst - als Ich-Erzähler ist ein wichtiger Faktor in der Geschichte. Ist es also sein Standpunkt, den er wiedergibt? Oder ein Standpunkt, den er sich ausleiht? Sind es Fakten oder ist es Fiktion, die hier wiedergegeben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er oder sein Verlag mir antworten würden, das sei nicht von Belang.
Was mich allerdings durchaus erfasst, ist das Thema Exil, das sich wie ein roter Faden durch den Roman zieht - Exil und stellenweise Verfolgung, das sind Elemente, mit denen auch meine Familie über Jahrzehnte hinweg konfrontiert war - dieses Getriebensein, diese Unruhe, die sich durch die gesamte Handlung zog, die konnte ich sehr gut nachempfinden.
Aber ich bin eine Leserin, die ganz gerne die Kontrolle behält über ihre Lektüre. Die sich ungern treiben lässt, zumindest hinsichtlich des Wahrheitsgehalts ihrer Lektüre. Hier kann alles sein, muss aber nicht. Ohne Frage ein wahnwitziges Unterfangen, aber eines, das mich ziemlich befremdet zurück lässt.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
Go West Familiengeschichte
Der Großvater des Ich-Erzählers wird 1960 in Moskau an die Kommunisten ausgeliefert und umgebracht und jeder der vier Söhne überlegt, wer ihn verraten haben könnte. Wladamir und Lev sind 1952 bereits in den Westen geflohen. Smoja, der Vater des …
Mehr
Go West Familiengeschichte
Der Großvater des Ich-Erzählers wird 1960 in Moskau an die Kommunisten ausgeliefert und umgebracht und jeder der vier Söhne überlegt, wer ihn verraten haben könnte. Wladamir und Lev sind 1952 bereits in den Westen geflohen. Smoja, der Vater des Ich-Erzählers, und Dima leben noch in Prag. Dima war selbst 5 Jahre in Haft.
Hat er den Vater verraten? Oder vielleicht Natalia, seine Frau, die eigentlich Smoja geliebt hat, dann aber, weil sie keine Kinder haben wollte, doch den anderen geheiratet hat. Im Gegensatz zu „Ida“ ist diese Geschichte sehr spannend. Auch der Täter wird auf S.176 genannt, hier aber nicht.
Einzige Kritik: Warum erfährt der Ich-Erzähler was im fünften Kapitel gesagt wird? Hat Lev mit ihm gesprochen, nachdem er ins Fernsehen gegangen war? Und was soll das letzte Kapitel?
Die Schwester des Ich-Erzählers kommt nach Hamburg um den NDR ein Interview zu geben und um danach „meine Eltern“ zu besuchen, die aber unsere Eltern sind. Merkwürdig und merkwürdig ist auch, dass der Leser ja schon alles weiß. Dient das Ende nur dazu, Verwirrung zu stiften?
Es ist wie "die Obstdiebin" von Handke ein gelungenes Buch, dass besser auf S.179 anstatt auf S.197 geendet hätte. 4 Sterne
Lieblingszitat: „Ich will nur wissen, was mit dem Taten war [jiddisch für Großvater...]. Aber jeder erzählt mir etwas anderes – oder gar nichts.“ (S.99)
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
Maxim Billers autobiographisch geprägter Roman „Sechs Koffer“ beschreibt die versuchte Auflösung eines großen Familiengeheimnisses. Die Ermordung des „Taten“ (das jiddische Wort für Vater) durch die Sowjets und die Frage, wer ihn und seine …
Mehr
Maxim Billers autobiographisch geprägter Roman „Sechs Koffer“ beschreibt die versuchte Auflösung eines großen Familiengeheimnisses. Die Ermordung des „Taten“ (das jiddische Wort für Vater) durch die Sowjets und die Frage, wer ihn und seine Schwarzmarktgeschäfte verraten hat, sind das Herzstück des Romans um das die Geschichten der vier Söhne und ihren Familien kreisen. Aus sechs Perspektiven erzählt Biller die Familiengeschichte, den Weg von Prag nach Westdeutschland, die Suche nach dem Vertrauten, wo alles so fremd ist und eben auch die Suche des Erzählers nach der Auflösung der großen Frage, wer den Verrat begangen hat.
„Sechs Koffer“ hat es bis auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft und alles, was ich zuvor über den Roman gehört und gelesen hatte, hatte große Erwartungen geweckt. Diese wurde jedoch für mich leider nicht ganz erfüllt. Zwar ist die Geschichte durchaus interessant und die Perspektivwechsel sind spannend, der Erzähler bleibt als zentrale Figur bei allen Geschichten dabei und sortiert quasi für den Leser die Erinnerungen. Doch die Figuren selbst sind für mich einfach zu platt und klischeehaft geblieben, sie kamen mir vor wie Hüllen, denen nicht genug Inhalt gegeben wurde um die Geschichte voranzutreiben. Alles bleibt etwas schemenartig, ohne die nötige Tiefe zu entwickeln, die es meiner Meinung nach gebraucht hätte, um daraus ein Buch zu machen, dass mich begeistern kann. Auch sprachlich konnte mich der Roman nicht richtig überzeugen, es war mir alles etwas zu hölzern, um auszugleichen, was mir beim Personal fehlte.
Maxim Billers Roman „Sechs Koffer“ behandelt eine an sich spannende Geschichte, die durch Perspektivwechsel unterhaltsam und interessant bleibt. Mich konnte die Umsetzung aber nicht richtig überzeugen, da die Figuren mich als Leser einfach nicht erreicht haben und mir auch die Sprache zu steif hölzern war.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
Gekonnt oder nicht?
Der neue Roman «Sechs Koffer» von Maxim Biller hat es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft, und wie so oft in seinem Œuvre ist die Kritik auch hier recht geteilt. Kontroverse Reaktionen begleiten den literarischen Weg des streitbaren …
Mehr
Gekonnt oder nicht?
Der neue Roman «Sechs Koffer» von Maxim Biller hat es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft, und wie so oft in seinem Œuvre ist die Kritik auch hier recht geteilt. Kontroverse Reaktionen begleiten den literarischen Weg des streitbaren Schriftstellers ja vom Beginn an, eines seiner Werke, der Roman «Esra», ist in Deutschland sogar mit einem Veröffentlichungsverbot belegt. Seinen schreibenden Kollegen hat er in einem Vortrag in der Evangelischen Akademie Tutzing frech vorgeworfen, «Schlappschwanz-Literatur» zu produzieren und «das handwerkliche Prinzip ‹Moral›» zu ignorieren. Ich erinnere mich auch an einen Auftritt von ihm im Literarischen Quartett 2.0 Weidermannscher Prägung, wo er über den Autor des besprochenen Buches selbstherrlich «er kann es nicht» geäußert hat, eine abstoßende, arrogante Provokation unter Kollegen. Kann er es denn selbst, habe ich mich gefragt.
Als dezidiert jüdischer Autor thematisiert Maxim Biller hier einen tödlich endenden Verrat, dem der Tate zum Opfer fiel, wobei es jemand aus der Familie gewesen sein muss, der den Vater denunziert hat. In dem autobiografischen Roman tritt als Ich-Erzähler der sechsjährige Enkel des 1960 wegen Schwarzmarktgeschäften und Devisenvergehen hingerichteten Taten auf, den die Frage umtreibt, wer denn nun den Großvater verraten hat, einer der vier Söhne oder eine der beiden Schwiegertöchter. In sechs Kapiteln und in häufig wechselnden Episoden wird die Geschichte einer weitzerstreut lebenden Familie erzählt, beginnend an dem Tag, als sein Onkel Dima aus dem Gefängnis in Prag entlassen wird, wo er vier Jahre lang wegen Devisenschmuggel und versuchter Republikflucht eingesessen hat. War er der Verräter? Oder Natalia, seine Frau, die schöne Filmregisseurin, die in London lebt? Aber auch Sjoma, der eigene Vater, oder Rada, seine Mutter könnten es gewesen sein, oder der reiche Onkel Lev, der in Zürich lebt, und auch Wladimir, der Onkel in Südamerika, ist verdächtig. In Episoden ohne chronologischen Zusammenhang wird mit großen Zeitsprüngen in einer unkonventionellen Mischung aus personaler und auktorialer Erzählweise aus dem Leben dieser jüdischen Familie erzählt, die aus Moskau stammend nach Prag gegangen war und schließlich in Deutschland sesshaft wurde. Es ist die existentielle Geschichte einer zerrissenen Familie voller Misstrauen und Zweifel, die - durch totalitäre Systeme heimatlos geworden - überall und nirgends zu Hause ist.
Es geht nicht um den Verrat als solchen, es geht um die Bedingungen des Verrats in diesem wehmütigen, autofiktionalen Kurzroman, bei dem erzählerische Verlässlichkeit absolut Fehlanzeige ist in Anbetracht diverser Ungereimtheiten. Stilistisch wirkt dieses Verwirrspiel um familiären Neid eher wie ein Essay mit seinen unscharf gezeichneten, schablonenhaften Figuren, die seelisch karg erscheinend emotionalen Tiefgang vermissen lassen und obendrein auch noch als Typen völlig uninteressant bleiben. Geradezu verstörend wirkt außerdem die nassforsche, krawallartige Diktion von Maxim Biller, in der sich simple, negativ wertende Adjektive häufen wie hässlich, unfreundlich, verklemmt, böse, unsympathisch, frech, um dann auf ebenso gehässige Substantive zu stoßen wie Antisemitenblick und Osteuropäergesicht, um nur einige zu nennen.
Mit dem Geld zählenden Taten wird hier zu allem Überfluss auch noch das älteste jüdische Klischee überhaupt bedient. Und die dutzendfach wiederholte Bezeichnung eines Freundes des namenlos bleibenden Erzählers als «Miloslav – oder Jaroslav – » im dritten Kapitel wird bald richtig stressig für den Leser, er wird geradezu mit der Nase auf den unzuverlässigen Erzählstil gestoßen, der in seiner Unbestimmtheit letztendlich den gesamten Roman zu einer langweiligen Lektüre macht. Ob dieser Roman also gekonnt ist, sein Autor «es kann», wie er sich auszudrücken beliebte, muss wie immer jeder für sich entscheiden, - ich habe da berechtigte Zweifel.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Buch mit Leinen-Einband
Ich gestehe, Maxim Biller ist mir unsympathisch. Die Kolumnen und Artikel, die ich kenne, sind voller Wut, Selbstgerechtigkeit und Arroganz. Und so war ich gespannt, was mich bei diesem Buch erwartet und habe mein Möglichstes getan, es ohne Vorurteile zu lesen. Nicht ganz einfach, gebe ich zu …
Mehr
Ich gestehe, Maxim Biller ist mir unsympathisch. Die Kolumnen und Artikel, die ich kenne, sind voller Wut, Selbstgerechtigkeit und Arroganz. Und so war ich gespannt, was mich bei diesem Buch erwartet und habe mein Möglichstes getan, es ohne Vorurteile zu lesen. Nicht ganz einfach, gebe ich zu ;-) Doch für einen derart streitsüchtigen Autor wie Maxim Biller ist es ein unerwartet sanftes und trauriges Buch, wobei das traurig weniger überraschend ist. Irgendwoher muss seine permanente Wut ja kommen.
Aufgrund des Verrats eines Familienmitglieds wurde Großvater Tate vom KGB wegen 'Wirtschaftsverbrechen' hingerichtet; über die genaueren Einzelheiten wird nicht gesprochen. In sechs Abschnitten schildert der Enkel als allwissender Erzähler die Geschehnisse aus Sicht verschiedener Familienmitglieder, wobei man glaubt, der Lösung jeweils näher gerückt zu sein - um dann im nächsten Kapitel eines Besseren belehrt zu werden. Zeitgleich wird auch die Lebensgeschichte der jeweiligen Person beschrieben, sodass sich nach und nach eine fast vollständige Familiensaga des letzten Jahrhunderts darstellt, mit all den komplexen Verflechtungen untereinander.
Es ist kein Buch, bei dem man mit den Figuren fühlt und leidet. Nicht, dass sie nichtssagend wären, ganz im Gegenteil. Alle besitzen etwas Außergewöhnliches, doch sobald sie einen etwas zu positiven Eindruck hinterlassen könnten, werden ihre negativen Eigenschaften in den Vordergrund gestellt. Da ist die erfolgreiche, wunderschöne Natalia, die aber nur dem Geld hinterherjagt. Der liebenswerte Dima, der bedauerlicherweise etwas dumm ist. Die lebensfrohe Rada, der ihre Kinder eher eine Last sind.
Die Geschichte dieser jüdisch-tschechisch-russischen Familie jedoch ist eindringlich und sie macht deutlich, wie schwierig das Leben in einer Diktatur war. Kein Vertrauen zu niemandem, selbst nicht zu einem Kriegskameraden, dem man das Leben rettete? Wie behält man Geheimnisse in Gefangenschaft? Es sind Fragen, die sich der Enkel stellt, als er kurz davor ist, über seine Verwandten zu urteilen. Wie wäre es ihm ergangen? Was hätte er getan? Und wir?
Eine gute Geschichte, die dennoch nicht völlig frei ist von Maxim Billers Wut und Verächtlichkeit - daher drei Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für