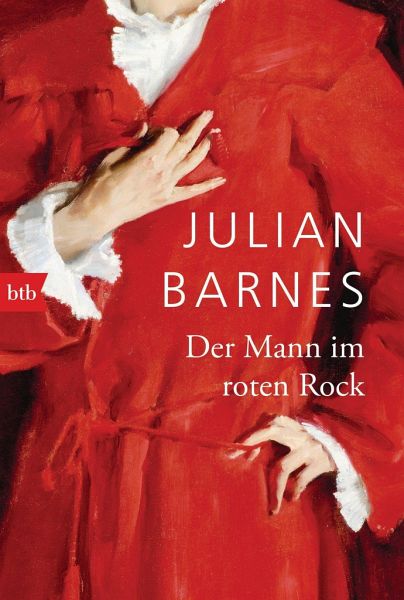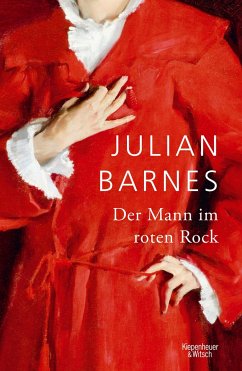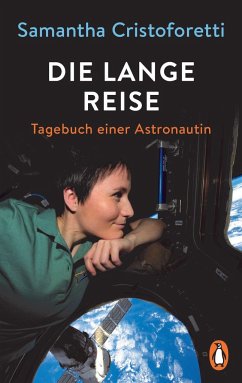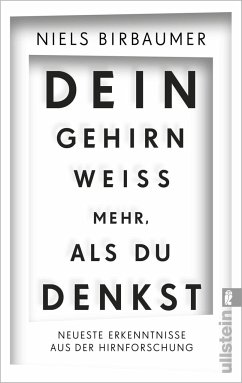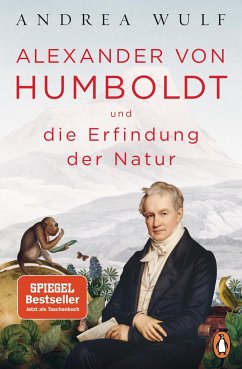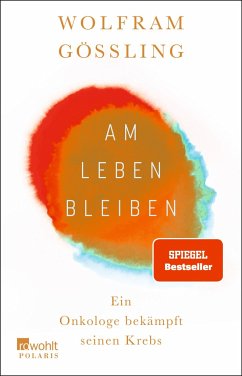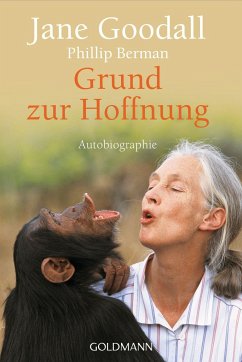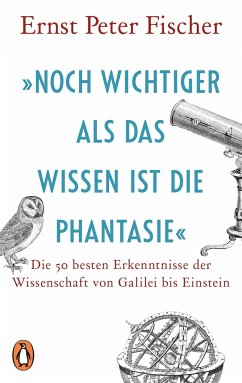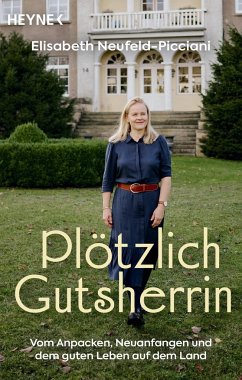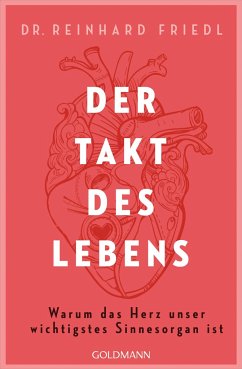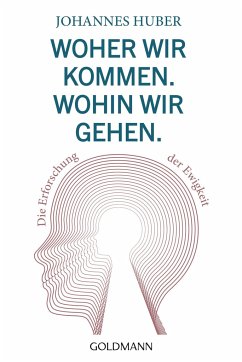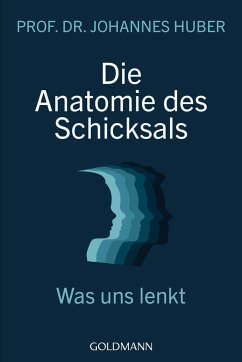Julian Barnes
Broschiertes Buch
Der Mann im roten Rock
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Julian Barnes lässt uns teilhaben am Leben von Dr. Samuel Pozzi (1846-1918), dem damals bekannten Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische. Julian Barnes zeichnet das Bild einer ganzen Epoche am Beispiel dieses charismatischen Mannes. Kenntnisreich, elegant und akribisch recherchiert, beschreibt er das privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt Kulturgeschichten über den Fin de Siècle und s...
Julian Barnes lässt uns teilhaben am Leben von Dr. Samuel Pozzi (1846-1918), dem damals bekannten Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische. Julian Barnes zeichnet das Bild einer ganzen Epoche am Beispiel dieses charismatischen Mannes. Kenntnisreich, elegant und akribisch recherchiert, beschreibt er das privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt Kulturgeschichten über den Fin de Siècle und seine Protagonistinnen und Protagonisten: Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller. Dr. Pozzi reiste, um Erkenntnisse zu gewinnen, und stand für einen engen Austausch zwischen England und dem Kontinent. Julian Barnes beleuchtet diese fruchtbaren Beziehungen und schreibt zugleich ein spannendes Plädoyer, an der Idee Europas festzuhalten.
Ausstattung: durchgehend farbig illustrier
Ausstattung: durchgehend farbig illustrier
Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt (u.a. Man Booker Prize), liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor. Er lebt in London.
Produktdetails
- Verlag: btb
- Originaltitel: The Man in the Red Coat
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 9. Mai 2022
- Deutsch
- Abmessung: 185mm x 124mm x 29mm
- Gewicht: 338g
- ISBN-13: 9783442771813
- ISBN-10: 3442771811
- Artikelnr.: 62862028
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
»Julian Barnes neues Buch 'Der Mann im roten Rock' ist ein geistreicher, fulminanter Essay über die Kunst und das Leben - und zugleich das Plädoyer für ein weltoffenes Europa.« Ulrich Rüdenauer WDR 3 Mosaik 20210114
Im Schlafzimmer der Geschichte
Der englische Schriftsteller Julian Barnes erzählt in seinem neuen Buch aus dem Leben des französischen Mediziners Samuel Pozzi - und hält seiner britischen Heimat im Augenblick des Brexits eine Variante der Vergangenheit vor, in der Chauvinismus nicht die letzte Antwort ist.
Schon seit langem hat Julian Barnes den Nobelpreis für Literatur verdient. Um mal ganz entspannt und mit dem Unwichtigsten einzusteigen. Zum Glück hat es aber weder für Barnes selbst noch für sein Publikum je eine Rolle gespielt, ob und wann er diesen Preis denn nun kriegt. Und ob das überhaupt etwas ändern würde. Oder er das überhaupt nötig hätte. Die, die Julian Barnes lieben, wissen eh, was sie an ihm haben.
Der englische Schriftsteller Julian Barnes erzählt in seinem neuen Buch aus dem Leben des französischen Mediziners Samuel Pozzi - und hält seiner britischen Heimat im Augenblick des Brexits eine Variante der Vergangenheit vor, in der Chauvinismus nicht die letzte Antwort ist.
Schon seit langem hat Julian Barnes den Nobelpreis für Literatur verdient. Um mal ganz entspannt und mit dem Unwichtigsten einzusteigen. Zum Glück hat es aber weder für Barnes selbst noch für sein Publikum je eine Rolle gespielt, ob und wann er diesen Preis denn nun kriegt. Und ob das überhaupt etwas ändern würde. Oder er das überhaupt nötig hätte. Die, die Julian Barnes lieben, wissen eh, was sie an ihm haben.
Mehr anzeigen
Die anderen, die ihn noch kennenlernen dürfen, können sich schon jetzt freuen über ein Werk, das mit jedem früheren Buch interessanter wird. Liest man Barnes von hinten nach vorn und beginnt mit dem neuesten Buch, das in der kommenden Woche erscheint, "Der Mann im roten Rock" heißt und eine anekdotische Geschichte der französischen Belle Époque erzählt, lernt man Buch um Buch einen Autor kennen, der Sex, Politik und Geschichte in große literarische Unterhaltung verwandeln kann - und stößt schließlich am Anfang auf einen Debütanten, der schon damals, 1980, bei "Metroland", ziemlich genau weiß, was er kann. Und nicht will.
Das Zweite ist am Ende vielleicht sogar wichtiger als das Erste. Barnes kann Beziehungsromane schreiben, in denen das zerrüttete Verhältnis des späten zwanzigsten Jahrhunderts zu den Gewissheiten, welche die Jahrhunderte davor zusammengehalten haben - Glaube, Kunst, zivile Institutionen -, im Schlafzimmer aufgeführt wird: Wenn zwei Menschen sich lieben und belügen, aber gerade deswegen zusammenbleiben können, dann erzählt das eine Menge darüber, was "Wahrheit" eigentlich ist, ohne dass man dazu ein Seminar über postmoderne Theorie belegt haben muss.
Gleichzeitig will Julian Barnes von Anfang an nicht den einen, den großen Roman schreiben - auch wenn er noch so sehr Flaubert und die Russen des 19. Jahrhunderts dafür bewundert, dass sie es konnten. Julian Barnes aus Leicester, Sohn von Französischlehrer-Eltern, Bruder eines Philosophen, will viele kleine Romane. Und essayistischere Bücher zwischendurch. Er schreibt anfangs unter dem Pseudonym Dan Kavanagh zeitgleich noch Krimis über den schwulen Detektiv Duffy, aber er will auch aus seinem eigenen Leben erzählen. Und aus seinem Bücherschrank.
Barnes' Fähigkeit zur Liebe und zur Skepsis ist dabei immer gleichermaßen stark ausgeprägt. Weshalb er einerseits also einen Hang zum Beziehungsroman hat - die besten seiner kleinen Romane wie "Darüber reden" handeln davon - und andererseits einer der unprätentiösesten britischen Schriftsteller seiner Generation geblieben ist. Das ist auch nicht schwer. Denn zu dieser Generation gehören Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie, deren letzte Bücher vor allem davon handelten, wie enorm begeistert ihre Verfasser von den eigenen erzählerischen Fähigkeiten sind. Julian Barnes aber, der am 19. Januar fünfundsiebzig Jahre alt wird, scheint mehr der Maxime zu folgen, dass er immer weniger weiß, je mehr er liest. Und dass das wenige, was er verstanden hat, trotzdem am besten in Form eines Buches aufgehoben ist: Weil so ein Buch halt auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis zur Sprache bringen kann. Weil ein Buch Gesetzen folgt, die es sich selbst geschrieben hat, und so zusammenbringen kann, was bis eben vielleicht noch gar nicht zusammengehört hat. Oder nie sollte. Aber dann kommt jemand wie Julian Barnes und stellt die Verbindung her. Und für die Dauer von ein paar Seiten könnte alles so gewesen sein.
Es hört sofort auf, kompliziert zu klingen, wenn man beginnt, Barnes zu lesen. "Der Mann im roten Rock", sein neuestes Buch, ist der Versuch, aus einer Epoche anhand einer historischen Figur zu erzählen, die sie von Anfang bis Ende durchwandert hat. Es geht um den französischen Arzt Samuel Pozzi, geboren 1846, gestorben 1918. Ein Freund der Familie Proust und Geliebter der Schauspiellegende Sarah Bernhardt. Arzt des Offiziers Dreyfus (der von der Affäre). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Gynäkologie Frankreichs und Verfasser eines Standardwerks seines Fachs. Pionier der Behandlungstechniken und Hygieneregeln, fünfunddreißig Jahre lang behandelnder Arzt in einem öffentlichen Pariser Krankenhaus.
Und gemalt von John Singer Sargent. "Dr. Pozzi at home" heißt das Porträt, das Sargent 1881 malte und das diesem Buch seinen Titel gegeben hat, denn Pozzi, der "ekelhaft gut" ausgesehen haben soll, wie eine Prinzessin es sagte, die ihn kannte, trug darauf: einen roten Morgenrock. Es geht auch deshalb hier immer wieder um Schlafzimmer und was sich in ihnen abspielt, es geht um Stil und Oberflächen, um das Verhältnis von Schönheit zu Wahrheit, von Inszenierung und Realität, um ästhetisiertes Leben.
"Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes auf Seite 217. Und stellt diesen späten Satz, der genauso gut auch der erste seines neuen Buchs hätte sein können, aber in Klammern: "(Pozzi war überall)". Es ist, als wollte Barnes damit noch einmal deutlich machen - nachdem er 216 Seiten lang um seine Hauptfigur ein immer größeres Geflecht anderer Berühmtheiten gesponnen hatte, Oscar Wilde, Joris Karl Huysmans, selbst der Entdecker des Tourette-Syndroms kommen vor -, dass man Samuel Pozzis Bedeutung für die sogenannte Belle Époque bitte nicht überbewerten darf. Auch wenn ein ganzes Buch jetzt davon handelt. Aber dieses Buch collagiert nur Elemente einer Vergangenheit anhand der Materialien, die Barnes von ihr finden konnte (Tagebücher, Gemälde, Briefe, Romane, Sammelbildchen), weil sie zu finden waren. Beziehungsweise Barnes sie gefunden hat, weil er diese Zeit und ihre Literatur so liebt. Vielleicht wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden, wenn Barnes nicht 2015 in der National Portrait Gallery seiner Heimatstadt London auf Sargents "Dr. Pozzi at home" gestoßen wäre, als es dort als Leihgabe hing.
Aber es geht hier deswegen nicht um Zufall. Sondern um die Relativität einer Erzählung im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Erzählungen des Vergangenen und der Gegenwart, die ihren Sinn aus jenen Traditionen und Entwicklungen zieht, die sie in ihr zu erkennen glaubt. Wir stiften schon Sinn, indem uns etwas auffällt unter einer Million Dingen, die uns auffallen könnten - die eigentliche Erkenntnis muss aber genau darin bestehen, dass uns genau das auch auffällt. "Wir wissen es nicht", das ist das Leitmotiv dieses Buchs und letztlich auch des gesamten Werks von Julian Barnes. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir konstruieren es so, dass es zu unseren Wünschen und Affekten passt. Jahrestage kann man gern vergessen, aber diese Erkenntnis besser nicht, wann immer in der Politik die Geschichte zum Kronzeugen berufen wird.
"Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: ,Wir leben in der Belle Époque, und das sollten wir auskosten.'", schreibt Barnes einmal. "Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870-71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914-18 hielt erst 1940-41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug." Es war der Titel einer Radiosendung, aus dem dann der "Inbegriff von Frieden und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz" wurde, bevor "dieses kuschelige Fantasiegebilde - mit einiger Verspätung - vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert weggefegt wurde."
Barnes ist nie einfach nur irgendwie kalt postmodern gewesen bei seinen Experimenten mit Literatur und Wahrheit. Im Gegenteil ist das, was er in diesem neuen Buch wieder tut und auch schon in früheren Büchern tat (wie seine Collage über den Tod, "Nichts, was man fürchten müsste", oder sein Literaturroman "Flauberts Papagei") belebt von großer Sanftheit und Nachsicht. Er schaut auf die Menschen vor seiner Zeit und sieht, wie auch sie sich bemühten um Liebe, Tod und Wahrheit, und dann starben sie doch, oder brachen Herzen, die anderer und die eigenen.
Auch wenn Samuel Pozzis Modernität und Weltgewandtheit so beispielhaft waren, dass man sich gut vorstellen könnte, dass die Franzosen alle möglichen Institutionen von heute nach ihm benennen, so wie die Deutschen es mit Humboldt tun - man könnte die Jahre, die Pozzi durchlebte und Barnes mit ihm durchwandert, immer auch ganz anders beschreiben. Anhand des jüdischen Offiziers Dreyfus ist das auch geschehen, dessen ungerechtfertigte Verurteilung zum Landesverräter das Frankreich der Dritten Republik in eine tiefe Krise stürzte. Wie viele Neuerscheinungen der letzten Zeit haben irgendwelche Jahre zu Schicksalsdaten erklärt, in denen alle geheimen Ströme der Vergangenheit so neuralgisch zusammenliefen, dass ja nur genau die Gegenwart dabei herauskommen konnte, in der wir heute leben? 1913, 1917, 1919, 1815, 1979, 1981?
Der Erkenntnistheoretiker Barnes dagegen entdeckt das Porträt Pozzis ein Jahr bevor seine Leute sich für den Brexit entscheiden. Pozzi ist zwar kein Unbekannter in der französischen Geschichte, und Julian Barnes, für den Frankreich eine Sehnsuchtsheimat ist, wusste natürlich schon, wen er da vor sich hat. Aber welchen Stoff er da gefunden hat, zeigt sich erst ein Jahr später, im Lichte des Referendums über den britischen Austritt aus der EU.
Plötzlich erscheint eine fast genau hundert Jahre alte Maxime Pozzis - "Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz" - wie die Antwort auf eine sehr aktuelle Frage. "Ich habe dieses Buch im letzten Jahr vor Großbritanniens verblendetem, masochistischem Austritt aus der Europäischen Union geschrieben", erklärt Barnes in seinem Nachwort aus dem Mai 2019. "Und Dr. Pozzis Maxime kam mir oft in den Sinn, während die englische politische Elite, unfähig, sich in das Denken von Europäern hineinzuversetzen (oder nicht willens oder zu dumm dazu), sich immer wieder so benahm, als könnte das, was sie selbst wollte, und das, was passieren würde, ein und dasselbe sein. Die Engländer (nicht die Briten) rühmen sich oft allzu selbstgefällig, dass sie auf ihrer Insel glücklich und zufrieden seien und sich gar nicht für ,dieses andere' interessierten, über das man so schön lästern und leichthin Witze machen konnte."
Dieses neue Buch über den weltgewandten, allseits gebildeten, neugierigen Samuel Pozzi und seine Freunde und Feinde, die Geschichte eines Wissenschaftlers, der um die Welt reiste, um von anderen Nationen zu lernen, erscheint nicht nur zum 75. Geburtstag seines Autors. Sondern auch im ersten Jahr nach dem Brexit. Es erinnert auf jeder Seite daran, dass es einst ein Privileg der Reichen und Hochmögenden war, sich von Land zu Land bewegen zu können. Großbritannien hat sich soeben aus dem europäischen Projekt verabschiedet, diese Bewegungsfreiheit für alle zu garantieren.
Samuel Pozzi wurde am 13. Juni 1918 von einem eigenen Patienten ermordet. Bei der Notoperation hat er dem behandelnden Chirurgen erst noch selbst assistiert.
TOBIAS RÜTHER
Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Übersetzt von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 304 Seiten, 24 Euro. Im April erscheint bei Kampa die nächste Neuauflage eines alten Duffy-Krimis von Julian Barnes alias Dan Kavanagh: "Heiße Fracht" (240 Seiten, 16,90 Euro).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Das Zweite ist am Ende vielleicht sogar wichtiger als das Erste. Barnes kann Beziehungsromane schreiben, in denen das zerrüttete Verhältnis des späten zwanzigsten Jahrhunderts zu den Gewissheiten, welche die Jahrhunderte davor zusammengehalten haben - Glaube, Kunst, zivile Institutionen -, im Schlafzimmer aufgeführt wird: Wenn zwei Menschen sich lieben und belügen, aber gerade deswegen zusammenbleiben können, dann erzählt das eine Menge darüber, was "Wahrheit" eigentlich ist, ohne dass man dazu ein Seminar über postmoderne Theorie belegt haben muss.
Gleichzeitig will Julian Barnes von Anfang an nicht den einen, den großen Roman schreiben - auch wenn er noch so sehr Flaubert und die Russen des 19. Jahrhunderts dafür bewundert, dass sie es konnten. Julian Barnes aus Leicester, Sohn von Französischlehrer-Eltern, Bruder eines Philosophen, will viele kleine Romane. Und essayistischere Bücher zwischendurch. Er schreibt anfangs unter dem Pseudonym Dan Kavanagh zeitgleich noch Krimis über den schwulen Detektiv Duffy, aber er will auch aus seinem eigenen Leben erzählen. Und aus seinem Bücherschrank.
Barnes' Fähigkeit zur Liebe und zur Skepsis ist dabei immer gleichermaßen stark ausgeprägt. Weshalb er einerseits also einen Hang zum Beziehungsroman hat - die besten seiner kleinen Romane wie "Darüber reden" handeln davon - und andererseits einer der unprätentiösesten britischen Schriftsteller seiner Generation geblieben ist. Das ist auch nicht schwer. Denn zu dieser Generation gehören Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie, deren letzte Bücher vor allem davon handelten, wie enorm begeistert ihre Verfasser von den eigenen erzählerischen Fähigkeiten sind. Julian Barnes aber, der am 19. Januar fünfundsiebzig Jahre alt wird, scheint mehr der Maxime zu folgen, dass er immer weniger weiß, je mehr er liest. Und dass das wenige, was er verstanden hat, trotzdem am besten in Form eines Buches aufgehoben ist: Weil so ein Buch halt auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis zur Sprache bringen kann. Weil ein Buch Gesetzen folgt, die es sich selbst geschrieben hat, und so zusammenbringen kann, was bis eben vielleicht noch gar nicht zusammengehört hat. Oder nie sollte. Aber dann kommt jemand wie Julian Barnes und stellt die Verbindung her. Und für die Dauer von ein paar Seiten könnte alles so gewesen sein.
Es hört sofort auf, kompliziert zu klingen, wenn man beginnt, Barnes zu lesen. "Der Mann im roten Rock", sein neuestes Buch, ist der Versuch, aus einer Epoche anhand einer historischen Figur zu erzählen, die sie von Anfang bis Ende durchwandert hat. Es geht um den französischen Arzt Samuel Pozzi, geboren 1846, gestorben 1918. Ein Freund der Familie Proust und Geliebter der Schauspiellegende Sarah Bernhardt. Arzt des Offiziers Dreyfus (der von der Affäre). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Gynäkologie Frankreichs und Verfasser eines Standardwerks seines Fachs. Pionier der Behandlungstechniken und Hygieneregeln, fünfunddreißig Jahre lang behandelnder Arzt in einem öffentlichen Pariser Krankenhaus.
Und gemalt von John Singer Sargent. "Dr. Pozzi at home" heißt das Porträt, das Sargent 1881 malte und das diesem Buch seinen Titel gegeben hat, denn Pozzi, der "ekelhaft gut" ausgesehen haben soll, wie eine Prinzessin es sagte, die ihn kannte, trug darauf: einen roten Morgenrock. Es geht auch deshalb hier immer wieder um Schlafzimmer und was sich in ihnen abspielt, es geht um Stil und Oberflächen, um das Verhältnis von Schönheit zu Wahrheit, von Inszenierung und Realität, um ästhetisiertes Leben.
"Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes auf Seite 217. Und stellt diesen späten Satz, der genauso gut auch der erste seines neuen Buchs hätte sein können, aber in Klammern: "(Pozzi war überall)". Es ist, als wollte Barnes damit noch einmal deutlich machen - nachdem er 216 Seiten lang um seine Hauptfigur ein immer größeres Geflecht anderer Berühmtheiten gesponnen hatte, Oscar Wilde, Joris Karl Huysmans, selbst der Entdecker des Tourette-Syndroms kommen vor -, dass man Samuel Pozzis Bedeutung für die sogenannte Belle Époque bitte nicht überbewerten darf. Auch wenn ein ganzes Buch jetzt davon handelt. Aber dieses Buch collagiert nur Elemente einer Vergangenheit anhand der Materialien, die Barnes von ihr finden konnte (Tagebücher, Gemälde, Briefe, Romane, Sammelbildchen), weil sie zu finden waren. Beziehungsweise Barnes sie gefunden hat, weil er diese Zeit und ihre Literatur so liebt. Vielleicht wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden, wenn Barnes nicht 2015 in der National Portrait Gallery seiner Heimatstadt London auf Sargents "Dr. Pozzi at home" gestoßen wäre, als es dort als Leihgabe hing.
Aber es geht hier deswegen nicht um Zufall. Sondern um die Relativität einer Erzählung im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Erzählungen des Vergangenen und der Gegenwart, die ihren Sinn aus jenen Traditionen und Entwicklungen zieht, die sie in ihr zu erkennen glaubt. Wir stiften schon Sinn, indem uns etwas auffällt unter einer Million Dingen, die uns auffallen könnten - die eigentliche Erkenntnis muss aber genau darin bestehen, dass uns genau das auch auffällt. "Wir wissen es nicht", das ist das Leitmotiv dieses Buchs und letztlich auch des gesamten Werks von Julian Barnes. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir konstruieren es so, dass es zu unseren Wünschen und Affekten passt. Jahrestage kann man gern vergessen, aber diese Erkenntnis besser nicht, wann immer in der Politik die Geschichte zum Kronzeugen berufen wird.
"Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: ,Wir leben in der Belle Époque, und das sollten wir auskosten.'", schreibt Barnes einmal. "Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870-71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914-18 hielt erst 1940-41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug." Es war der Titel einer Radiosendung, aus dem dann der "Inbegriff von Frieden und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz" wurde, bevor "dieses kuschelige Fantasiegebilde - mit einiger Verspätung - vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert weggefegt wurde."
Barnes ist nie einfach nur irgendwie kalt postmodern gewesen bei seinen Experimenten mit Literatur und Wahrheit. Im Gegenteil ist das, was er in diesem neuen Buch wieder tut und auch schon in früheren Büchern tat (wie seine Collage über den Tod, "Nichts, was man fürchten müsste", oder sein Literaturroman "Flauberts Papagei") belebt von großer Sanftheit und Nachsicht. Er schaut auf die Menschen vor seiner Zeit und sieht, wie auch sie sich bemühten um Liebe, Tod und Wahrheit, und dann starben sie doch, oder brachen Herzen, die anderer und die eigenen.
Auch wenn Samuel Pozzis Modernität und Weltgewandtheit so beispielhaft waren, dass man sich gut vorstellen könnte, dass die Franzosen alle möglichen Institutionen von heute nach ihm benennen, so wie die Deutschen es mit Humboldt tun - man könnte die Jahre, die Pozzi durchlebte und Barnes mit ihm durchwandert, immer auch ganz anders beschreiben. Anhand des jüdischen Offiziers Dreyfus ist das auch geschehen, dessen ungerechtfertigte Verurteilung zum Landesverräter das Frankreich der Dritten Republik in eine tiefe Krise stürzte. Wie viele Neuerscheinungen der letzten Zeit haben irgendwelche Jahre zu Schicksalsdaten erklärt, in denen alle geheimen Ströme der Vergangenheit so neuralgisch zusammenliefen, dass ja nur genau die Gegenwart dabei herauskommen konnte, in der wir heute leben? 1913, 1917, 1919, 1815, 1979, 1981?
Der Erkenntnistheoretiker Barnes dagegen entdeckt das Porträt Pozzis ein Jahr bevor seine Leute sich für den Brexit entscheiden. Pozzi ist zwar kein Unbekannter in der französischen Geschichte, und Julian Barnes, für den Frankreich eine Sehnsuchtsheimat ist, wusste natürlich schon, wen er da vor sich hat. Aber welchen Stoff er da gefunden hat, zeigt sich erst ein Jahr später, im Lichte des Referendums über den britischen Austritt aus der EU.
Plötzlich erscheint eine fast genau hundert Jahre alte Maxime Pozzis - "Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz" - wie die Antwort auf eine sehr aktuelle Frage. "Ich habe dieses Buch im letzten Jahr vor Großbritanniens verblendetem, masochistischem Austritt aus der Europäischen Union geschrieben", erklärt Barnes in seinem Nachwort aus dem Mai 2019. "Und Dr. Pozzis Maxime kam mir oft in den Sinn, während die englische politische Elite, unfähig, sich in das Denken von Europäern hineinzuversetzen (oder nicht willens oder zu dumm dazu), sich immer wieder so benahm, als könnte das, was sie selbst wollte, und das, was passieren würde, ein und dasselbe sein. Die Engländer (nicht die Briten) rühmen sich oft allzu selbstgefällig, dass sie auf ihrer Insel glücklich und zufrieden seien und sich gar nicht für ,dieses andere' interessierten, über das man so schön lästern und leichthin Witze machen konnte."
Dieses neue Buch über den weltgewandten, allseits gebildeten, neugierigen Samuel Pozzi und seine Freunde und Feinde, die Geschichte eines Wissenschaftlers, der um die Welt reiste, um von anderen Nationen zu lernen, erscheint nicht nur zum 75. Geburtstag seines Autors. Sondern auch im ersten Jahr nach dem Brexit. Es erinnert auf jeder Seite daran, dass es einst ein Privileg der Reichen und Hochmögenden war, sich von Land zu Land bewegen zu können. Großbritannien hat sich soeben aus dem europäischen Projekt verabschiedet, diese Bewegungsfreiheit für alle zu garantieren.
Samuel Pozzi wurde am 13. Juni 1918 von einem eigenen Patienten ermordet. Bei der Notoperation hat er dem behandelnden Chirurgen erst noch selbst assistiert.
TOBIAS RÜTHER
Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Übersetzt von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 304 Seiten, 24 Euro. Im April erscheint bei Kampa die nächste Neuauflage eines alten Duffy-Krimis von Julian Barnes alias Dan Kavanagh: "Heiße Fracht" (240 Seiten, 16,90 Euro).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Gebundenes Buch
Kurz gesagt: Eine passable Lektüre, wenn man an Geschichte interessiert ist und viel Geduld mitbringt. Oft genug habe ich mich allerdings gefragt, warum erzählt uns der Werte Autor das Ganze? Eine Menge an unnützem Wissen, was da auf einen prasselt. Dick überkleistert mit …
Mehr
Kurz gesagt: Eine passable Lektüre, wenn man an Geschichte interessiert ist und viel Geduld mitbringt. Oft genug habe ich mich allerdings gefragt, warum erzählt uns der Werte Autor das Ganze? Eine Menge an unnützem Wissen, was da auf einen prasselt. Dick überkleistert mit Effekthascherei, muss ich leider hinzufügen.
Weshalb viel Geduld erforderlich: Hier geht es hauptsächlich nicht um den Mann im roten Rock. Vielmehr ist es ein Portrait der Zeit in Paris der Belle Époque. Dieses Zeitalter wurde hier detailreich, für mein Dafürhalten zu detailreich vorgestellt.
Zwischendurch, insb. in der ersten Hälfte, musste ich denken: Warte mal. Das soll doch eine Art Biografie eines Arztes sein, der seiner Zeit voraus war. Aber seitenlang ging es um Dandytum, dieses Thema wurde so intensiv beackert, dass ich den Eindruck gewann, dies wäre einer der roten Fäden hier. Über die Duelle erfährt man auch allerhand, wie all dies zustande gekommen war und wer so alles bei den Duellen und anderem Blödsinn mitgemacht hatte, welche Bedeutung dem beigemessen wurde, welche Logik dahintersteckte usw.
Man liest an mehreren Stellen von Sarah Bernhardt, Oskar Wilde und noch vielen anderen Prominenten dieser Zeit, die man aus dem Stehgreif kennt und von noch vielen weiteren, die man nicht kennt. Schön ist, dass ihre Portraits passend zum Text dabei sind. Es gibt eine ganze Reihe an Persönlichkeiten, die mit zumindest paar Zeilen den Eingang in dieses Werk geschafft haben. So manche Charakterisierung fiel aber ganz schön ausführlich aus, was recht oft passierte, sodass die Frage auftauchte, wozu all die Unmenge an Details gut sein sollte? Oder ist es schlicht die Unfähigkeit zu streichen und alles verwursten wollen, was einem bei den Recherchen unter die Hände kam?
Und nun der Punkt, der mich durch das gesamte Werk gestört hatte: Es wurde so oft und herzhaft in die Schublade sex sells gegriffen, dass ich mich fragen musste, ob der werte Autor die Leser für so primitiv hält, dass dies als ein unbedingter Teil angesehen wurde, da man sonst sein Werk nicht anrühren würde. Offenbar war man der Meinung, man müsse mit solchen Ausführungen diese Geschichte „aufwerten“. Solche Vorgehensweise offenbart vor allem zwei Dinge: Geringschätzung der Leser und eigene Unfähigkeit zu schreiben, i.e. das gewählte Thema so packend und unterhaltsam darzubieten, dass sex sells gar nicht nötig wäre. Natürlich kann man sagen, das passt in die Zeit, mag sein. Aber deshalb soll das Portrait der Zeit mit dem Zeug nicht unbedingt zugekleistert werden. Viele Wege führen nach Rom. Und nicht zwangsläufig über die besagte Schublade.
Ansonsten gab es auch interessante, aufschlussreiche Ausführungen, z.B. der Vergleich der Franzosen mit Engländern, was die Ehe, die Rolle der Liebe in der Ehe usw. angeht. Es ging u.a. noch um Gott und die Welt. Solche philosophisch angehauchten Gedanken, die mit der Weltanschauung eines lebenserfahrenen Mannes zu tun haben, taten dem Ganzen richtig gut. Sie brachten oft die Dinge auf den Punkt und werteten das Werk ungemein auf. Streckenweise fühlte ich mich prima unterhalten. Hin und wieder gab es Grund zum Auflachen oder Schmunzeln.
Fazit: Es eher ein Werk über diese Zeit, schon allein, wenn man auf das Verhältnis schaut, wie viel Seiten darauf verwendet wurden, über den Arzt zu referieren und wie viele über die damalige Prominenz und ihre fragwürdigen Sitten. Das Verhältnis ist schätzungsweise 20/80. Kann man lesen. Muss man aber nicht unbedingt.
Gekürzt.
Weniger
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Haben Sie schon einmal von Samuel Pozzi gehört, der von 1848 bis 1918 lebte? Er war Arzt, ein Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie. Und auch sonst ein sehr umtriebiger Mensch, der seiner Zeit in Vielem weit voraus war. Julian Barnes hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns diesen Mann ein …
Mehr
Haben Sie schon einmal von Samuel Pozzi gehört, der von 1848 bis 1918 lebte? Er war Arzt, ein Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie. Und auch sonst ein sehr umtriebiger Mensch, der seiner Zeit in Vielem weit voraus war. Julian Barnes hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns diesen Mann ein wenig näher zu bringen – und nicht nur ihn. Wir lernen seine Freunde, weitere Bekannte und Unbekannte kennen und die Zeit, in der er lebte.
Im Plauderton erzählt Barnes nicht nur von Dr. Pozzi und seinen zahlreichen amourösen Verhältnissen, sondern auch eine Vielzahl von Anekdoten über bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten. Beispielsweise worauf Charles de Gaulles Abneigung gegenüber den Briten zurückzuführen war (Faschoda) oder Näheres zum Entdecker des Tourette-Syndroms. Keine Frage, wer sich für die Belle Époque interessiert, wird hier eine reichhaltige Fundgrube an historischen wichtigen aber auch belanglosen Informationen entdecken. Und nicht nur an Schriftlichem: Der Verlag hat aus dieser Lektüre ein wunderschönes Buch gemacht, gedruckt auf hochwertigem Papier mit zahlreichen Farb- und Schwarzweißbildern, die viele der damaligen Persönlichkeiten auf Gemälden oder Photos abbilden. Nur die Biographie des Herrn Dr. Pozzi kommt leider etwas zu kurz, wie ich finde.
Julian Barnes‘ Begeisterung an dieser Epoche und seinen Menschen (zumindest denen aus der gehobenen Schicht) ist überdeutlich zu spüren, was bedauerlicherweise nicht immer zum Vorteil der Lesenden gereicht. Es scheint, als wolle er uns so viel wie möglich an seinem immensen Wissen teilhaben lassen, und so werden viele der erzählten Dinge nur angerissen – zu knapp, wie ich häufig fand. Gerade Dr. Pozzi, dessen Gemälde das Cover des Buches zeigt, kommt meiner Meinung nach leider, wie schon erwähnt, viel zu kurz. Dies mag daran liegen, dass es über und von seiner Person nicht sehr viele Hinterlassenschaften gibt wie beispielsweise Briefe, Tagebücher o.ä. Wenn, dann sind es meist Dokumente aus zweiter oder dritter Hand wie beispielsweise das Tagebuch seiner Tochter oder die Briefe Sarah Bernhardts an Dr. Pozzi. So entsteht zwangsläufig ein ziemlich fragmentarisches Bild des titelgebenden Mannes ‚im roten Rock‘, während sein Freund Robert de Montesquiou-Fezensac wesentlich häufiger Erwähnung findet.
So ist dieses Buch trotz des Titels kein Porträt einer einzelnen Person, sondern vielmehr ein Panorama der Belle Époque mit vielen Informationen aus jener Zeit – Klatsch, Tratsch und Belangloses mit inbegriffen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
Selten habe ich mich mit einem Buch so schwer getan, wie mit diesem. Ich bin nicht in die Geschichte hineingekommen. Der historische Hintergrund, die Lebensumstände der damaligen Zeit und politische Situation waren gut dargestellt, aber ich habe aufgegeben und das Buch nicht zu Ende …
Mehr
Selten habe ich mich mit einem Buch so schwer getan, wie mit diesem. Ich bin nicht in die Geschichte hineingekommen. Der historische Hintergrund, die Lebensumstände der damaligen Zeit und politische Situation waren gut dargestellt, aber ich habe aufgegeben und das Buch nicht zu Ende gelesen/gehört.
Vieles schien mir zusammenhanglos, wirr, ein merkwürdiger Schreibstil. Seit langem das erste Buch, das enttäuscht zur Seite gelegt wurde.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Literarischer Bastard
Das neueste Werk des englischen Schriftstellers Julian Barnes mit dem Titel «Der Mann im roten Rock» gehört zu den essayistischen seines umfangreichen Œuvres. Der Titel bezieht sich auf den französischen Arzt Samuel Pozzi, den er in einer Londoner …
Mehr
Literarischer Bastard
Das neueste Werk des englischen Schriftstellers Julian Barnes mit dem Titel «Der Mann im roten Rock» gehört zu den essayistischen seines umfangreichen Œuvres. Der Titel bezieht sich auf den französischen Arzt Samuel Pozzi, den er in einer Londoner Galerie auf einem Gemälde entdeckt hatte, das nun das Titelbild ziert. Das Leben dieses Mode-Arztes und Salonlöwen dient ihm allerdings nur lose als roter Faden durch die Belle Époche in Paris, zu deren gesellschaftlicher Elite der begnadete Frauenarzt gehörte. Seine Biografie bietet Barnes Anlass zu allerlei Betrachtungen vor allem gesellschaftlicher Themen, die der bekanntermaßen frankophile Schriftsteller immer wieder zu neuen Vergleichen der beiden so unterschiedlichen Nationen nutzt.
Es beginnt mit der Reise dreier Franzosen nach London, zu der Pozzi 1885 mit dem Schriftsteller Robert de Montesquiou und dem Komponisten Edmond de Polignac aufbrach. Seine Begleiter waren beide homosexuell, während der blendend aussehende und charmante Pozzi, unglücklich verheiratet, als ausgesprochener Womanizer galt. Womit einer der thematischen Schwerpunkte dieses Essays schon genannt ist, es gibt reichlich schwule Männer in diesem Buch, Oscar Wilde dürfte deren bekanntester Vertreter sein. Immer wieder kommt Barnes auf dessen berühmten Roman «Das Bildnis des Dorian Gray» zurück, zitiert daraus und setzt sich in verschiedenen Aspekten damit auseinander. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt in diesem Werk über eine wichtige historische Epoche ist die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunst, vor allem der Malerei. Gleich zu Beginn geht Barnes darauf ein, beschreibt präzise analysierend das lebensgroße Ölgemälde des Arztes. Inhaltlicher Schwerpunkt ist jedoch das dekadente Gesellschafts-Leben jener Zeit mit all dem Klatsch und Tratsch, den amourösen Skandalen, dem in Frankreich noch lange praktizieren Duell-Unwesen, aber auch mit den politischen Ereignissen. Die Dreyfus-Affäre ist das populärste Beispiel dafür, er kritisiert aber ebenso heftig den Kolonialismus. Wie er sich übrigens im Nachwort auch als ein vehementer Gegner des Brexit outet, den er als ebenso verblendet brandmarkt, für ihn eine englische, nicht britische Fehlentscheidung, wie er ausdrücklich betont!
Man ist an ein Who’s Who erinnert angesichts der Figurenfülle dieses Buches, zu der nicht wenige Dandys gehören wie die drei Reisenden zu Beginn. Eine für Frankreich spezifische Gattung von Männern übrigens, der sich Julian Barnes sehr ausführlich widmet. Er wird nicht müde, all die Größen des Fin de Siecle aufmarschieren zu lassen mit seinem pompösen Figuren-Ensemble, ihre Beziehungen untereinander zu beschreiben und zu deuten. Gleich zu Beginn taucht da Henry James auf, der amerikanisch-englische Schriftsteller, von Flaubert bis Proust fehlt kaum einer der berühmten französischen, wobei Joris-Karl Huysmans mit seinem Roman «Gegen den Strich» deutlich häufiger herangezogen und zitiert wird als Oscar Wilde. Prominenteste Frau ist Sarah Bernardt, als Schauspielerin der erste Weltstar überhaupt, Patientin von Pozzi, die ihn nur Doctor Dieu nannte und wohl auch seine Geliebte war, - nichts Genaues weiß man nicht!
Was Julian Barnes hier nach umfangreichen Recherchen in lockerem Stil, angereichert mit fast 100 Abbildungen, pointenreich berichtet, ist natürlich auch mit englischem Humor durchmischt. Das macht die Lektüre der vielen Krisen und Skandale zwar unterhaltsam, seine häufigen Abschweifungen allerdings führen mit unzähligen Anekdoten und auf kontemplativen Nebenwegen oft ins Leere. Bei seiner episodenhaften Erzählweise geht dann der innere Zusammenhang zuweilen verloren und es wird langweilig. Im Verbund mit der Überfülle an Figuren, von denen viele allenfalls Insidern bekannt sein dürften, wird das Lesen recht beschwerlich. Der überraschend romanhafte, allerdings ja authentische Schluss rettet diesen weder als Essay noch als Biografie überzeugenden literarischen Bastard dann auch nicht mehr.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Schreibstil von Julian Barnes unheimlich schwergetan habe. Grundsätzlich fand ich die Story des Buches interessant - wie im Klappentext beschrieben, erfährt man viel über den Arzt Pozzi und das Leben in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg in Paris. In …
Mehr
Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Schreibstil von Julian Barnes unheimlich schwergetan habe. Grundsätzlich fand ich die Story des Buches interessant - wie im Klappentext beschrieben, erfährt man viel über den Arzt Pozzi und das Leben in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg in Paris. In all seiner Dekadenz.
Ich mag gut und ausführlich ausgearbeitete Charaktere, aber hier war mir das definitiv zu viel des Guten. Nicht nur über Pozzi erfährt man sehr viel, auch über einige andere Charaktere, zum Teil auch bekannte und berühmte Persönlichkeiten. Aber ich habe mich während des Lesens oft gefragt, ob diese Schwemme an Informationen jetzt wirklich nötig waren. Zum Teil geht dadurch fast die Geschichte, zumindest aber der rote Faden verloren und ich habe mich phasenweise gefühlt, als würde ich ein Lexikon lesen, keinen Roman.
Ich fand das Buch zum größten Teil anstrengend zu lesen, so dass bei mir auch kein wirklicher Lesefluss aufkam. Ich habe ein paar Mal aufgeben wollen, habe es dann aber doch beendet. Für mich war es einfach nichts.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die schöne Epoche
Der englische Schriftsteller Julian Barnes hat mit Der Mann im roten Rock ein essayistisches Werk über eine Zeit der Jahrhundertwende in Frankreich vorgelegt, das sehr unterhaltsam ist. Im Mittelpunkt stellt er den Arzt Dr. Samuel Pozzi (1846–1918), der viele …
Mehr
Die schöne Epoche
Der englische Schriftsteller Julian Barnes hat mit Der Mann im roten Rock ein essayistisches Werk über eine Zeit der Jahrhundertwende in Frankreich vorgelegt, das sehr unterhaltsam ist. Im Mittelpunkt stellt er den Arzt Dr. Samuel Pozzi (1846–1918), der viele bekannte Persönlichkeiten kannte. Es ist ein scharfsinniges Buch und sehr interessant. Man folgt Barnes gerne, wenn er nicht nur Pozzis Leben folgt sondern auch immer wieder die Leben vieler andere einbezieht:
Oscar Wilde, Robert de Montequieu, Maupassant, Marcel Proust, Sarah Bernhardt und viele andere.
Die Geschichten dieser Persönlichkeiten sind vielfach miteinander verquickt. Julian Barnes schreibt detailreich, ohne sich darin zu verlieren. In der Summe entsteht ein Gesamtbild!
Ein opulentes, lesenswertes Buch!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Dr. Julian Pozzi war ein Pionier auf dem Gebiet der Frauenheilkunde. Er setzte sich für die minimalistische Operation ein und das hieß schon damals, dass die Dauer des Eingriffs auf ein Minimum reduziert werden konnte. Zudem war er überzeugt, dass die neuartigen Materialien für …
Mehr
Dr. Julian Pozzi war ein Pionier auf dem Gebiet der Frauenheilkunde. Er setzte sich für die minimalistische Operation ein und das hieß schon damals, dass die Dauer des Eingriffs auf ein Minimum reduziert werden konnte. Zudem war er überzeugt, dass die neuartigen Materialien für Chirurgen nicht nur das Vernähen der Wunden revolutionierten. „Der Mann im roten Rock“ zeugt von einer umfangreichen Recherche und beschreibt die Belle Epoque eindringlich und ausführlich. Pozzi sorgte dafür, dass endlich Hygienevorschriften in die Operationssäle Einzug hielten und ja, der übersetzte auch die damals sehr umstrittenen Aufzeichnungen Darwins in die französische Sprache.
Es war das Bildnis von Sargent, welches den Autor zum Schreiben dieses Buches animierte. Es zeigt den Arzt und „Vater der französischen Gynäkologie“ ganz privat. Er trägt einen roten Morgenmantel und darunter ein weißes Hemd. Seine Hände sind äußerst schmal dargestellt. Sahen so Chirurgenhände in der Vorstellung des Künstlers aus? Pozzi wird in etlichen Abhandlungen über sein Leben als notorisch Sexsüchtig geschildert. Wobei sich nicht nur Herr Barnes die Frage stellt, welchen Wahrheitsgehalt diese Aussagen haben. In dem Zusammenhang schreibe ich auch hier ein Zitat, welches mir in dem Buch „Der Mann im roten Rock“ ausgesprochen gut gefiel: „Warum drängt es die Gegenwart ständig, über die Vergangenheit zu urteilen?“ Wir können in der heutigen Zeit lediglich darauf hoffen, dass Historiker und Autoren gut ermittelten. Und dennoch wissen wir nicht, was damals tatsächlich geschah und in welcher Weise wir den Hauptpersonen wirklich gerecht werden.
Das Buch ist spannend geschrieben und konnte mich fesseln. Aber ich gebe zu, dass ich es nicht permanent lesen konnte. Es gab zu viele Fremdwörter und auch Fakten, die ich immer mal wieder sacken lassen musste. Eine Empfehlung gebe ich auf jeden Fall und die vier Sterne sind meiner Meinung nach angemessen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Im Juni 1885 kamen drei Franzosen in London an. Einer war ein Prinz, einer war ein Graf und der Dritte war ein einfacher Bürger mit einem italienischen Familiennamen. Der Graf beschrieb den Zweck der Reise später als »intellektuelle und dekorative Einkaufstour«“. …
Mehr
„Im Juni 1885 kamen drei Franzosen in London an. Einer war ein Prinz, einer war ein Graf und der Dritte war ein einfacher Bürger mit einem italienischen Familiennamen. Der Graf beschrieb den Zweck der Reise später als »intellektuelle und dekorative Einkaufstour«“. Damit fängt Julian Barnes‘ neuestes Werk „Der Mann im roten Rock“ an. Kein Roman, keine Biografie, sondern ein Essay über die Belle Époque, das Fin de Siècle im Allgemeinen und den Arzt Dr. Samuel Jean Pozzi, der John Singer Sargent für dessen Gemälde „Dr. Pozzi at Home“ (so heißt das Bild vom Mann im roten Rock tatsächlich) 1881 Modell gestanden hat, im Besonderen. Für mich ein Buch, das ich zwischen einzigartig und eigenartig ansiedle.
Zugegebenermaßen kannte ich vor der Lektüre weder Julian Barnes noch Dr. Pozzi und die Belle Époque konnte ich nur grob einordnen. Aber jetzt, da ich das Buch zu Ende gelesen habe, weiß ich wesentlich mehr. Viel zu wenig über den Arzt, aber sehr viel über die Zeit, in der er lebte. Über ihn habe ich erfahren, dass er ein visionärer Gynäkologe war und ein Arzt für die Reichen und Schönen. Dass er ein Dandy, Lebemann und Kunstsammler war, widerlich gut aussah und dass er von 1848 bis 1918 lebte. Außerdem lernte ich etwas über seinen mehr oder weniger illustren Dunst- und Freundeskreis, in dem sich neben Grafen und Prinzen auch bekannte Persönlichkeiten wie Sarah Bernhardt Oscar Wilde bewegten. Über die Zeit der Belle Époque erzählt Julian Barnes locker und im Plauderton von großer Geschichte und kleinen, intimen Geschichten. Er schreibt über Duelle, zeitgenössische Literatur und Kunst und zeichnet damit ein deutliches Bild der Zeit und des dekadenten Lebens der damaligen High Society.
Sprachlich fand ich das Buch sehr gut formuliert, wenn auch manche Sätze sehr lang und verschachtelt sind. Aber der Inhalt ist durch die Fülle an Personen und die unglaubliche Masse an wichtigen und unwichtigen Informationen sehr überladen und hat mich manchmal fast erschlagen. Ich kam mir vor wie in einem Spinnennetz. Ausgehend von der Mitte (dem Gemälde vom Mann im roten Rock) flicht der Autor viele Fäden in alle möglichen Richtungen. Ich klebte wie eine Fliege in der Mitte, unfähig, das Buch wegzulegen, aber auch nicht wirklich begeistert davon.
Wer sich für ein Sittenbild der Belle Époque interessiert, der ist mit dem Buch hervorragend bedient. Wer sich aber eine Biografie des Arztes erhofft, wird wohl ebenso überrascht und eventuell enttäuscht sein, wie ich und sich durch die Menge an Information leicht überfahren fühlen. Die kleine Prise Politik, die der Autor einfließen lässt, fand ich allerdings sehr erleuchtend: er beleuchtet die Unterschiede zwischen England und Frankreich bezüglich der Frauenrechte, Korruption, Auffassung von Recht und Gesetz, lässt seine Protagonisten philosophisch angehaucht einen Blick auf Europa werfen, was aus heutiger Sicht, nach vollzogenem Brexit sogar fast poetisch anmutet.
Aber leider gibt es zu Dr. Pozzi, der eigentlich die Hauptperson des Buchs sein sollte, gar nicht so viele Fakten, denn er hat selbst nicht wirklich viel hinterlassen. Das meiste, was man über ihn erfährt, stammt aus den Tagebüchern seiner Tochter oder Briefen und so verkommt er eher zum Nebendarsteller in einem Buch über sich selbst. Hauptdarsteller ist die Zeit, in der er lebt und Julian Barnes zeichnet ein gelungenes Sittenbild, was aber nicht das ist, was ich erwartet habe und was Klappentext und Buchbeschreibung versprochen haben. Mir lag das Buch daher nicht wirklich und ich vergebe drei Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für