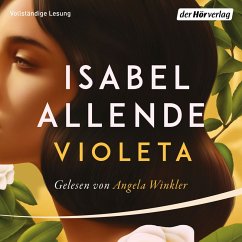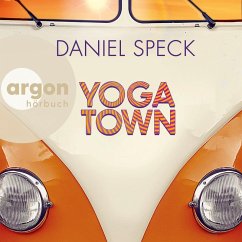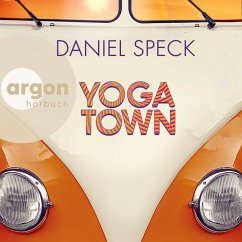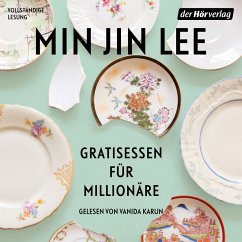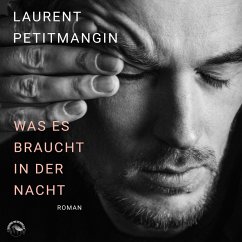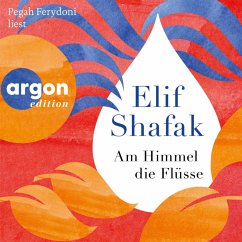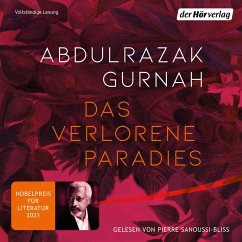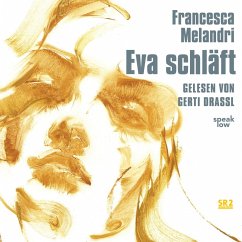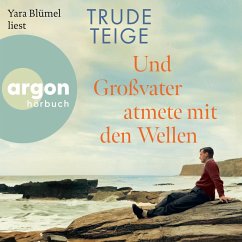Alia Trabucco Zerán
Hörbuch-Download MP3
Mein Name ist Estela (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 391 Min.
Sprecher: Warmuth, Heike / Übersetzer: Loy, Benjamin

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!





Das Mädchen ist tot, die Haushälterin wird vernommen. Zum ersten Mal hören alle Estela zu. Szene um Szene offenbart sich ein schwindelerregendes Kammerspiel unüberbrückbarer Klassenunterschiede. Sieben Jahre hat Estela im Haus der fremden Familie gelebt, hat tagein, tagaus für sie gesorgt. Die weiße Schürze ist zu einer zweiten Haut geworden, die dünnen Wände ihres Zimmers rücken immer näher. Doch sie ist nicht die einzige Gefangene des Hauses: Im leeren Blick des Mädchens sieht Estela ihre eigene Einsamkeit gespiegelt. Jeder Versuch von Intimität zwischen Angestellter und Kind z...
Das Mädchen ist tot, die Haushälterin wird vernommen. Zum ersten Mal hören alle Estela zu. Szene um Szene offenbart sich ein schwindelerregendes Kammerspiel unüberbrückbarer Klassenunterschiede. Sieben Jahre hat Estela im Haus der fremden Familie gelebt, hat tagein, tagaus für sie gesorgt. Die weiße Schürze ist zu einer zweiten Haut geworden, die dünnen Wände ihres Zimmers rücken immer näher. Doch sie ist nicht die einzige Gefangene des Hauses: Im leeren Blick des Mädchens sieht Estela ihre eigene Einsamkeit gespiegelt. Jeder Versuch von Intimität zwischen Angestellter und Kind zerschellt an der ehrgeizigen Mutter und dem autoritären Vater, an der Brutalität der Verhältnisse. Auf engstem Raum ringen vier Menschen ums Überleben und rasen doch unausweichlich auf eine Katastrophe zu.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Alia Trabucco Zerán, geboren 1983 in Santiago de Chile. Ihr Debütroman "Die Differenz" (2021) wurde für den International Booker Prize nominiert und 2022 mit dem British Academy und dem Anna Seghers-Preis ausgezeichnet. Mein Name ist Estela ist ihr erster Roman bei Hanser Berlin.
Produktdetails
- Verlag: argon
- Erscheinungstermin: 19. Februar 2024
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783732473977
- Artikelnr.: 69872375
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Einen "eindringlichen Roman über das chilenische Klassensystem" legt Alia Trabucco Zeran mit ihrem neuen Buch vor, in dem es um eine Hausangestellte geht, die des Mordes an der Tochter ihrer reichen Arbeitgeber-Familie verdächtigt wird, resümiert Rezensentin Victoria Eglau. Dabei wir das Buch aus der Sicht von der Hausangestellten Estela erzählt, die von ihrer Zeit im Süden Chiles und über ihre Arbeit im Haus der reichen Familie spricht, lesen wir. Auf den ersten Seiten wird schon klar, dass die Tochter gestorben ist. Zeran schafft es aber nahezu virtuos die Spannung hoch zu halten, lobt die Kritikerin. Es handelt sich nicht um ein "Pamphlet gegen die soziale Ungerechtigkeit", sondern um eine tiefgehende psychologische Studie einer Person, die als Hausangestellte nur auf ihren Nutzen reduziert wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Eine erschütternde Geschichte, hervorragend erzählt. Ein gesellschaftskritisches Buch, das einen nicht kalt lässt." Hermann Koch, P.S., die linke Zürcher Zeitung, 20.09.24 "Ein intelligenter, erschütternder Roman ... Alia Trabucco Zerán ist eine der herausragenden Stimmen der zeitgenössichen Literatur Lateinamerikas." Hernán D. Caro, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10.03.24 "Ein überwältigender Roman mit einer Sprachgewalt, der man sich kaum entziehen kann." Marie-Luise Goldmann, Welt am Sonntag, 03.03.24 "Alia Trabucco Zerán vermag es, sofort Spannung wie auch eine intensive Atmosphäre zu kreieren. ... Sie erweist sich als Meisterin detailstarker, einprägsamer Szenerien und Bilder." Carola Ebeling, Zeit Online, 15.05.24 "Eine
Mehr anzeigen
psychologisch tiefschürfende Nahaufnahme des komplexen Verhältnisses zwischen einer Dienerin und ihren Herren. ... Jedes Wort geht unter die Haut, ein fesselndes Buch!" Victoria Eglau, Deutschlandfunk Kultur, 13.03.24 "Ein Roman mit starker Spiegel-Wirkung ... Man rutscht selbst in den Voyeurismus und ertappt sich dabei, was man für Vorstellungen hat von Menschen, deren Dienstleistungen man für selbstverständlich nimmt. ... Am Ende hat man das Gefühl: Etwas in mir hat sich verschoben." Jan Ehlert, NDR, 24.05.24 "Ein brisanter Gesellschaftsroman über soziale Ungleichheit, Klassismus, Macht und Unterdrückung ..., der schon jetzt zu den faszinierendsten in diesem Literaturjahr gehört." Judith Hoffmann, Ö1, 20.02.24 "Alia Trabucco Zerán webt die verschiedenen Anfangspunkte Ihrer Ich-Erzählerin geschickt zu einer spannenden Erzählung zusammen, die sich irgendwo zwischen Kammerspiel, Krimi und Gesellschaftskritik verorten lässt ... eine Geschichte über Machtverhältnisse und Diskriminierung, ... stellenweise brutal, aber immer einfühlsam." Amanda Andreas, WDR5, 11.04.24 "Alia Trabucco Zerán hat ein großartiges Buch über die Dämonen einer Klassengesellschaft geschrieben, die kurz vor dem Aufprall ist." Leander F. Badura, Der Freitag, 12.04.24 "Ein Pageturner ... Das erschütternde Psychogramm einer Familie und ein Blick auf eine zutiefst gespaltene Leistungsgesellschaft." Eva Karnofsky, SWR 2, 19.02.24 "Ein beklemmender Roman über die Zustände zwischen Reich und Arm, der sich spannend wie ein Thriller liest." Linda Stift, Die Presse, 25.03.24 "Es ist der um Sachlichkeit bemühte, abgebrühte, fast schon emotionslose Berichtston, der diesem Buch seine Wucht gibt. ... Dass die Protagonistin mehr ist als ein Paradigma für die ausgebeutete Klasse, nämlich ein nicht unproblematischer Mensch mit Schwächen und einer Geschichte, zeigt die literarische Qualität des Romans." Frank Schäfer, neues deutschland, 19.03.24 "Eine wichtige literarische Dokumentation von Klassismus ... Alia Trabucco Zerán baut in klaren, kammerspielartigen, zugespitzten Szenen eine tolle Spannung auf. Eine Autorin, die es zu entdecken gilt!" Ines Lauffer, hr2, 01.03.24 "Eine aufwühlende Erzählung ... In kurzen Szenen taucht Alia Trabucco Zerán ein in das häusliche Epizentrum der Wohlstandsverwahrlosung und schildert prägende Szenen der inneren Verzweiflung, Wut und Machtlosigkeit." Melissa Erhardt, ORF, 18.06.24 "Ein Roman, den man nicht wieder aus der Hand legt." Brigitte Theissl, an.schlaege Magazin, 23.05.24
Schließen
Gebundenes Buch
Meine Meinung:
Hallo? Ist hier jemand?
Da ist eine Frau, die auf mich Anfangs wie ein Mädchen gewirkt hat. Ihr Name ist Estela. Sie verlässt ihr heißgeliebte Mutter, um bei einer reichen Familie als Hausmädchen zu arbeiten. Die Senora bekommt ein ein Kind. Als Baby ist das …
Mehr
Meine Meinung:
Hallo? Ist hier jemand?
Da ist eine Frau, die auf mich Anfangs wie ein Mädchen gewirkt hat. Ihr Name ist Estela. Sie verlässt ihr heißgeliebte Mutter, um bei einer reichen Familie als Hausmädchen zu arbeiten. Die Senora bekommt ein ein Kind. Als Baby ist das kleine Mädchen glücklich. Estela kümmert sich um es und entwickelt eine Liebe zu der Kleinen, die von der Mutter nicht gerne gesehen wird. Wie der Klappentext schon verrät, stirbt das Mädchen im späteren Verlauf.
Wir erfahren die Geschichte aus der Sicht von Estela. Bei einem Verhör erzählt sie ausschweifend, was sie in den sieben Jahren bei der Familie erlebt hat. Endlich kann sie ihre Stimme gebrauchen. Bei ihrer Arbeit erhielt sie nur Anweisungen. Denn Menschen Estela hat keiner wahrgenommen.
Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal eine Protagonistin in einem Roman so berührt hat. Die Klassenunterschiede sind sehr deutlich zu erkennen. Estela vereinsamt mitten in einer Familie. Den Esstisch deckt sie stets für drei Personen. Sie muss alleine in der Küche essen. Ihre Schlafstatt befindet sich direkt neben der Küche. Getrennt mit einer Schiebetür aus Milchglas. Somit ist noch nicht mal ein kleines bisschen Privatsphäre gegeben.
Um das Mädchen kümmert sie sich sehr liebevoll. Estela muss mit ansehen, wie der Senor und die Senora aus dem glücklichen Baby ein unglückliches Kind machen. Es zu Höchstleistungen anspornen und dafür sorgen, dass ihr Kind stets der normalen Entwicklung voraus ist.
Ihr Verhör gleicht einem inneren Monolog. Auf eine Antwort wartet man vergeblich. Estela erzählt sehr ausschweifend, da man zu einem gerechten Urteil alles wissen muss. Der Schreibstil ist so detailliert, dass ich die Hitze Santiagos auf meiner Haut spüren konnte. Die viele Hausarbeit und die mangelnde Konversation mit Menschen, machen aus der einst glücklichen Estela eine tieftraurige Frau. Das haben Estela und das Kind gemeinsam. Für Estela ist das Kind ein Blick in den Spiegel.
Schritt für Schritt kommt man der Katastrophe näher. Es gibt so viele Situationen, die mich fassungslos machten. Wunderbare Zitate erhöhen den Lesegenuss.
Das Mädchen beisst sich seine Finger stets blutig. Zitat aus dem Buch:
Zum Nägel kauen muss man die Hände frei haben
Nicht mal dafür hätte Estela Zeit gehabt.
Das Ende ging mir durch Mark und Bein: Hallo? Hört ihr mich? Ist da wer?
Estela, ich habe dir zugehört. Mit mir auch viele Andere.
Fazit:
Von mir eine absolute Empfehlung, für dieses außergewöhnlich gute Buch.
Ein großes Dankeschön Alia Trabucco Zerán
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Jetzt spricht Estela
Estela, die in der Hackordnung der Familie ganz unten steht - beziehungsweise bis heute stand. Genauer gesagt: weit unter dieser, so würden es zumindest ihre Arbeitgeber sehen. Aber es ist etwas Außerordentliches, Grauenvolles geschehen - so groß, dass ihre …
Mehr
Jetzt spricht Estela
Estela, die in der Hackordnung der Familie ganz unten steht - beziehungsweise bis heute stand. Genauer gesagt: weit unter dieser, so würden es zumindest ihre Arbeitgeber sehen. Aber es ist etwas Außerordentliches, Grauenvolles geschehen - so groß, dass ihre Meinung keine Rolle (mehr) spielt.
Ein Romen, der Grenzen aufweicht, der in die Vollen geht, der die Leser fordert - manche sicher auch überfordert. Denn dieser Erguss - das ist aus meiner Sicht die passendste Bezeichnung für die Art des Textes - ist an Intensität nicht zu überbieten. Es ist ein Monolog - nicht der eines gestürzten Kriegherren, eines Königs vor dessen Abdankung oder einer Göttin. Nein, es ist der einer über Jahre benachteiligten Dienstbotin, in dem so manches zutage gefördert wird.
Anderes allerdings auch nicht - stellenweise konnte ich dem Text nicht mehr folgen, die Zusammenhänge blieben für mich unklar. Ein großes Projekt einer jungen chilenischen Autorin, das aus meiner Sicht in Teilen geglückt ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
“Mein Name ist Estela” von Alia Trabucco Zerán ist ein Pageturner, man ist im Bann der Erzählerin und gefesselt von der Geschichte. Die Autorin schreibt einen Roman über die Klassengesellschaft in Chile.
Estela, eingesperrt in einer chilenischen Zelle erzählt …
Mehr
“Mein Name ist Estela” von Alia Trabucco Zerán ist ein Pageturner, man ist im Bann der Erzählerin und gefesselt von der Geschichte. Die Autorin schreibt einen Roman über die Klassengesellschaft in Chile.
Estela, eingesperrt in einer chilenischen Zelle erzählt unbekannten Zuhörern, vielleicht der Polizei oder vielleicht auch niemandem, vom Tod des siebenjährigen Mädchens.
“Der Ausgang ihrer Geschichte bleibt immer gleich:
Das Mädchen stirbt.”
Ein Mädchen, das ihr im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen war. Estela kam vor sieben Jahren als Haushälterin zu der Familie. Die Señora war schwanger und Estela, das Hausmädchen, durfte sich von Geburt an um das kleine Mädchen kümmern.
Ist es ihre Schuld, dass das Kind gestorben ist?
Estela erklärt den stillen Zuhörern, dass diese besondere Geschichte viele Anfänge hat und holt weit aus. Sie erzählt von ihrer Mutter und ihrer Jugend, von ihrem Fortgang aus dem kleinen Dorf und den Beginn ihrer Zeit als Hausmädchen bei der Familie. Sie braucht den Lohn zur finanziellen Unterstützung der Mutter und einen geplanten Anbau an ihr Häuschen.
Unbeschönigt erzählt die vierzigjährige Haushälterin den Ablauf im
Haus, ihre Tätigkeiten, ihre Rolle in dem Haus und ihre Zuneigung zu der Familie.
Estela will keine Zeit mit ihren ausschweifenden Erzählungen schinden, sondern erzählt so ausufernd, damit die Zuhörer den Sinn von Ursache und Wirkung /Folgen verstehen können.
Der leere, traurige Blick des Mädchens, die hohen Anforderungen der Eltern an das Kind, die wenigen Freunde und Freuden, die Einsamkeit, alles das lässt Estela in ihre Geschichte einfließen. Ein autoritärer Vater, der nur das Beste für das Kind möchte und eine gefühlskalte, erfolgsorientierte Mutter, die das anstrengende, oft schreiende Kind nicht versteht, spitzen die Tragödie zu. Aber auch die kleinen Glücksmomente werden von der Autorin emotional beschrieben.
Die Autorin zieht den Leser in das Leben der kleinen Familie und in die Gefühlswelt der Hausangestellten. Ein Leben zu Diensten einer fremden Familie, ein Leben mit deren Intimitäten und Gepflogenheiten und doch nicht zugehörig. Niemand aus diesem Haus fragt Estela, wie es ihr geht. Niemand interessiert sich als Mensch für das Hausmädchen.
Und doch hat Estela die Familie gern, das kleine Mädchen und einen zugelaufenen Hund in ihr Herz geschlossen. Ein Weggehen / Zurückgehen ist deshalb nicht geplant und so vergehen die Jahre. Jeden Tag wird gewischt, gewaschen, gebügelt und gekocht. Macht es ihr etwas aus? Dann passiert etwas unvorhergesehenes und Estela redet nicht mehr. Es ist auch in diesem Haushalt nicht notwendig. Oder ist es schlimm für das kleine Mädchen?
Die Autorin lädt mit diesem Roman zum Nachdenken ein.
Die fiktiven Personen werden authentisch dargestellt, das Leben aus Sicht der Angestellten sehr detailliert beschrieben und die Gefühlskälte der Eltern und die große Traurigkeit des kleinen Mädchens sind spürbar. Ein ergreifendes literarisches Werk, sehr zu empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Estela nimmt aus Geldnot eine Stelle im Haushalt einer Familie in Santiago an. Ein Baby ist unterwegs, um dass sie sich auch kümmern wird.
Anfangs dachte ich, dieses Buch wird schwer zu lesen. Wir starten in einem Verhör, Estela beschreibt die vergangenen sieben Jahre im Haushalt der …
Mehr
Estela nimmt aus Geldnot eine Stelle im Haushalt einer Familie in Santiago an. Ein Baby ist unterwegs, um dass sie sich auch kümmern wird.
Anfangs dachte ich, dieses Buch wird schwer zu lesen. Wir starten in einem Verhör, Estela beschreibt die vergangenen sieben Jahre im Haushalt der Familie López. Es ist absolut erschrecken, was in dieser Familie abgeht, wie wenig andere Menschen von diesen beiden Personen wahrgenommen werden, nicht einmal das eigene Kind wird für voll genommen. Es ist ein aufrüttelnder Roman, der die Klassengesellschaft in Chile anklagt. Den absoluten Leistungsdruck und Perfektionismus für alle Menschen zerstört am Ende alles. Einer der besten Romane, die ich jemals gelesen habe.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Das Kind ist tot. Sieben Jahre lang hat sich das Kindermädchen Estela um Julia gekümmert, ihr das Essen gemacht, ihre Wäsche gewaschen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Davon erzählt Estela in einem Verhör - und Alia Trabucco Zerán in ihrem neuen Roman …
Mehr
Das Kind ist tot. Sieben Jahre lang hat sich das Kindermädchen Estela um Julia gekümmert, ihr das Essen gemacht, ihre Wäsche gewaschen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Davon erzählt Estela in einem Verhör - und Alia Trabucco Zerán in ihrem neuen Roman "Mein Name ist Estela", der jüngst in der deutschen Übersetzung aus dem chilenischen Spanisch von Benjamin Loy bei Hanser Berlin erschienen ist.
Es ist ein merkwürdiger Roman. Das liegt zunächst einmal an der ungewohnten Erzählform, bei der Estela sich direkt an ihr Publikum richtet. Das ist einerseits die Zuhörerschaft beim Verhör, offenbar versteckt hinter einer nur einseitig einsehbaren Glasscheibe und andererseits ist es natürlich die Leserschaft. Wenn Estela also im ersten Satz fragt "Mein Name ist Estela, können Sie mich hören?", so fühlt man sich direkt von ihr angesprochen. Und auf den nächsten 240 Seiten wird man keine andere Erzählstimme vernehmen.
Grundsätzlich ist es eine originelle Erzählstimme, schließlich kommt es in der Literatur immer noch selten vor, von der Hauptfigur so unmittelbar konfrontiert zu werden. Allerdings ist die Umsetzung ein wenig holprig. Ständig unterbricht Estela sich selbst, um sich an die Zuhörerschaft zu wenden. Fast hat man das Gefühl, als existierte diese nur als Mittel zum literarischen Zweck. Das Erstaunliche daran ist, dass Estela die Schwächen ihrer Erzählung - und somit des Romans - selbst bemerkt. "War das ein Gähnen?", fragt sie an einer Stelle, "das ist reines Gelaber", befindet sie später. Und man kann ihr durchaus zustimmen, denn der Roman hat merkliche Längen. Hinzu kommt, dass diese Ausbrüche recht stark den Erzählfluss stören. So, als müsste Zerán die Leser:innen immer und immer wieder daran erinnern, dass Estela gerade verhört wird.
Dabei ist die Ausgangssituation durchaus spannend. Natürlich möchte man wissen, warum das Hausmädchen verhört wird. Hat sie den Tod des ihr anvertrauten Kindes verschuldet? Ist sie gar eine Mörderin, wie das Kindermädchen in Leïla Slimanis "Dann schlaf auch du"? Zerán gelingt es in diesen Momenten gut, die Spannung subtil aufzubauen. Die Abschweifungen, die Estela unternimmt, sind nachvollziehbar, werden aber zu häufig eingesetzt. Immer wieder gibt sie Hinweise darauf, dass die folgenden Aussagen sehr wichtig für die Aufklärung des Todesfalls seien. Letztlich entpuppen sich diese im Finale aber als leere Versprechungen, ohne genauer darauf eingehen zu können.
Was der Autorin misslingt, ist die Mischung aus Kriminalfall und Gesellschaftskritik. Letztere wird im Roman überdeutlich und bisweilen plakativ dargestellt. Julias Eltern - der Vater ist Arzt, die Mutter arbeitet in einem führenden Holzunternehmen - glänzen einerseits durch Abwesenheit, andererseits durch ihre Oberflächlichkeit. Zwar behandeln sie ihre Angestellte gut, wie Estela hinreichend erklärt, doch sowohl ihr, als auch ihrer Tochter gegenüber mangelt es an Empathie. Passend zum Beruf der Mutter wirkt die Zusammenführung der beiden Stränge im Finale hölzern und nicht konsequent. Zwar muss nicht alles auserzählt werden, aber 240 Seiten lang, etwas zu versprechen, was nicht eingehalten wird, ist dann doch recht enttäuschend.
Sprachlich ist der Roman vor allem dann interessant, wenn Estela aus ihrem Dienstmädchen-Alltag ausbricht und sich beispielsweise an ihre Kindheit erinnert. Plötzlich wirkt die Sprache berauschend und frei, so wie es Estela als Kind zu dieser Zeit wohl auch noch war. In das Korsett des Verhörs eingeschnürt, erzählt die Protagonistin ansonsten oft recht nüchtern, manchmal philosophisch. Wenn man sich über mangelnde Authentizität beklagen möchte, dass eine Angestellte eines eher niederen Ranges so daherreden kann, liefert die Autorin nach einigen Seiten gleich die Erklärung dazu: Estela hat als Kind Unmengen an Büchern gelesen.
Insgesamt ist "Mein Name ist Estela" ein nur in Ansätzen gelungener Roman, der in seiner Mischung aus Krimi und Gesellschaftskritik vielleicht zu viel will und letztlich daran scheitert. Ambitioniert ist das Ganze aber in jedem Fall, so dass man das Buch zuschlägt und der Protagonistin zurufen möchte: "Ja, Estela, wir haben dich gehört!"
2,5/5
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Eine intensive und bewegende Geschichte aus Chile
Gleich zu Beginn wissen wir folgendes: ein siebenjähriges Mädchen ist gestorben, die Hintergründe erfahren wir im Laufe des Romans. Und: die Ich-Erzählerin wird verdächtig, sitzt irgendwo eingesperrt und erzählt laut …
Mehr
Eine intensive und bewegende Geschichte aus Chile
Gleich zu Beginn wissen wir folgendes: ein siebenjähriges Mädchen ist gestorben, die Hintergründe erfahren wir im Laufe des Romans. Und: die Ich-Erzählerin wird verdächtig, sitzt irgendwo eingesperrt und erzählt laut ihre Geschichte, in der Vermutung, dass sich hinter ihrem Gefängnis Empfänger*innen für ihre Worte befinden.
Estela zieht von zu Hause weg in die große Stadt, und nimmt einen Job als Haushaltshilfe an. Ihre Arbeitgeber gehören der gehobenen Schicht an, und führen einen dementsprechenden Umgang mit ihr. Was Estela beim knapp geführten Einstellungsgespräch nicht wusste war der der Umstand, dass sie sehr bald neben Haushaltshilfe auch noch Kindermädchen für die Tochter des Hauses sein wird.
Estela , zwar ohne Erfahrung in solchen Dingen, nimmt es stoisch an, lernt und gibt ihr Bestes. Sie arbeitet und tut, was von ihr verlangt wird, wird zu einer Art gefühllosem Zombie.
Die Herrschaften behandeln sie meistens korrekt, die Distanz zwischen ihnen bleibt dennoch eine undurchbrechbare Mauer. Die Erziehung des heranwachsenden Mädchens muss meistens Estela übernehmen, es entwickelt sich im Laufe der Jahre eine poröse Beziehung innerhalb der vier Personen, eingepfercht in Familie und Pflichtbewusstsein.
Estela spart ihr Geld, möchte eines Tages das Haus ihrer Mutter, in welches sie irgendwann zu ziehen gedenkt, renovieren. Doch die Verwandtschaft sieht das anders, angelockt von Estelas Ersparnissen werden Gründe gefunden, diese anzuzapfen. So wird sie auf zwei Seiten ausgeblutet, wird zur Marionette zwischen ihren reichen Arbeitgebern und der Armut im Rest des Landes.
Die Sprache ist sehr bildhaft, poetisch und von einer eindringlichen Wucht beseelt. Man fühlt mit der Erzählerin mit, leidet, und neigt dazu, den Senor, die Senora und vor allem das kleine Mädchen, das sich manchmal zu einer gemeinen Göre entwickelt, zu verdammen. Und dennoch scheinen alle handelnden Personen in diesem sehr außergewöhnlichen Roman auf ihre eigene Art zu leiden.
Die Ehe scheint trist und emotionslos, die kleine Julia nur die Frucht der Verpflichtung um Nachwuchs in einem gehobenen Haus. Die gesamte Stimmung im Roman bleibt trist und grau, ohne erhellende Szenen. Ein latentes Laken verdeckt den Blick auf die Sterne, die eine bessere Zukunft verheißen könnten.
Die Unterschicht arbeitet sich auf ohne nennenswerte Verdienste, und bleibt das, was sie ist, nämlich arm. Und im Zweifelsfall nie das Opfer.
Wer letztendlich die Schuld am Tod des Kindes trägt – bitte selber lesen in diesem kleinen Gesellschaftsepos aus Chile.
Sehr gerne gelesen bleibt die Erinnerung an die Zeilen sicherlich lange präsent.
Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eiskaltes Familienleben unter der sengenden chilenischen Sonne
In einem schicken Haus in einem noblen Vorort von Santiago de Chile ist ein kleines Mädchen gestorben. Die Haushälterin Estela scheint in irgendeiner Weise in den Tod verstrickt zu sein. Aus ihrer Sicht erfahren wir, wie …
Mehr
Eiskaltes Familienleben unter der sengenden chilenischen Sonne
In einem schicken Haus in einem noblen Vorort von Santiago de Chile ist ein kleines Mädchen gestorben. Die Haushälterin Estela scheint in irgendeiner Weise in den Tod verstrickt zu sein. Aus ihrer Sicht erfahren wir, wie sich das elitäre Leben in der Familie, die ihr Arbeitgeber war, zugetragen hat. In einer Art Verhör holt Estela weit aus, sodass die Umstände des Unglücks fast bis zum Schluss unklar bleiben: Sie erzählt von ihrer Kindheit auf dem Land, ihrer starken Bindung zur Mutter, die sie dort zurückließ, ihrem Alltag als Haushälterin der Señores und der lieblosen Kindheit des Mädchens.
Vor dem Hintergrund wachsender sozialer Probleme in Chile hat Trabucco Zerán einen erschütternden Roman geschrieben, der exemplarisch die Kluft zwischen reicher Oberschicht auf der einen und zu niederen Arbeiten verdammten Prekariat auf der anderen Seite aufzeigt. Nur scheinbar trägt Estela eine große Gelassenheit zur Schau und brodelt innerlich doch vor Wut angesichts des respektlosen und undankbaren Umgangs ihrer Arbeitgeber. Sogar deren kleine Tochter führt sich zuweilen so auf, dass Estela mehrmals ihre Zuneigung zu dem ursprünglich unschuldigen Kind in Frage stellt. Estela macht sprachgewaltig immer wieder klar, wie sehr sie sich von diesem Ort weg wünscht und findet doch den Absprung nicht. Erst in der Isolation (einer Zelle? Eines Verhörraums? Man erfährt es nie.) gelingt es ihr, Abstand zu gewinnen und die Geschehnisse zu ordnen.
Der Roman war ein großer (auch sprachlich) aufwühlender Genuss.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Unsere Protagonistin, Estela, schildert aus ihrer Sicht, wie es zum Tod des kleinen Mädchens gekommen war, auf das sie jahrelang aufgepasst hatte. Hierzu holt sie aus, bis in ihre Kindheit in Chile zurück.
Auf subtile Weise wird beschrieben, wie mit der Hausangestellten umgegangen wird …
Mehr
Unsere Protagonistin, Estela, schildert aus ihrer Sicht, wie es zum Tod des kleinen Mädchens gekommen war, auf das sie jahrelang aufgepasst hatte. Hierzu holt sie aus, bis in ihre Kindheit in Chile zurück.
Auf subtile Weise wird beschrieben, wie mit der Hausangestellten umgegangen wird und welche Stellung sie im Hause ihrer Herrschaften hat. Die Distanz zwischen den Herrschaften und der Angestellten ist sofort spürbar, insbesondere auch, weil Estela ausschließlich von dem namenlosen Señor, seiner Señora und dem Mädchen spricht. Durchdacht, plakativ und besonders! Es geht in diesem Roman auch um, und das dürfte keine Überraschung sein, Macht. Natürlich sitzen die Herrschaften am längeren Hebel, mag man denken, aber Estela ist trotzdem die einzige Person, die namentlich benannt wird und schlussendlich mehr weiß und mehr zu erzählen hat, als der Señor und seine Señora. Der Klassenunterschied wird sehr deutlich aufgezeigt. Und erst nachdem etwas Schlimmes passiert ist, bekommt die sehr wahrscheinlich ausgenutzte Hausangestellte eine Stimme, was sehr symbolträchtig wirkt.
Insgesamt ein lesenswerter Roman. Allerdings ziehe ich einen Stern ab, weil es einen Handlungsstrang gibt, den ich für mehr als überflüssig und überpräsent gehalten habe. Und warum muss mittlerweile in jedem neuerschienenen Roman das Wort f***** vorkommen? Soll es moderner wirken? Aktueller? Ich habe dafür wenig Verständnis und finde es nervig.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Interessanter Roman über soziale Ungleichheit in Chile
Estela ist schon über 30 als sie in die Hauptstadt Chiles geht, um dort sieben Jahre lang als Hausangestellte bei einer reichen Familie zu arbeiten. Er ist Arzt, sie Geschäftsführerin, später kommt noch ein Kind dazu, …
Mehr
Interessanter Roman über soziale Ungleichheit in Chile
Estela ist schon über 30 als sie in die Hauptstadt Chiles geht, um dort sieben Jahre lang als Hausangestellte bei einer reichen Familie zu arbeiten. Er ist Arzt, sie Geschäftsführerin, später kommt noch ein Kind dazu, das entgegen Estelas Protesten an sie abgeschoben wird. Nun ist das Kind tot und Estela sitzt in einem Verhörraum. Stück für Stück erzählt sie ihre Geschichte, die von unüberbrückbaren Klassenunterschieden, schwierigen gesellschaftlichen Verhältnissen und einer dysfunktionalen Familie erzählt.
„Mein Name ist Estela“ ist kein einfaches Buch. Mit jedem Kapitel wird es beklemmender und Estelas Leben immer enger. Außerdem hat die Erzählstimme eine, wie ich zunächst fand, schnodderige Art, die ich den Ereignissen unangemessen fand. Später kommt der Verdacht auf, dass sie vor allem aufmüpfiger wird. Estela erzählt, wie sie Teil des Haushalts, aber nie der Familie wird. Selbst wenn sie zum Weihnachtsessen eingeladen wird, wird von ihr erwartet, den Tisch auf- und abzudecken. Immer wieder erlebt sie Situationen, in denen ihr ihr Platz in der Welt klargemacht wird. Auch wenn sie wiederholt sagt, dass sie sich nicht um ein Kind kümmern möchte, bleibt es doch letztlich an ihr hängen. Das Verhältnis ist jedoch ambivalent. Von dem Kind wird viel erwartet, die Eltern sind ehrgeizig und die Erziehungsmethoden fragwürdig. So bilden Estela und das Kind bald eine Zwangsgemeinschaft. Doch die Kleine probiert bei Estela auch immer wieder ihre Privilegien aus und auch Estela instrumentalisiert das Kind in ihren kleinen Sabotageakten der Familie.
Dieser Roman ist nicht immer einfach, denn er lässt viel Raum für Interpretation und an der ein oder anderen Stelle wären kulturelle Hintergrundinfos sicherlich hilfreich. Deutlich wird jedoch die Kritik an den immer noch bestehenden gravierenden Klassenunterschieden. Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund der Proteste gegen die soziale Ungleichheit in Chile. Natürlich geht es auch darum, wie das Kind zu Tode kam und welche Rolle Estela dabei gespielt haben könnte. Aber die Handlung kann man auch vor dem größeren Rahmen betrachten und überlegen, ob Estelas Geschichte nur als Beispiel dient um die soziale Ungleichheit in Chile zu verdeutlichen. Viele doppeldeutige oder unnötig wirkende Szenen bieten zudem weiteren Interpretationsspielraum. Am Ende gibt die Autorin wenig vor, wie die Dinge zu interpretieren sind. Das kann an der ein oder anderen Stelle etwas unbefriedigend sein, denn der Bezug mancher Szene ist schwer nachzuvollziehen. Insgesamt bekommt man mit diesem Roman einen interessanten Einblick in die aktuelle chilenische Gesellschaft und deren Diskussionspunkte, gleichzeitig aber auch Spannung und Emotionen (in erster Linie eher Erschütterung und Empörung).
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein atemlos erzähltes und sehr gelungenes Buch über die Abgehängten dieser Welt
In dem Roman mit dem Titel „Mein Name ist Estela“ von der chilenischen Autorin Alia Trabucco Zerán, erschienen im Hanser Berlin Verlag, sitzt die Hausangestellte Estela García, …
Mehr
Ein atemlos erzähltes und sehr gelungenes Buch über die Abgehängten dieser Welt
In dem Roman mit dem Titel „Mein Name ist Estela“ von der chilenischen Autorin Alia Trabucco Zerán, erschienen im Hanser Berlin Verlag, sitzt die Hausangestellte Estela García, auch Lita genannt, vermutlich in Untersuchungshaft. Sie spricht über die Umstände, die zu allem geführt haben. Das Mädchen ist tot, das sie sieben Jahre betreut hat. Die Erzählstimme ist ungewöhnlich. Dabei wird klar, dass Estela ihre Arbeit durch Sachzwänge nicht einfach so hätte kündigen können. Sie ist von der Insel Chiloé nach Santiago gekommen, um die arme und kranke Mutter finanziell zu unterstützen. Dafür muss sie sechs Tage in der Woche in der Villa schuften, die sie ebenfalls bewohnt. Vielmehr ein Zimmerchen neben der Küche mit Schiebetür. An ihrem freien Tag ist sie so ausgelaugt, dass sie den ganzen Tag im Bett bleiben muss.
Das bedeutet Null Privatsphäre, kein eigenes Leben. Die beiden Arbeitgeber sind nur mit sich selbst beschäftigt und laufen der Zeit hinterher, ohne ebenfalls selbst zu leben. Ein leeres Leben, in das Lita hineingezogen wird. Der Schreibstil ist sensationell. Die Spannung ist sofort da und man möchte wissen, wie die Tochter des Hauses, Julia, gestorben ist. Das erfolgreiche und wohlhabende Paar, bestehend aus der tablettenabhängigen Anwältin Mara und dem zynischen Arzt Cristobal, ist extrem gefühlskalt und sieht Julia eher als ein Projekt, das nach Fortschritt beurteilt wird und das anderen als eigene Leistung vorgeführt wird. Diese bricht sich selbst einen Finger, damit sie nicht Klavier spielen muss. Drei Wochen Gips bedeuten, drei Wochen nicht üben zu müssen. Was für eine überzogene Reaktion. Das Kind wird immer aufsässiger, tyrannischer und selbstzerstörerischer. Die Eltern üben zu starken Druck aus, das wird überdeutlich.
Die streunende Hündin Yany, die Lita ins Herz schließt, betritt die Bühne und wird von einer Ratte gebissen und beißt wiederum die Tochter des Hauses. Eine tragische Kettenreaktion. Wie so vieles. Es folgt eins auf das andere, wie beim Dominoeffekt. Nach einem Überfall im Haus werden Alarmanlage und Elektrozaun installiert. Nicht nur im Haus selbst spitzen sich die Ereignisse zu, sondern auch im Viertel. Die Armen gehen auf die Straße und protestieren gegen die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheit, gegen die Obrigkeit. Es läuft darüber etwas im Fernsehen, der immer läuft. Die reiche Familie hat Angst. Angst führt zu Kurzschlussreaktionen. In fast allem zeigt sich die unfassbare Ungerechtigkeit, mit der die Familie entscheidet, dabei die Verluste anderer in Kauf nimmt. Die Erzählung Estelas hebt sich aber die ganze Auflösung bis zum Schluss auf.
Fazit: Ich habe mitgefiebert und auch gelitten. Das Buch ist keine einfache Kost. Man kann so viel Unrecht und Tragik kaum aushalten. Und die Duldsamkeit kaum ertragen. Aber der Roman fesselt trotz alledem oder gerade deswegen. Ein atemlos erzähltes und sehr gelungenes Buch über die Abgehängten dieser Welt. 5 Sterne!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für