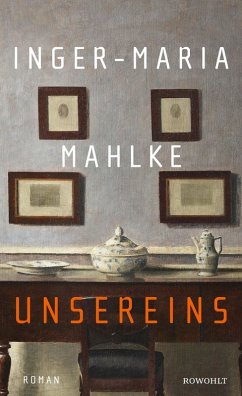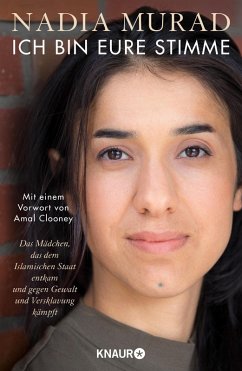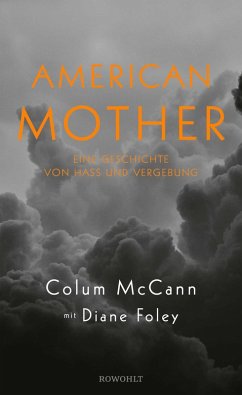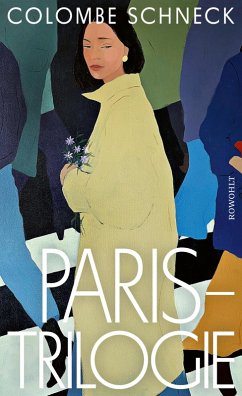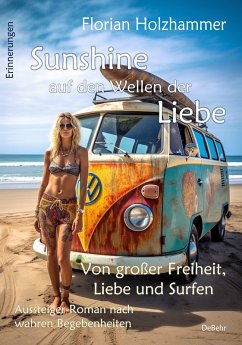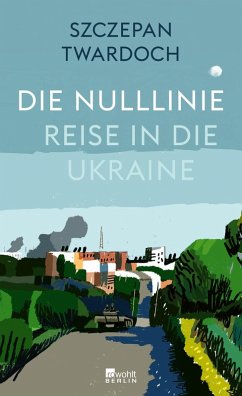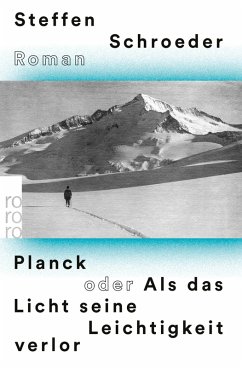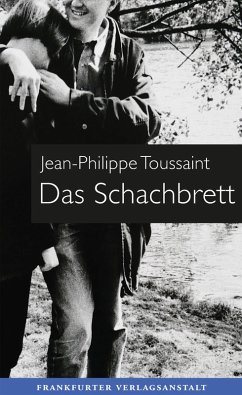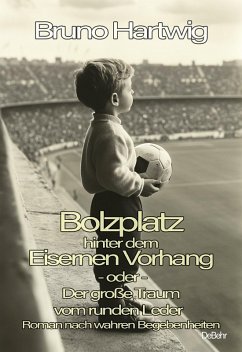Sofort per Download lieferbar
Statt: 26,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Vierundsiebzig (eBook, ePUB)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 8.69MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Entspricht WCAG Level AA Standards
- Entspricht WCAG 2.1 Standards
- Alle Inhalte über Screenreader oder taktile Geräte zugänglich
- Sehr hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 7 =>1)
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation
- Navigation über vor-/zurück-Elemente ohne Inhaltsverzeichnis
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)
- Seitennummerierung folgt dem gedruckten Werk
- Kurze Alternativtexte für nicht-textuelle Inhalte vorhanden
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis für direkten Zugriff auf Text und Medien
- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1
Ronya Othmann, als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-êzîdischen Vaters 1993 in München geboren, schreibt Lyrik, Prosa und Essays und arbeitet als Journalistin. Für ihr Schreiben wurde sie viele Male ausgezeichnet, u.a. mit dem Lyrik-Preis des Open Mike, dem MDR-Literaturpreis und dem Caroline-Schlegel-Förderpreis für Essayistik. Für Die Sommer, ihren ersten Roman, bekam sie 2020 den Mara-Cassens-Preis zugesprochen, für den Lyrikband die verbrechen (2021) den Orphil-Debütpreis, den Förderpreis des Horst-Bienek-Preises und den Horst Bingel-Preis 2022. Vierundsiebzig, ihr zweiter Roman, wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und mit dem Düsseldorfer Literaturpreis, dem Preis der SWR-Bestenliste 2024 sowie dem Erich-Loest-Preis 2025 ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt Verlag GmbH
- Seitenzahl: 512
- Erscheinungstermin: 12. März 2024
- Deutsch
- ISBN-13: 9783644016897
- Artikelnr.: 69210595
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Das vom Verlag als Roman ausgegebene Buch von Ronya Othmann ist eher eine subjektive Reportage, legt Rezensent Oliver Jungen nahe, und zwar eine "Dokumentation der Enthemmung und Entmenschlichung". Denn in dem stark autobiografisch geprägten Buch über den Genozid, der am 2014 vom Islamischen Staat am Volk der Jesiden verübt wurde, reihen sich die Grausamkeiten aneinander: So beleuchtet Othmann, selbst Tochter eines säkularen Jesiden und einer Deutschen, von der Ermordung, Vertreibung und Versklavung Tausender Jesiden unter Mithilfe der benachbarten Muslime, von der psychischen "Verwüstung" und Sprachlosigkeit der Hinterbliebenen, von verdurstenden Fünfjährigen, auch von der Rolle der
Mehr anzeigen
Türkei und dem eigenen "antimuslimischen Affekt", gibt Jungen wieder. Das sei hart zu lesen und auch inhaltlich sehr viel, sodass Jungen zum Teil den Überblick über alle Ortschaften, Milizen und Verflechtungen verliert. Trotzdem findet er extrem eindrücklich und wichtig, wie Othmann ihre spezielle Perspektive - einerseits eingebunden, andererseits aus westlich-aufgeklärter Beobachterposition - nutzt, um auf subjektive Weise, dabei aber bis auf wenige poetische Einsprengsel in betont nüchternem Stil, "sprachlich-politische Aufbauarbeit" zu leisten. "Bedeutsamer" war autobiografisches Schreiben "hierzulande lange nicht mehr", schließt Jungen anerkennend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Schließen
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2024Ihre Geschichte
"Vierundsiebzig": Ronya Othmann versucht, den Genozid an den Jesiden in einem Roman zu dokumentieren.
Von Alexandru Bulucz
Die Hauptfigur will vom jüngsten Genozid an den Jesiden Zeugnis abzulegen. "Es ist zu viel, denke ich. Ich frage mich, wer wird das lesen wollen? Ich verbiete mir diese Frage", sagt sie. "Was hat das mit mir gemacht, was habe ich gefühlt, als ich diese Geschichten erzählt bekommen habe? Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Ich habe nur geschrieben."
Das Vorhaben, den Genozid zu dokumentieren, ist an dieser Stelle schon weit fortgeschritten. Es geht dann über ins letzte Drittel dessen, was nun als zweiter Roman von Ronya Othmann vorliegt. Die Autorin und
"Vierundsiebzig": Ronya Othmann versucht, den Genozid an den Jesiden in einem Roman zu dokumentieren.
Von Alexandru Bulucz
Die Hauptfigur will vom jüngsten Genozid an den Jesiden Zeugnis abzulegen. "Es ist zu viel, denke ich. Ich frage mich, wer wird das lesen wollen? Ich verbiete mir diese Frage", sagt sie. "Was hat das mit mir gemacht, was habe ich gefühlt, als ich diese Geschichten erzählt bekommen habe? Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Ich habe nur geschrieben."
Das Vorhaben, den Genozid zu dokumentieren, ist an dieser Stelle schon weit fortgeschritten. Es geht dann über ins letzte Drittel dessen, was nun als zweiter Roman von Ronya Othmann vorliegt. Die Autorin und
Mehr anzeigen
Dichterin wurde 1993 in München als Tochter einer Deutschen und eines Jesiden aus Syrien geboren. In "Die Sommer", ihrem Romandebüt von 2020, hatte sie noch eine an die eigene Biographie angelehnte Figur namens Leyla vorgeschickt, um über jesidisches Leben zu berichten. Jetzt, in "Vierundsiebzig", das "Die Sommer" thematisch und chronologisch weiterführt, sieht sie von einer Fiktionalisierung gänzlich ab und wirft sich selbst in die Waagschale. Trotzdem gilt ihr alles, was sie schreibt, als Fiktion.
Sich mit ganz und gar zur eigenen Betroffenheit qua Herkunft zu bekennen, sich ein Buch lang ins Zentrum der Narration vorzuwagen, wird sich als literarischer Befreiungsschlag erweisen. Ronya, "mit weichem R, langem O". Othmann, was wahrscheinlich auf "Osman", den Namen des jesidischen Ururgroßvaters, zurückgeht. Sie ist es selbst, die spricht, persönlich und ungeschützt, auch wenn sie sich auf ihren drei Reisen nach Kurdistan 2018, 2019 und 2022 meist als Journalistin vorstellt und das Berufsethos der Neutralität nie aus den Augen verliert. Die Ermordung ihres jesidischen Urgroßvaters Cindî, die jüngere Vertreibungs- und Fluchtgeschichte ihrer Familie und Verwandtschaft, die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt - all das ist Beweggrund ihrer großangelegten Schmerzdarstellung.
Immer wieder unterbrechen poetologische Passagen den manisch berichtenden, dokumentierenden, erinnernden und kartographierenden Strom des Romans. Sie zeugen vom inneren Widerstreit eines Menschen, der sich zum Medium der Zeugnisse Überlebender gemacht hat und beim Aufnahmeprozess zusehen muss, wie sich seine innere Verfassung verändert. Ein Mensch, der aufzeichnet und recherchiert und sich dabei die eigene Identität erschreibt. Ein Mensch, dessen Arbeit nach allen Seiten retraumatisierend wirkt. Das Zuviel an detaillierter Information über die an Jesiden verübte Gewalt, oft sexualisierte Gewalt, ist überwältigend, doch im Grunde macht dieses Zuviel nur einen winzigen Bruchteil der ganzen Geschichte aus.
Was am 3. August 2014 begann, ist ins kollektive Gedächtnis der Jesiden als 74. Ferman eingegangen - das Wort stammt aus dem Persischen und meint "Erlass". Es war der 74. Versuch, in diesem Fall des "Islamischen Staats", die Jesiden systematisch auszulöschen, weil sie Jesiden sind, dem IS zufolge teufelsanbetende Ungläubige. Indem uns Othmann den 74. Ferman im Kontext der dauerhaften Verfolgung der Jesiden erschließt, legt sie ein Strukturmerkmal der jesidischen Geschichte offen, das die Jesiden mit anderen historisch marginalisierten Gruppen zu verbinden scheint. Armenier, Aleviten, Bosniaken, Juden - in "Vierundsiebzig" treten sie alle als "Geschwister" der Jesiden auf. Doch Othmann bleibt skeptisch, ob erlittenes historisches Unrecht allein Allianzbildungen begründen kann:
"Ist es eine Verwandtschaft im Schmerz oder eine Verwandtschaft, die sich aus den Verbrechen ergibt? Eine Anerkennung der Gewaltverbrechen, die an anderen verübt wurden, der Versuch, etwas zu sagen, das einer Beileidsbekundung gleichkäme, wo doch keine solche Formel ausreichen kann. Oder ist die hier beschworene Verwandtschaft am Ende nur eine wohlmeinende Lüge. Die Beschwörung einer Gemeinschaft von Opfergruppen, die es so gar nicht gibt."
Überlegungen aussprechen, direkt relativieren, revidieren oder gar streichen: Eine diesen Roman bestimmende Technik, mit der sich Othmann entschleunigt und sich vor voreiligen Schlüssen bewahrt. Das ist keine Stilisierung und auch keine Flucht vor Vereindeutigung, sondern eine volle Anerkennung von Komplexitäten. Othmann ist hin- und hergerissen zwischen einem ausdrücklichen Misstrauen gegenüber dem "Wir" und einer starken Selbstidentifizierung als Jesidin: "Ich traue dem Wir nicht mehr, und ich traue dem Ich nicht mehr", heißt es noch recht am Anfang des Romans. Und gegen Ende: "Wir, schreibe ich, haben keine Geschichte." Es ist eine Instabilität, deren Gründe sie nicht zuletzt im Jesidentum selbst finden wird.
Othmann hat nicht vergessen, dass ihre Schwester sie einmal eine "Abtrünnige" genannt hatte. Auch der Vater, ein ehemaliger verfolgter Kommunist und Atheist, kokettiert damit, ein Abtrünniger zu sein, denn er hat eine Deutsche geheiratet. Nach jesidischer Tradition darf aber nur unter Jesiden geheiratet werden, sonst droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Dass ihn dieses Schicksal nicht ereilt habe, liege daran, dass er ein Mann sei und nicht schwul, heißt es einmal. "Ich sage mir", so Othmann, "ich muss einen schwulen Êzîden heiraten. Scheinehe, sage ich mir. Aber es ist nicht nur das. Ich sage mir, ich muss das streichen. Darüber kann ich nicht sprechen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen." Dass sie dann doch über die Reformnotwendigkeit des Jesidentums spricht und sprechen lässt, macht ihren Roman umso schonungsloser, denn der Genozid an den Jesiden liegt noch gar nicht lange zurück, als der Verkauf von Alkohol oder lackierte Fußnägel leicht ein Todesurteil bedeuten konnten.
Was Othmann dann auf ihren unsicheren Recherchereisen aufzeichnet, die sie stets in Begleitung, auch ihres Vaters, unternimmt, ist nur noch entsetzlich. Sie erfährt zum Beispiel von der Verschleppung einer Frau mit Kind, kein Jahr alt, die an einen Emir geraten. Weil er vom unaufhörlichen Hungergeschrei des Kindes nicht schlafen konnte, soll er es der Mutter weggenommen, es in die Küche gebracht, ihm dort den Kopf abgeschnitten, dessen Fleisch gekocht und es der Mutter dann vorgesetzt haben. Eine Bestialität des IS war auf die nächste gefolgt, aus purem Hass. Und überall dort, wo es ihr möglich ist, dokumentiert Othmann auch die Namen der Opfer und entreißt sie auf diese Weise dem ansonsten sicheren Vergessen.
In einer Halle des Amna-Suraka-Museums in Silêmanî traut Othmann ihren Augen nicht, als sie feststellt, dass dort nichts an Jesiden erinnert: "Ist die Wunde noch zu frisch? Oder ist die Geschichte der Êzîden einfach nicht heldenhaft genug, im Gegenteil, ihr Sterben zu erbärmlich, um in diesem Museum davon zu erzählen?" Die Schreianfälle ihres Cousins Loran setzen immer dann an, wenn über Shingal, einen der Tatorte des IS, gesprochen wird, als könnte das Unsagbare nur noch mit unartikulierten Lauten kompensiert werden. Als Angelina Jolie als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks nach Mossul reist, fällt Othmann auf, dass sie keine jesidischen Familien besucht hat. Die Frau in Hamdûna, bei der Othmann Tee trinkt, bemerkt das Band mit den kurdischen Farben an ihrem Handgelenk, zerrt sie in die Küche, holt ein Messer und will es abmachen: "Wenn die das sehen, bringen sie dich um, oder sie sperren dich ein." Am Flughafen in Bagdad weigert sich Othmanns Vater, Arabisch zu sprechen, obwohl er es perfekt beherrscht: "Es ist die Sprache unserer Unterdrücker", sagt er. Anderswo behauptet er, nicht traumatisiert zu sein. Und immer so weiter.
Überall massive psychische Folgeschäden von Verfolgung und ein Mangel an Würdigung von Jesiden, ihres Schicksals, ihrer Kultur, ihrer Sprache. Ein Mangel, an dem eine abgeschwächte Form des "kulturellen Genozids" erkennbar wird, der in der Zerstörung jesidischer Heiligtümer durch den IS kulminierte. Oder eine "Auslöschung der Auslöschung", wie Othmann notiert, während der IS 2019 ganze Landstriche in Shingal in Brand steckt und Beweismittel des Genozids für immer verloren zu gehen drohen.
Im sicheren Deutschland, das die größte jesidische Diaspora weltweit beherbergt, verfolgt Othmann dann die juristische und politische Aufarbeitung des Genozids, besucht Gerichtsprozesse, so auch gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Niedersachsen, die ein gefesseltes jesidisches Kind in praller Sonne kaltblütig verdursten ließ. Und sie erforscht vor allem jesidische Kultur und entdeckt für uns den britischen Archäologen Austen Henry Layard und seine kanonischen Bücher über die Jesiden wieder, die auf Recherchen am Ort beruhen. Hier zeigt sich das große ethnographische Interesse Othmanns, die sich liebevoll, ja demütig dem jesidischen Brauchtum nähert.
"Ich habe Angst, dass das, was ich gesehen und gehört habe, mir entgleitet. Dass mir mein Blick verschwimmt", schreibt Ronya Othmann im ersten Teil ihres Romans. Die Angst stellt sich als unbegründet dar. "Vierundsiebzig" ist vieles in einem - Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Geschichtsschreibung in Echtzeit - und dennoch ein organisches Ganzes. Es ist ein Meilenstein der literarischen Genozidforschung und die Widerlegung der Behauptung, die Jesiden hätten keine Geschichte.
Ronya Othmann, "Vierundsiebzig". Roman. Rowohlt, 512 Seiten, 26 Euro. Alexandru Bulucz ist Lyriker und Übersetzer.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Sich mit ganz und gar zur eigenen Betroffenheit qua Herkunft zu bekennen, sich ein Buch lang ins Zentrum der Narration vorzuwagen, wird sich als literarischer Befreiungsschlag erweisen. Ronya, "mit weichem R, langem O". Othmann, was wahrscheinlich auf "Osman", den Namen des jesidischen Ururgroßvaters, zurückgeht. Sie ist es selbst, die spricht, persönlich und ungeschützt, auch wenn sie sich auf ihren drei Reisen nach Kurdistan 2018, 2019 und 2022 meist als Journalistin vorstellt und das Berufsethos der Neutralität nie aus den Augen verliert. Die Ermordung ihres jesidischen Urgroßvaters Cindî, die jüngere Vertreibungs- und Fluchtgeschichte ihrer Familie und Verwandtschaft, die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt - all das ist Beweggrund ihrer großangelegten Schmerzdarstellung.
Immer wieder unterbrechen poetologische Passagen den manisch berichtenden, dokumentierenden, erinnernden und kartographierenden Strom des Romans. Sie zeugen vom inneren Widerstreit eines Menschen, der sich zum Medium der Zeugnisse Überlebender gemacht hat und beim Aufnahmeprozess zusehen muss, wie sich seine innere Verfassung verändert. Ein Mensch, der aufzeichnet und recherchiert und sich dabei die eigene Identität erschreibt. Ein Mensch, dessen Arbeit nach allen Seiten retraumatisierend wirkt. Das Zuviel an detaillierter Information über die an Jesiden verübte Gewalt, oft sexualisierte Gewalt, ist überwältigend, doch im Grunde macht dieses Zuviel nur einen winzigen Bruchteil der ganzen Geschichte aus.
Was am 3. August 2014 begann, ist ins kollektive Gedächtnis der Jesiden als 74. Ferman eingegangen - das Wort stammt aus dem Persischen und meint "Erlass". Es war der 74. Versuch, in diesem Fall des "Islamischen Staats", die Jesiden systematisch auszulöschen, weil sie Jesiden sind, dem IS zufolge teufelsanbetende Ungläubige. Indem uns Othmann den 74. Ferman im Kontext der dauerhaften Verfolgung der Jesiden erschließt, legt sie ein Strukturmerkmal der jesidischen Geschichte offen, das die Jesiden mit anderen historisch marginalisierten Gruppen zu verbinden scheint. Armenier, Aleviten, Bosniaken, Juden - in "Vierundsiebzig" treten sie alle als "Geschwister" der Jesiden auf. Doch Othmann bleibt skeptisch, ob erlittenes historisches Unrecht allein Allianzbildungen begründen kann:
"Ist es eine Verwandtschaft im Schmerz oder eine Verwandtschaft, die sich aus den Verbrechen ergibt? Eine Anerkennung der Gewaltverbrechen, die an anderen verübt wurden, der Versuch, etwas zu sagen, das einer Beileidsbekundung gleichkäme, wo doch keine solche Formel ausreichen kann. Oder ist die hier beschworene Verwandtschaft am Ende nur eine wohlmeinende Lüge. Die Beschwörung einer Gemeinschaft von Opfergruppen, die es so gar nicht gibt."
Überlegungen aussprechen, direkt relativieren, revidieren oder gar streichen: Eine diesen Roman bestimmende Technik, mit der sich Othmann entschleunigt und sich vor voreiligen Schlüssen bewahrt. Das ist keine Stilisierung und auch keine Flucht vor Vereindeutigung, sondern eine volle Anerkennung von Komplexitäten. Othmann ist hin- und hergerissen zwischen einem ausdrücklichen Misstrauen gegenüber dem "Wir" und einer starken Selbstidentifizierung als Jesidin: "Ich traue dem Wir nicht mehr, und ich traue dem Ich nicht mehr", heißt es noch recht am Anfang des Romans. Und gegen Ende: "Wir, schreibe ich, haben keine Geschichte." Es ist eine Instabilität, deren Gründe sie nicht zuletzt im Jesidentum selbst finden wird.
Othmann hat nicht vergessen, dass ihre Schwester sie einmal eine "Abtrünnige" genannt hatte. Auch der Vater, ein ehemaliger verfolgter Kommunist und Atheist, kokettiert damit, ein Abtrünniger zu sein, denn er hat eine Deutsche geheiratet. Nach jesidischer Tradition darf aber nur unter Jesiden geheiratet werden, sonst droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Dass ihn dieses Schicksal nicht ereilt habe, liege daran, dass er ein Mann sei und nicht schwul, heißt es einmal. "Ich sage mir", so Othmann, "ich muss einen schwulen Êzîden heiraten. Scheinehe, sage ich mir. Aber es ist nicht nur das. Ich sage mir, ich muss das streichen. Darüber kann ich nicht sprechen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen." Dass sie dann doch über die Reformnotwendigkeit des Jesidentums spricht und sprechen lässt, macht ihren Roman umso schonungsloser, denn der Genozid an den Jesiden liegt noch gar nicht lange zurück, als der Verkauf von Alkohol oder lackierte Fußnägel leicht ein Todesurteil bedeuten konnten.
Was Othmann dann auf ihren unsicheren Recherchereisen aufzeichnet, die sie stets in Begleitung, auch ihres Vaters, unternimmt, ist nur noch entsetzlich. Sie erfährt zum Beispiel von der Verschleppung einer Frau mit Kind, kein Jahr alt, die an einen Emir geraten. Weil er vom unaufhörlichen Hungergeschrei des Kindes nicht schlafen konnte, soll er es der Mutter weggenommen, es in die Küche gebracht, ihm dort den Kopf abgeschnitten, dessen Fleisch gekocht und es der Mutter dann vorgesetzt haben. Eine Bestialität des IS war auf die nächste gefolgt, aus purem Hass. Und überall dort, wo es ihr möglich ist, dokumentiert Othmann auch die Namen der Opfer und entreißt sie auf diese Weise dem ansonsten sicheren Vergessen.
In einer Halle des Amna-Suraka-Museums in Silêmanî traut Othmann ihren Augen nicht, als sie feststellt, dass dort nichts an Jesiden erinnert: "Ist die Wunde noch zu frisch? Oder ist die Geschichte der Êzîden einfach nicht heldenhaft genug, im Gegenteil, ihr Sterben zu erbärmlich, um in diesem Museum davon zu erzählen?" Die Schreianfälle ihres Cousins Loran setzen immer dann an, wenn über Shingal, einen der Tatorte des IS, gesprochen wird, als könnte das Unsagbare nur noch mit unartikulierten Lauten kompensiert werden. Als Angelina Jolie als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks nach Mossul reist, fällt Othmann auf, dass sie keine jesidischen Familien besucht hat. Die Frau in Hamdûna, bei der Othmann Tee trinkt, bemerkt das Band mit den kurdischen Farben an ihrem Handgelenk, zerrt sie in die Küche, holt ein Messer und will es abmachen: "Wenn die das sehen, bringen sie dich um, oder sie sperren dich ein." Am Flughafen in Bagdad weigert sich Othmanns Vater, Arabisch zu sprechen, obwohl er es perfekt beherrscht: "Es ist die Sprache unserer Unterdrücker", sagt er. Anderswo behauptet er, nicht traumatisiert zu sein. Und immer so weiter.
Überall massive psychische Folgeschäden von Verfolgung und ein Mangel an Würdigung von Jesiden, ihres Schicksals, ihrer Kultur, ihrer Sprache. Ein Mangel, an dem eine abgeschwächte Form des "kulturellen Genozids" erkennbar wird, der in der Zerstörung jesidischer Heiligtümer durch den IS kulminierte. Oder eine "Auslöschung der Auslöschung", wie Othmann notiert, während der IS 2019 ganze Landstriche in Shingal in Brand steckt und Beweismittel des Genozids für immer verloren zu gehen drohen.
Im sicheren Deutschland, das die größte jesidische Diaspora weltweit beherbergt, verfolgt Othmann dann die juristische und politische Aufarbeitung des Genozids, besucht Gerichtsprozesse, so auch gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Niedersachsen, die ein gefesseltes jesidisches Kind in praller Sonne kaltblütig verdursten ließ. Und sie erforscht vor allem jesidische Kultur und entdeckt für uns den britischen Archäologen Austen Henry Layard und seine kanonischen Bücher über die Jesiden wieder, die auf Recherchen am Ort beruhen. Hier zeigt sich das große ethnographische Interesse Othmanns, die sich liebevoll, ja demütig dem jesidischen Brauchtum nähert.
"Ich habe Angst, dass das, was ich gesehen und gehört habe, mir entgleitet. Dass mir mein Blick verschwimmt", schreibt Ronya Othmann im ersten Teil ihres Romans. Die Angst stellt sich als unbegründet dar. "Vierundsiebzig" ist vieles in einem - Autobiographie, Biographie, Reiseliteratur und Geschichtsschreibung in Echtzeit - und dennoch ein organisches Ganzes. Es ist ein Meilenstein der literarischen Genozidforschung und die Widerlegung der Behauptung, die Jesiden hätten keine Geschichte.
Ronya Othmann, "Vierundsiebzig". Roman. Rowohlt, 512 Seiten, 26 Euro. Alexandru Bulucz ist Lyriker und Übersetzer.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Man muss Othmanns Nervenstärke bewundern, die nötig gewesen sein muss für ihre teilnehmende Beobachtung. Und das erzählerische Können, dem sich ihre atemberaubende literarische Reportage verdankt. Sie ist eine große Schriftstellerin. Ronald Düker Die Zeit 20240321
Das vom Verlag als Roman ausgegebene Buch von Ronya Othmann ist eher eine subjektive Reportage, legt Rezensent Oliver Jungen nahe, und zwar eine "Dokumentation der Enthemmung und Entmenschlichung". Denn in dem stark autobiografisch geprägten Buch über den Genozid, der am 2014 vom Islamischen Staat am Volk der Jesiden verübt wurde, reihen sich die Grausamkeiten aneinander: So beleuchtet Othmann, selbst Tochter eines säkularen Jesiden und einer Deutschen, von der Ermordung, Vertreibung und Versklavung Tausender Jesiden unter Mithilfe der benachbarten Muslime, von der psychischen "Verwüstung" und Sprachlosigkeit der Hinterbliebenen, von verdurstenden Fünfjährigen, auch von der Rolle der
Mehr anzeigen
Türkei und dem eigenen "antimuslimischen Affekt", gibt Jungen wieder. Das sei hart zu lesen und auch inhaltlich sehr viel, sodass Jungen zum Teil den Überblick über alle Ortschaften, Milizen und Verflechtungen verliert. Trotzdem findet er extrem eindrücklich und wichtig, wie Othmann ihre spezielle Perspektive - einerseits eingebunden, andererseits aus westlich-aufgeklärter Beobachterposition - nutzt, um auf subjektive Weise, dabei aber bis auf wenige poetische Einsprengsel in betont nüchternem Stil, "sprachlich-politische Aufbauarbeit" zu leisten. "Bedeutsamer" war autobiografisches Schreiben "hierzulande lange nicht mehr", schließt Jungen anerkennend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Schließen
„Vierundsiebzig“ zeigt, was Menschen erleiden müssen, die einer Gemeinschaft angehören, welche ihrem Gegenüber nicht gefällt. Jesiden gehören zum Beispiel dazu. Die Autorin Ronya Othmann hat sie alle besucht, die „Hinterbliebenen“. Das Grauen …
Mehr
„Vierundsiebzig“ zeigt, was Menschen erleiden müssen, die einer Gemeinschaft angehören, welche ihrem Gegenüber nicht gefällt. Jesiden gehören zum Beispiel dazu. Die Autorin Ronya Othmann hat sie alle besucht, die „Hinterbliebenen“. Das Grauen fühlt der Leser bei jedem ihrer Dokumentationen.
Der Genozid am Volk der Jesiden lässt sich kaum fassen. Die Autorin reiste an die Tatorte und in die Camps. Viele der Besuchten sind Verwandte. Anhänger des IS schlachteten und wüteten damals so, dass es keinen Vergleich für diese Grausamkeiten gibt. Es wurden Väter enthauptet. Deren Köpfe in die Hände des Sohnes gelegt. Ein Datum erwähne ich hier. Es war der 03.08.2014, als die Stadt Shingal heimgesucht wurde.
Für mich war das Buch schwierig zu lesen. Die Ereignisse gehen immer wieder hin und her. Und trotzdem bin ich dankbar, dass ich mehr über diese Massaker erfuhr. Es darf doch nicht sein, dass es bis heute keine Handhabe gegen diese selbsternannten „Gotteskrieger“ gibt. Für weitere Informationen gibt es ein Glossar und Quellen, die ebenfalls Grundlage für dieses Werk waren.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Dokumentation des Genozids an Jesiden
Ronya Othmann liefert in 'Vierundsiebzig' eine ausführliche Dokumentation über den Völkermord der Jesiden. Der Buchtitel macht darauf aufmerksam, dass im August 2014 wieder Menschen der Glaubensgemeinschaft getötet, vertrieben, gefangen …
Mehr
Dokumentation des Genozids an Jesiden
Ronya Othmann liefert in 'Vierundsiebzig' eine ausführliche Dokumentation über den Völkermord der Jesiden. Der Buchtitel macht darauf aufmerksam, dass im August 2014 wieder Menschen der Glaubensgemeinschaft getötet, vertrieben, gefangen genommen, gefoltert wurden – zum vierundsiebzigsten Mal ist das eine historisch belegbare Tatsache. In jenen Tagen ermordeten die Gotteskrieges des Islamischen Staates in der Region Shingal im Iran Menschen, die sich nicht zum Islam bekehren lassen wollten. Die Autorin berichtet über ihre Reisen in den Iran und in die Türkei, über das Elend, welches sie in Flüchtlingscamps gesehen hat. Sie zeigt auf den Genozid der Armenier, das Massenmorden von Saddam Hussein veranlasst, aber auch auf die Folterungen in türkischen Gefängnissen.
Sie möchte eine Sprache für das Unrecht finden, dass so vielen unschuldigen Menschen angetan wurde und noch wird, weil ihr Glaube nicht passend ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Genozid an den Jesiden
Eigentlich ist mit ja egal, ob dieses Buch ein Roman ist oder nicht. Wäre es ein Sachbuch, hätte es nicht am Deutschen Buchpreis teilgenommen und wäre nicht oder erst später bei mir gelandet, weil ich - wie jedes Jahr – die ganze Shortlist …
Mehr
Der Genozid an den Jesiden
Eigentlich ist mit ja egal, ob dieses Buch ein Roman ist oder nicht. Wäre es ein Sachbuch, hätte es nicht am Deutschen Buchpreis teilgenommen und wäre nicht oder erst später bei mir gelandet, weil ich - wie jedes Jahr – die ganze Shortlist lesen will.
Nach den beiden Nieten startet dieses Buch fulminant mit dem 3. August 2014, dem Tag als der Islamische Staat (IS) die Jesiden überfiel. 2018 fliegt sie zum ersten Mal ins Zweistromland, um mehr von diesem Genozid zu erfahren. Anfangs bedrückt mich die ganze Gewalt, die Kämpfe, die Morde, die Vergewaltigungen, die Entführungen.
Mir wird klar, dass die Autorin so keine 500 Seiten füllen kann und deswegen beschäftigt sie sich auch mit dem Familienbesuch, denn ihr Vater ist Jeside und ein großer Teil der Familie lebt noch im Morgenland, also in den heutigen Staaten Irak, Syrien, Türkei und Armenien.
Letztere beide werden auch ausführlich behandelt, haben doch die Türken 1916 einen Völkermord an den Armeniern verübt. Die Autorin zählt dann viele Völker auf, die „Geschwister“ der Jesiden sind, weil sie einen Völkermord erlitten haben. Im Museum in Erbil ist auch der Völkermord an den Asyrern (bin nicht ganz sicher, vielleicht hießen sie anders) dargestellt, den hier kaum jemand kennt.
Zwischenzeit wird ausführlich das Gerichtsverfahren gegen Jennifer W. Geschildert, die in Falludscha in der Sommerhitze ein 5jähriges Mädchen einfach verdursten ließ.
Während die meisten (früheren) Wohnorte der Jesiden im Kurdengebiet in Syrien und im Irak liegen, beschäftigt der Schlussteil sich mit einer Reise in die „Umstrittenen Gebiete“, die nicht von Erbil sondern von Bagdad aus verwaltet werden. Der Großvater der Autorin wurde schon in der Türkei umgebracht, der Rest der Familie konnte mit dem Auto ins Sindschar-Gebirge flüchten.
Die Autorin hat große Mühe aufgewandt und sich von „Ich schreibe“ über „Ich lese“ zu „Ich notiere“ weiterentwickelt. Zwischendurch behandelt sie auch die Geschichte der Jesiden, aber nur europäische Reisende scheinen schriftliche Quellen hinterlassen zu haben. Die jesidische Religion hat keine Bücher. Warum die Jesiden von ihren Nachbarn auch „Teufelsanbeter“ genannt werden, wird aber mit keinem Wort erwähnt und Carsten Niebuhr aus dem 18. Jahrhundert scheint die Autorin nicht zu kennen.
Es kann also noch ein dritter „Roman“ folgen. Für diesen gibt es 4 Sterne, das beste Buch der Shortlist, das ich gelsen habe, aber es folgen noch ein paar.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eindringlich, erschütternd, schonungslos – Ronya Othmanns Worte gehen tief in Mark und Bein, in Kopf und Herz und bleiben dort. Denn tief und existenziell ist ihre Frage nach einem Leben und Fortleben nach dem Moment, in dem die Zeit stillgestanden und das Unaussprechliche eingetreten …
Mehr
Eindringlich, erschütternd, schonungslos – Ronya Othmanns Worte gehen tief in Mark und Bein, in Kopf und Herz und bleiben dort. Denn tief und existenziell ist ihre Frage nach einem Leben und Fortleben nach dem Moment, in dem die Zeit stillgestanden und das Unaussprechliche eingetreten ist. Und die Uhren sich anschließend trotzdem weiterdrehen. Und die Welt verändert zurücklassen.
Der 3. August 2014 ist dieser Tag – der Tag des Einschnitts, Todes und der Vertreibung. Der Tag des Genozides an der ezidischen Bevölkerung, dem vierundsiebzigsten. Verübt durch den sogenannten Islamischen Staat, in Shingal im Irak. Tausende Menschen fanden den Tod, grausam ermordet oder verhungert und verdurstet in den Bergen Sindschars. Und weitere Tausende, vor allem Frauen und Mädchen, wurden entführt, in Sklaverei verkauft, vergewaltigt, entmenschlicht.
Für das Unaussprechliche Worte finden, dem Schrecken Bild und Ausdruck verleihen – Ronya Othmann begibt sich auf die Reise zu den Orten der Morde und Vertreibungen, in die Camps und Häuser der Menschen, traumatisiert und verwundet in Körper und Seele, auf die Spuren ihrer Verwandten. Ihre Begegnungen, Eindrücke und Erfahrungen in der Türkei, Syrien und Irak setzt sie dabei in Beziehung zu ihrer eigenen Familiengeschichte, verflechtet sie mit ihrem eigenen Leben, geprägt und für immer gezeichnet von dem Völkermord.
Die Sachlichkeit in ihrem Erzählen steht im Kontrast zu den verübten Grausamkeiten und schier endlosem Leid und ermöglicht so einen Zugang zu Geschehnissen, die aufgrund der hohen Emotionalität dessen, was sie bei Schreibender und Lesenden hervorrufen, sonst kaum greif- und ertragbar erscheinen. Und so schafft Othmann Gehör für Ungesagtes und Raum und Bereitschaft für die Auseinandersetzung mit dem Genozid, der in unserem Kulturkreis zu oft, zu lang Kopf und Herzen nicht erreichte. Und zugleich hat sie mit „Vierundsiebzig“ einen Roman erschaffen, der überdauern und bleiben wird – als Mahnung, Erinnerung, Zeugnis einer großen, aufstrebenden Autorin.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nervige Arabesken
Der zweite Roman von Ronya Othmann mit dem kryptisch erscheinenden, tatsächlich aber für unsägliche Gräuel stehenden Titel «Vierundsiebzig» schließt an ihren Debütroman an. Der hat ebenfalls die Ethnie der Jesiden zum Thema, eine etwa …
Mehr
Nervige Arabesken
Der zweite Roman von Ronya Othmann mit dem kryptisch erscheinenden, tatsächlich aber für unsägliche Gräuel stehenden Titel «Vierundsiebzig» schließt an ihren Debütroman an. Der hat ebenfalls die Ethnie der Jesiden zum Thema, eine etwa eine Million Angehörige zählende Volksgruppe im Kurdengebiet zwischen Syrien, dem Irak und der Türkei. Diese auf keinen heiligen Schriften, sondern nur auf mündlich weitergegebene Regeln beruhende Sekte wurde Opfer des IS, dem eine Theokratie anstrebenden ‹Islamischen Staat›. Es war das historisch 74ste Genozid, dem die «Teufelsanbeter» und Ungläubigen, wie die Islamisten sie nennen, in ihrer Geschichte ausgesetzt waren. Der Vater der Autorin ist ein säkularer kurdischer Jeside, der mit einer Deutschen verheiratet ist. Womit er sofort, nach den strengen Regeln der Sekte, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, denn Jesiden dürfen nur unter sich heiraten.
Ronya Othmann wurde in München geboren, ist im Landkreis Freising aufgewachsen und hat Literatur studiert. Im Fernsehen erfährt sie 2014 von den Gräueltaten an den Jesiden und sieht die flüchtenden Menschen, die ihre dort in Shingal lebenden Verwandten seien könnten. Sie müssen jetzt um ihr Leben rennen vor den Mördern des IS, sie ist entsetzt! Sie war schon öfter dort und hat mit dem Vater ihre Verwandtschaft besucht, und nun herrscht dort ein unbeschreiblicher Terror. Mit journalistischem Eifer beginnt sie, ihren Vater zu befragen und andere Jesiden, die sie kennt und die, wie 200.000 andere, in Deutschland in der weltweit größten Diaspora leben. In der Bibliothek findet sie Reiseberichte, die bis ins neunzehnte Jahrhundert zurückreichen, sie studiert alles, was mit der Geschichte der Jesiden zu tun hat und recherchiert im Internet. Immer wieder katalogisiert die Sammelwütige ihre Flut von Notizen, ordnet unzählige Ton- und Videoaufnahmen auf ihrem Smartphone und kopiert sie auf eine Festplatte. Im Jahre 2018 reist sie dann erstmals wieder mit ihrem Vater nach Shingal, um Material zu sammeln, sie möchte ein Buch über den 74sten Genozid schreiben. Diese Reise, der noch zwei weitere folgen, bildet den erzählerischen Rahmen für ihre Geschichte, deren Entstehen sie ebenfalls ausführlich schildert und das sie dann mit den Erlebnissen und Erfahrungen auf ihrer Reise zu einem gemeinsamen Erzählstrang verknüpft.
Die Autorin hat ihr Buch als Roman bezeichnet, und so ist es denn auch vom Verlag deklariert, was in den Feuilletons verschiedentlich beanstandet wurde. Es sei eher ein Reisetagebuch, eine Autobiografie, Dokumentation, Geschichtsschreibung oder subjektive Reportage, kann man da lesen. Andererseits, und das entspricht dann doch einem Roman, ist das Buch deutlich fiktional angereichert und enthält auch einige poetische Einsprengsel. Nachdem die kurdischen Peschmerga den IS zurückgedrängt hatten, sind die vertriebenen Jesiden allmählich in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihr auch als Dolmetscher fungierender Vater besucht mit ihr die Verwandtschaft, gemeinsam bereisen sie das ehemalige Jesiden-Gebiet. Immer wieder treffen sie dabei auf freundliche Leute, die ihnen gern weiterhelfen, wenn eine Fahrt an den Straßensperren der verschiedenen militärischen Gruppierungen zu scheitern droht.
Mit scharfem Blick für Details registriert die Autorin fast alles und beschreibt es minutiös. Die gastfreundlichen Menschen, sogar Soldaten oder Beamte, bieten ihnen sofort Tee an, wenn sie auf etwas warten müssen. Geschätzt Hunderte von Malen wird da Tee getrunken. Spätestens ab der Hälfte des gut gemeinten und absolut wichtigen, dickleibigen Buches beginnt man sich zu ärgern über diese immergleichen, banalen Beschreibungen und die unzählbaren, oft wortwörtlichen Wiederholungen. Erzählerische Arabesken mithin, die nicht kitschig, sondern einfach nur nervig sind. Da ist ein erstmaliger IS-Prozess vor dem Oberlandesgericht München mit einer grandiosen Urteilsbegründung geradezu ein Labsal für den frustrierten Leser. Schade eigentlich, aber literarisch nicht überzeugend!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
»Versuche ich zu schreiben, ist es als würde ich einzelne Stücke zusammen nähen. Schreibe ich über das Lachen meines Vaters, wenn er vom türkischen Gefängnis erzählt, schreibe ich über meinen Lachen, wenn eine Freundin mich fragt, wie die Situation …
Mehr
»Versuche ich zu schreiben, ist es als würde ich einzelne Stücke zusammen nähen. Schreibe ich über das Lachen meines Vaters, wenn er vom türkischen Gefängnis erzählt, schreibe ich über meinen Lachen, wenn eine Freundin mich fragt, wie die Situation für die Êzîden gerade sei, bringe ich das eine mit dem anderen in Verbindung... Ich trenne die Nähte wieder auf und fange von vorne an.«
|32f
»Vierundsiebzig« nimmt die Welt auf von einer Frau, der Protagonistin, des Autorin-Ichs, das voll ist von kurdisch-êzîdischen Geschichten, das sich kreist um den vierundsiebzigsten G3nozid an der êzîdischen Bevölkerung in Shingal.
Von einer Figur, die sich identifiziert mit ihrem êzîdischen Vater, seiner brüchigen Identität, in Abstand und Nähe, in einem êzîdischen Blick. Von einer Figur, die die Taten von IS-Angehörigen benennt und keine Nähe sucht zu Täter:innen, die sich doch beschäftigt mit der angeklagten Jennifer W., die ihren Blick wendet zu den Opfern wie Frau B. und Reda, erst 5. Von einer Figur, die reist, spricht, besucht, recherchiert, die sich ihr Verständnis, ihre Verständigung und ihr permanentes reflektieren des eigenen Dazwischenstehens erschreibt, in einem verdichteten Drang.
Von einer Autorin, Lyrikerin, Journalistin, Deutschen, Ězîdin, Denkerin und Kämpferin die einen hybriden Text erschafft, der fließt und immer wieder leise wird, verstummt, nach Worten sucht, dessen zentrales Moment die Sprachlosigkeit bleibt. Von einer Geschichte, die sich nicht klassisch aufbaut, die sich anreichert, Schicht um Schicht. Von einem Text, der fast überquillt, der einen repetetiven Rhythmus findet, mit wiederkehrenden Motiven und einem Kreisen, das untypisch ist für 500 Seiten. Von einem Langgedicht in Prosaform, einer journalistischen, dokumentarischen (Auto)Fiktion, einem innovativen Text, der Raum braucht und sich legen muss, der scheinbar das Wissen und den Verstand anspricht, sich jedoch tiefer zu verankert sucht.
.
Höre ich das Wort Êzîden, denke ich an Êzîden, denke ich an Ronya Othmann, denke ich an »Vierundsiebzig«, denke ich an Shingal, denke ich Reda, denke ich an Êzîden und das ist mehr, als eine Story, ein Kommentar, ein Artikel, ein Bericht, eine Reportage oder eine sachbuchartige Veröffentlichung zu erreichen vermag. Ich bin gespannt, ob es für den Deutschen Buchpreis eingereicht wird und wie weit es da kommen könnte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Worum geht es?
Um den Genozid an den Êzîden durch IS-Kämpfer im Jahr 2014.
Worum geht es wirklich?
Suche, Tod und Erinnerung.
Lesenswert?
Ja, auch wenn es (logischerweise) keine leichte Lektüre ist. In sehr unterschiedlich langen Kapiteln geht die Autorin auf die Suche …
Mehr
Worum geht es?
Um den Genozid an den Êzîden durch IS-Kämpfer im Jahr 2014.
Worum geht es wirklich?
Suche, Tod und Erinnerung.
Lesenswert?
Ja, auch wenn es (logischerweise) keine leichte Lektüre ist. In sehr unterschiedlich langen Kapiteln geht die Autorin auf die Suche nach Informationen über die Tat im Jahr 2014. Ich habe es so verstanden, dass die Ich-Erzählerin tatsächlich auch die Autorin selbst ist und sie von ihrer tatsächlichen Suche erzählt. Zu Beginn hat mich das jedoch etwas verwirrt, da ich mehr mit Fiktion gerechnet hatte - also nicht fiktiven Ereignissen, aber mit einer fiktiven erzählenden Person.
Ansonsten ist es aber sehr gut lesbar, nur die unterschiedlichen Kapitellängen machen eine Pause manchmal schwer - es gibt aber auch immer wieder Abschnittsmarken, bei denen das dann eher möglich ist.
Das Cover ist eher schlicht, der Titel verweist (wenn ich das richtig verstanden habe) darauf hin, dass der Genozid im August 2024 der 74. Genozid an den Êzîden war.
Ich habe generell leider eher wenig Kenntnisse über diese Bevölkerungsgruppe oder die Auseinandersetzungen, die im weitläufigen Bereich Kurdistans stattgefunden haben oder stattfinden. Für mich hatte das Buch daher einen sehr großen Lerneffekt, bzw. hat mich dazu animiert, nebenbei einige Dinge zu recherchieren oder mich mit Begriffen, die mir unbekannt in ihrer genauen Bedeutung sind, auseinanderzusetzen.
Mir wäre es glaube ich nicht möglich, dieses Buch einem Genre zuzuordnen, denn einerseits ist es ein Roman, dann ein Erlebnisbereich, ein Reisebericht, irgendwie auch ein Sachbuch.
Wenn man sich ein bisschen mehr für andere Länder und Kulturen interessiert oder vielleicht auch verstehen möchte, warum manche Länder kein sicheres Herkunftsland für jede geflohene Person sind, kann ich dieses Buch definitiv empfehlen. Es erzählt schonungslos, aber es schlachtet Gewalt definitiv nicht aus. Man muss nicht detaillierten Beschreibungen rechnen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ronya Othmann Vierundsiebzig
„Auch die Sprache ist eine Waffe“
„Ich kenne keine êzîdische Familie, in der nicht jemand umgebracht wurde.“
Ronya Othmann berichtet in ihrem Buch über den74. Genozid 2014 in Shingal, der an der êzîdischen …
Mehr
Ronya Othmann Vierundsiebzig
„Auch die Sprache ist eine Waffe“
„Ich kenne keine êzîdische Familie, in der nicht jemand umgebracht wurde.“
Ronya Othmann berichtet in ihrem Buch über den74. Genozid 2014 in Shingal, der an der êzîdischen Bevölkerung durch die IS-Kurden im Nord-Irak verübt wurde.
Die Autorin ist Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch êsîdischen Vaters.
2018 fliegt sie nach Kurdistan, in das Camp Ashti im Irak in der Nähe der iranischen Grenze.
Sie versucht eine Sprache zu finden, für das Geschehene an ihrem Volk, das eigentlich sprachlos macht.
„Die Sprachlosigkeit liegt noch unter der Sprache, selbst wenn ein Text da ist.“
„Ich schreibe: Ich habe gesehen. Das Ich ist ein Zeuge. Es spricht, und doch hat es keine Sprache.“
„Versuche ich zu schreiben, ist es, als würde ich einzelne Stücke zusammennähen.“
Ronja besucht das Dorf der Großeltern, in dem sie als Kind war, 2014 flieht die Großmutter aus Syrien nach Deutschland, sie ist traumatisiert.
Während ihrer Recherchen in Kurdistan, aber auch in Deutschland, erfährt Ronya von den grauenhaften Taten, die ihrem Volk angetan wurden.
Das Verbrechen in Shinghal ist nicht in Worte zu fassen, verschleppte und verkaufte Frauen und Kinder, Vergewaltigungen. grauenhafte Hinrichtungen.
Die Berichte von Augenzeugen sind kaum zu ertragen
Sie will die Motive der IS-Kämpfer verstehen, aber die Frage nach dem „warum“ kann nicht beantwortet werden. Sie besucht die Peschmerga-Einheiten in zerstörten Landschaften, Kämpferinnen gegen den IS, Frauen die selber Opfer waren.
Ronja sammelt die Geschichten der überlebenden Frauen, die vom IS verkauft und versklavt wurden.
Sie besucht Gerichtsprozesse in Deutschland, in denen die Menschen angeklagt werden, die Frauen und Kinder versklavt haben.
2022 reist sie abermals an die heiligen Orte der Esîden, sie ist auf der Suche nach ihren Wurzeln, ihrer Identität. Der kulturelle Genozid führt zum Aussterben des êzîdischen Volkes.
Die êzîdischen Regeln, z. B. nur untereinander zu heiraten werden in Deutschland aufgeweicht, auch sie selber stammt aus einer multikulturellen Ehe.
Die Sprachlosigkeit der Autorin, ihre Hoffnung, der Versuch, Distanz zu dem Geschehenen zu finden, werden deutlich: „Wenn der Text fertig ist, kann ich alles vergessen.“ Aber auch „Für diesen Text gibt es kein Ende“ und „Ich will das Ich aus meinem Text streichen.“
2023 erkennt der Deutsche Bundestag den Genozid an den Eziden an.
Dieses Buch ist sicher kein Roman, denn es gibt definitiv keine Fiktion, es ist eher ein autobiografisch geprägtes Sachbuch, eine Historie der Verfolgung, Vertreibung und Ermordung des êzîdischen Volkes, eine Reportage, ein Essay, eine Reisebeschreibung.
Einschließlich Glossar.
Die Informationen über das êzîdische Volk sind wichtig, wir wissen viel zu wenig über diese Kultur, die eigentlich nur mündlich überliefert wird. Das ist der große Verdienst der Autorin.
Ich hätte mir gern etwas mehr Struktur gewünscht, eine Bündelung der Informationen. Die Zerrissenheit der Autorin kommt allerdings genau dadurch zum Ausdruck, sie möchte „alles“, was sie herausgefunden hat, in die Welt weitertragen. Und das ICH stellt die Verbindung zwischen diesen vielen Textsorten her.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Hass und die Folgen
Was für ein Buch!
Ronya Othmann habe ich schon ihrem Buch „Die Sommer“ kennenlernen dürfen und dieses Kennenlernen habe ich sehr genossen. In „Vierundsiebzig“ übertrifft sie ihr „Die Sommer“ aber haushoch und vollkommen …
Mehr
Hass und die Folgen
Was für ein Buch!
Ronya Othmann habe ich schon ihrem Buch „Die Sommer“ kennenlernen dürfen und dieses Kennenlernen habe ich sehr genossen. In „Vierundsiebzig“ übertrifft sie ihr „Die Sommer“ aber haushoch und vollkommen überwältigend.
„Vierundsiebzig“. Schon der Titel ist eine Herausforderung. Vierundsiebzig. Was soll diese Zahl bedeuten? Der IS verübt 2014 in Shingal den vierundsiebzigsten Genozid an den Êzîden. Ein Volk, eine Glaubensgemeinschaft erlebt vierundsiebzig Genozide. Das macht was mit ihren Angehörigen. Wie man dem Buch von Ronya Othmann entnehmen kann.
Vierundsiebzig mal Horror, vierundsiebzig mal Tod und Zerstörung. Die Krankheit der Gier wütet wieder einmal. Und die Welt schaut zu.
Wie kann man darüber nachdenken Êzîden wieder in ihre Heimat zurückzuschicken, da dort ja jetzt Frieden herrscht? Die Täter des IS aber immer noch dort leben. Das verstehe ich nicht und frage mich, ob diese Menschen, die diese Ausweisungen beschließen, wissen, was sie tun und ich frage mich, ob sie ein Gewissen haben und sich selbst noch im Spiegel anschauen können. Können sie. Ich weiß. Menschenfeindliches und unempathisches Gedankengut ist nach wie vor viel bei uns zu finden. Ich weiß. Und es wird leider mehr. Gut geschürt von den Angstmachern.
Ronya Othmann hat in ihrem Buch „Vierundsiebzig“ ein extrem vielschichtiges Buch geschrieben, es trägt biographische Züge, es trägt historisches Wissen um die Êzîden, es trägt kulturelle Informationen zu den Êzîden, es wirft Blicke in die Politik der Türkei, in die Politik von Syrien und auch Blicke in die Politik vom Irak und vom Iran, es trägt historische Informationen zu den vier Staaten, es blickt auf die verschiedenen Genozide und es blickt auf den Umgang der Welt damit. „Vierundsiebzig“ ist ein Blick auf die Täter und die Opfer.
Es ist ein Buch der Gewalt, Gewalt, die den Êzîden angetan wurde. Gewalt, die schwer auszuhalten ist. Und genau wegen dieser Gewalt, dieser Unmenschlichkeit ist es wichtig dieses Buch geschrieben zu haben. Denn die Welt muss aufwachen!
Ebenso ist dieses Buch auch ein Reisebericht, denn Ronya Othmann bereist viele der êzîdischen Gebiete, blickt auf die Gewalt, blickt auf die Folgen, redet mit den Menschen, redet mit den Opfern, blickt auf das Grauen. Hut ab vor dem Mut und der Kraft dieser Autorin! Besonders in den Reisen blickt die Autorin auf die politischen Gebilde und zeigt eine Fragilität, eine lebensgefährliche Fragilität.
Muss es wirklich zur Fünfundsiebzig kommen? Oder kann man dies im Namen der Empathie und der Menschlichkeit verhindern?!?!
Unbedingt lesen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
2023 sorgte ein Prozess in München für großes öffentliches Aufsehen. Eine deutsche Islamistin wurde schuldig gesprochen, den Tod eines 5jährigen jesidischen Mädchens, mit ihrer Mutter verschleppt und versklavt, bewusst in Kauf genommen zu haben. Mit dem Prozess und dem …
Mehr
2023 sorgte ein Prozess in München für großes öffentliches Aufsehen. Eine deutsche Islamistin wurde schuldig gesprochen, den Tod eines 5jährigen jesidischen Mädchens, mit ihrer Mutter verschleppt und versklavt, bewusst in Kauf genommen zu haben. Mit dem Prozess und dem Schuldspruch rückte die grausame Verfolgung der Jesiden, einer kurdischen Minderheit, durch das IS-Kalifat in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit.
Die Autorin ist in Deutschland aufgewachsen als Tochter eines jesidischen Vaters, der aber ein sog. Abtrünniger ist, weil er sich aus den strengen, fast archaischen und reformfeindlichen Konventionen dieser Glaubensgemeinschaft gelöst hat. Die Identifikation mit dem Jesidentum ist der Autorin selber auch unerklärbar: „Ich bin es, und ich bin es nicht“, sagt sie.
Ein Fernsehbericht über den Genozid im August rüttelt sie auf. Sie recherchiert von Deutschland aus, und sie reist schließlich in die unruhigen kurdischen Grenzgebiete in Syrien, dem Irak und der Türkei. Sie trifft Flüchtlinge, sie besucht zerstörte Dörfer, Massengräber, Museen, sie fotografiert und dokumentiert minutiös auch kleinste Beobachtungen. Sie besucht aber auch die Rückkehrer, die nach dem Sieg der kurdischen Truppen auch den Jesiden die Rückkehr ermöglichten. Vor allem aber besucht sie die weitläufige Familie ihres Vaters, bei denen sie immer wieder als Kind ihre Sommerferien verbracht hat, und dokumentiert ihre Vertreibungsgeschichte. Mit ihren Erinnerungen ergänzt sie ihre Recherche-Ergebnisse. Hier macht sie jedoch eine Entdeckung, die aber nur kurz anklingt: Auch ihre Familie ist der Nutznießer eines anderen Genozids, von dem niemand mehr spricht, nämlich des Genozids an den Armeniern.
Das Buch bietet keine durchgängige Erzählung, sondern besteht eher aus Fragmenten, die die Autorin montiert. Mit diesen Fragmenten und der punktuellen Darstellung von Einzelschicksalen fügt sich der Leser ein Bild zusammen von den Grausamkeiten, denen die Jesiden unter der IS-Besatzung ausgesetzt waren. Zu Recht weist die Autorin darauf hin, dass der Schrecken noch nicht beendet ist und in syrischen Lagern noch viele verschleppte und versklavte Frauen vermutet werden.
Der Autorin ist das Problem der sprachlichen Gestaltung ihrer Fragmente sehr wohl bewusst. Sehr häufig überlegt sie, wie sie das Unfassbare beschreiben bzw. erzählen soll. Sie entscheidet sich für einen fragmentarischen, abgehackten Stil, mit vielen wortwörtlichen Wiederholungen, bei denen vor allem die in Endlosschleife wiederkehrenden Anaphern zunehmend meine Geduld strapazierten. Ebenso strapaziös fand ich die langwierigen Aufzählungen von Objekten, denen keine weitere Bedeutung zukam.
Interessanter fand ich dagegen ihre poetologischen Überlegungen. Die Autorin beobachtet sich selber und erkennt ihre steigende Identifizierung mit dem Jesidentum, um aber gleichzeitig wieder von dessen archaischen Konventionen (Ablehnung von Bildung, Schriftlichkeit und Selbstbestimmung, Kastenwesen etc.) abgeschreckt zu werden.
Das Buch ist ohne Zweifel wichtig. Als Roman hat es mich aber nicht überzeugt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für