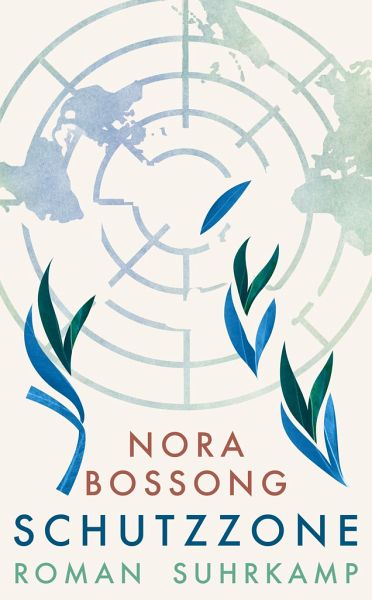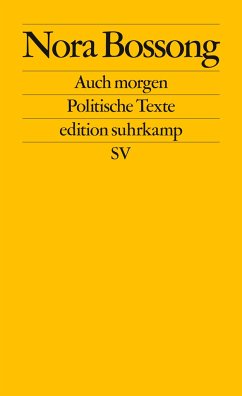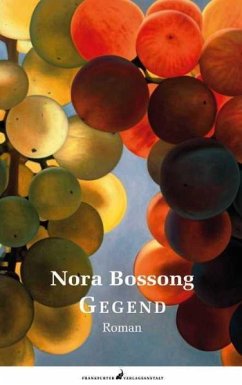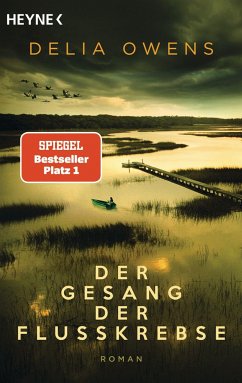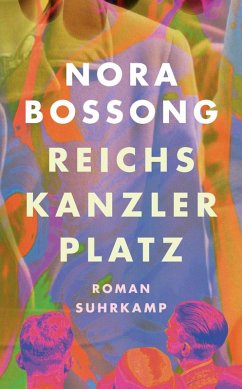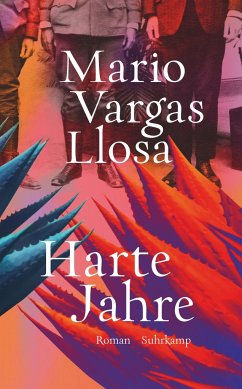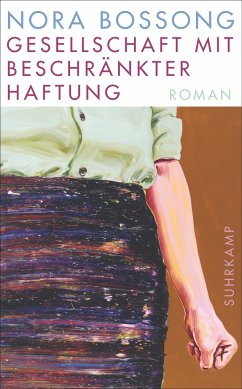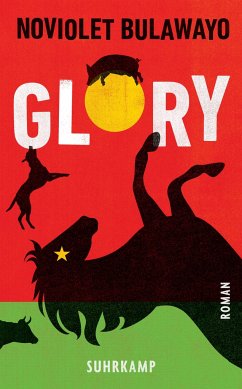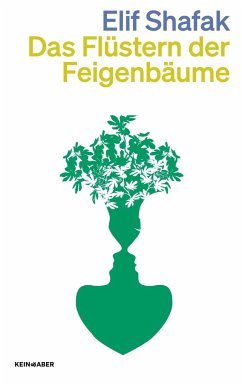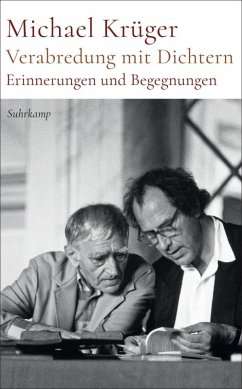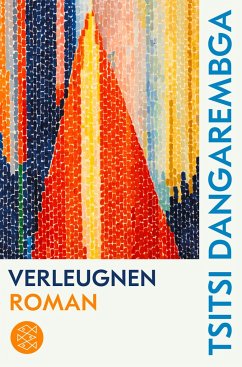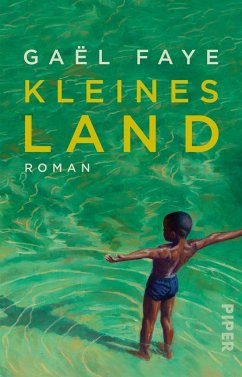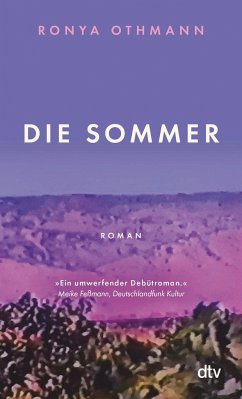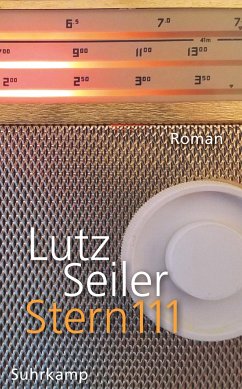Nora Bossong
Broschiertes Buch
Schutzzone
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Nach Stationen bei der UN in New York und Burundi arbeitet Mira für das Büro der Vereinten Nationen in Genf. Während sie tagsüber Berichte über Krisenregionen und Friedensmaßnahmen schreibt, eilt sie abends durch die Gänge der Luxushotels, um zwischen verfeindeten Staatsvertretern zu vermitteln. Als ihre Rolle bei der Aufarbeitung des Völkermords in Burundi hinterfragt wird, gerät Miras Glaube, sie könne von außen eingreifen, ohne selbst schuldig zu werden, ins Wanken.Was bedeuten Gerechtigkeit, Vertrauen und Verantwortung? Wie greifen Schutz und Herrschaft ineinander? Wie verhält ...
Nach Stationen bei der UN in New York und Burundi arbeitet Mira für das Büro der Vereinten Nationen in Genf. Während sie tagsüber Berichte über Krisenregionen und Friedensmaßnahmen schreibt, eilt sie abends durch die Gänge der Luxushotels, um zwischen verfeindeten Staatsvertretern zu vermitteln. Als ihre Rolle bei der Aufarbeitung des Völkermords in Burundi hinterfragt wird, gerät Miras Glaube, sie könne von außen eingreifen, ohne selbst schuldig zu werden, ins Wanken.
Was bedeuten Gerechtigkeit, Vertrauen und Verantwortung? Wie greifen Schutz und Herrschaft ineinander? Wie verhält sich Zeugenschaft zur Wahrheit? Und wer sitzt darüber zu Gericht? Hellsichtig und teilnahmsvoll geht Nora Bossong in ihrem virtuosen Roman diesen Fragen nach und setzt den Konflikten der Vergangenheit die Hoffnung auf Versöhnung entgegen.
Was bedeuten Gerechtigkeit, Vertrauen und Verantwortung? Wie greifen Schutz und Herrschaft ineinander? Wie verhält sich Zeugenschaft zur Wahrheit? Und wer sitzt darüber zu Gericht? Hellsichtig und teilnahmsvoll geht Nora Bossong in ihrem virtuosen Roman diesen Fragen nach und setzt den Konflikten der Vergangenheit die Hoffnung auf Versöhnung entgegen.
Nora Bossong, 1982 in Bremen geboren, schreibt Lyrik, Romane und Essays, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, zuletzt mit dem Joseph-Breitbach-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis. Nora Bossong lebt in Berlin.
Produktdetails
- suhrkamp taschenbuch 5114
- Verlag: Suhrkamp
- Artikelnr. des Verlages: ST 5114
- Seitenzahl: 327
- Erscheinungstermin: 13. Januar 2021
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 122mm x 27mm
- Gewicht: 306g
- ISBN-13: 9783518471142
- ISBN-10: 3518471147
- Artikelnr.: 59004024
Herstellerkennzeichnung
Suhrkamp Verlag
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
 buecher-magazin.de„Es sind die Grenzen, die Einteilungen, die uns beruhigen, die Aufteilung zwischen Schlafen und Wachsein, in Wahrheit und Lüge, in heimlich und legitim, und auch wenn diese Grenzen willkürlich gezogen werden, glauben wir ihnen doch.“ Dieser Roman ist ein einziger innerer Monolog, sprunghaft, schmerzvoll, desillusioniert. Mira arbeitet für die Vereinten Nationen, sie leitet in Genf Verhandlungen zum Zypernkonflikt. Durch ein Wiedersehen mit Milan, bei dessen Familie sie als Kind während der Trennung ihrer Eltern einige Monate wohnte, wandern ihre Gedanken auch immer wieder dorthin zurück. Und während sie in ihrer Affäre mit Milan Grenzen überschreitet, wird auch ihre Rolle bei der Aufarbeitung des Völkermordes in Burundi hinterfragt. Ihre innere und äußere Welt gerät ins Wanken, sie muss sich der Frage stellen, wer sie in allem ist. Wie Bossong die Grenzen zwischen persönlichen und politischen Beziehungen in Miras Gedankenwelt verschränkt und ineinandergreifen lässt, ist eine große Kunst. Es ist die assoziative und poetische Sprache, die diesen hypnotischen Sog erzeugt, der den zutiefst menschlichen Bürokratiesumpf hinter der großen Bühne der Weltfriedenspolitik ergründet.
buecher-magazin.de„Es sind die Grenzen, die Einteilungen, die uns beruhigen, die Aufteilung zwischen Schlafen und Wachsein, in Wahrheit und Lüge, in heimlich und legitim, und auch wenn diese Grenzen willkürlich gezogen werden, glauben wir ihnen doch.“ Dieser Roman ist ein einziger innerer Monolog, sprunghaft, schmerzvoll, desillusioniert. Mira arbeitet für die Vereinten Nationen, sie leitet in Genf Verhandlungen zum Zypernkonflikt. Durch ein Wiedersehen mit Milan, bei dessen Familie sie als Kind während der Trennung ihrer Eltern einige Monate wohnte, wandern ihre Gedanken auch immer wieder dorthin zurück. Und während sie in ihrer Affäre mit Milan Grenzen überschreitet, wird auch ihre Rolle bei der Aufarbeitung des Völkermordes in Burundi hinterfragt. Ihre innere und äußere Welt gerät ins Wanken, sie muss sich der Frage stellen, wer sie in allem ist. Wie Bossong die Grenzen zwischen persönlichen und politischen Beziehungen in Miras Gedankenwelt verschränkt und ineinandergreifen lässt, ist eine große Kunst. Es ist die assoziative und poetische Sprache, die diesen hypnotischen Sog erzeugt, der den zutiefst menschlichen Bürokratiesumpf hinter der großen Bühne der Weltfriedenspolitik ergründet.Bossong sprengt sprachgewaltig die Schutzzone zwischen persönlichen und politischen Grenzüberschreitungen.
© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)
»Man kann die Beweglichkeit nur bewundern, mit der Nora Bossong ihr Thema ausfaltet, den Sinn für das bezeichnende Detail und die schlanken Pointen, mit der sie die innere Welt ihrer Heldin gegen alle Zumutungen der Globalität abfedert.« Thomas Thiel Frankfurter Allgemeine Zeitung 20191024
Gebundenes Buch
Mira arbeitet für die Vereinten Nationen. Zunächst war sie in New York und Burundi, nun ist sie in Genf. Sie will zwischen verfeindeten Staatsvertretern vermitteln, während sie doch weiß, wie die Realität aussieht. Dann begegnet sie Milan auf einem Empfang. Sie hatte einmal …
Mehr
Mira arbeitet für die Vereinten Nationen. Zunächst war sie in New York und Burundi, nun ist sie in Genf. Sie will zwischen verfeindeten Staatsvertretern vermitteln, während sie doch weiß, wie die Realität aussieht. Dann begegnet sie Milan auf einem Empfang. Sie hatte einmal in seiner Familie für einige Zeit gelebt. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, obwohl Milan es ihr nicht leicht macht. Dann wird auch noch ihre Rolle in Burundi hinterfragt. Mira ist verunsichert.
Obwohl das Buch wichtige Themen aufgreift, konnte mich dieser Roman doch nicht packen. Daher habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich mit dem Buch durch war. Auch sprachlich hat mich das Buch nicht wirklich überzeugt.
Mira ist eine Person, die ich nur schwer fassen kann. Sie hat zwar Karriere bei der UN gemacht, agiert geschickt als Vermittlerin, dennoch weiß ich nicht, ob sie von ihrer Tätigkeit wirklich überzeugt war. Nachdem ihre Burundi-Mission hinterfragt wird, zweifelt sie an sich selbst. Sie ist nicht überzeugt, von dem, was sie mit ihrer Tätigkeit erreichen kann. Vermittlung bedeutet auch, Kompromisse schließen zu müssen. Auch ihre Begegnung mit Milan gibt ihr keinen Halt, denn auch er hat Zweifel. Darüber hinaus ist er verheiratet und Vater eines Sohnes und er wird mit der Familie nach Den Haag gehen.
Das Buch stimmt zwar nachdenklich und hat damit vielleicht seinen Zweck erfüllt, aber es konnte mich nicht wirklich packen und hat auch keinen großartigen Eindruck hinterlassen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Einsames Nilpferd
Lobhudelei beim Feuilleton und überwiegende Ablehnung bei den Leserkritiken kennzeichnen den Roman «Schutzzone» von Nora Bossong, der 2019 immerhin für den Frankfurter Buchpreis nominiert wurde. Schon mit dem Titel, mehr noch mit dem treffend gewählten …
Mehr
Einsames Nilpferd
Lobhudelei beim Feuilleton und überwiegende Ablehnung bei den Leserkritiken kennzeichnen den Roman «Schutzzone» von Nora Bossong, der 2019 immerhin für den Frankfurter Buchpreis nominiert wurde. Schon mit dem Titel, mehr noch mit dem treffend gewählten Titelbild, wird auf die Vereinten Nationen hingewiesen, und damit auf eine literarisch noch wenig erschlossene Thematik. Was denn wohl auch das große Interesse an diesem Buch erklärt, erzählende Literatur kann ja auf unterhaltende Art durchaus auch Horizonte erweitern. Erfüllt dieser Roman denn derartige Erwartungen?
Durch einen Zufall lernt Ich-Erzählerin Mira in New York einen UNO-Mitarbeiter kennen, der sie spontan als seine Assistentin engagiert. Schon bald wird sie mit anspruchsvolleren Aufgaben betraut, weil sie insbesondere die Gabe besitzt, zuhören zu können, was sie als Gesprächs-Partnerin für diffizile diplomatische Verhandlungen besonders auszeichnet. Fortan pendelt sie, mit den verschiedensten Aufträgen betraut, zwischen New York, Genf, Den Haag und Bujumbura in Burundi hin und her. Ausgehend vom Jahr 2017 erzählt die Autorin in ständig wechselnden Rückblenden bis ins Jahr 2003 von ihrer Arbeit in verschiedenen Krisenregionen, bis 1994 zurückreichend auch ein wenig aus ihrer freudlosen Kindheit. Damals wohnte sie nach der Trennung ihrer Eltern als junges Mädchen einige Monate bei guten Freunden ihrer Mutter in der Nähe von Bonn. Deren acht Jahre älteren Sohn Milan trifft sie dann später bei der UNO wieder. Zwischen ihr und dem inzwischen verheirateten Mann entwickelt sich eine von vornherein zum Scheitern verurteilte, kurze Liaison. Beruflich ist sie unter anderem in diplomatischer Mission im Zypernkonflikt engagiert, später aber auch in Burundi, wo sie sogar in Kontakt zu einem mächtigen Warlord kommt, der sie privat empfängt und ihr die Situation im Lande sehr drastisch aus seiner Sicht schildert. Durch diese enge Nähe zum Terror verstrickt sie sich in eine gewisse Mitschuld bei der unzureichenden Aufarbeitung des Genozids in diesem ärmsten Staat der Welt.
Mit hehren Kapitelüberschriften wie Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung und Übergang erzählt Nora Bossong von der Erfolglosigkeit der UNO, der sie das private Scheitern ihrer Protagonistin gegenüberstellt. Dabei begnügt sie sich auf das reine Beschreiben, sie schildert, was ist, ohne moralisierend Verlorenheit, Unvermögen und Machtgier in einem politischen Ränkespiel anzuprangern, das sie an einer Stelle als «politische Balztänze» bezeichnet. Köstlich ist das Nilpferd-Spiel, mit dem sie die Anarchie der verkrusteten UNO-Bürokratie eindrucksvoll entlarvt. Dabei schleusen Mitarbeiter in ihre offiziellen Berichte das völlig unsinnige Wort «Nilpferd» ein, das mit dem Vorgang selbst nicht das Geringste zu tun hat. Gewinner ist derjenige, dessen Ausarbeitung unbeanstandet durch alle Instanzen bis in die Hände des höchsten Vorgesetzten gelangt. Ein starkes Bild für die Inkompetenz dieser ohnmächtigen Mega-Bürokratie!
In einem einzigen inneren Monolog wird hier sachlich und nüchtern vom diplomatischen und persönlichen Scheitern erzählt, wobei ein in langen Sätzen artikulierter, elegischer Tonfall für eine äußerst depressive Stimmung sorgt. Die wenigen Figuren treten kaum in Dialoge miteinander, sie bleiben als Charaktere farblos, geradezu unnahbar, sie wirken fast schon wie Untote. Man erfährt wenig über sie und schon gar nichts, was sie sympathisch erscheinen lassen könnte, das pralle Leben also wird hier total ausgeblendet. Ebenso uneindeutig ist auch die Auseinandersetzung mit der Thematik selbst, weder die weltpolitische Organisation als solche noch die ethischen Fragen in den ständig neu aufbrechenden Konfliktherden werden hinterfragt. Letztlich bleibt von diesem handlungslosen Roman, dessen fast unsichtbare Heldin immer wieder nur sinnierend aus dem Fenster schaut, lediglich maßlose Langeweile zurück, ohne Bereicherung in der Sache, - sieht man mal von dem einsamen Nilpferd ab
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman Schutzzone von Notra Bossong ist ein interessantes und vielschichtiges Buch mit heiklen Themen. Es ist in meinen Augen ein gesellschaftspolitisches Buch.
Hauptfiguren sind die für die UNO arbeitende Mira, ihr verheirateter Freund Milan und …
Mehr
Der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman Schutzzone von Notra Bossong ist ein interessantes und vielschichtiges Buch mit heiklen Themen. Es ist in meinen Augen ein gesellschaftspolitisches Buch.
Hauptfiguren sind die für die UNO arbeitende Mira, ihr verheirateter Freund Milan und der afrikanische Rebellenführer Aimé.
Die Figuren werden einigermaßen zurückhaltend charakterisiert, daher findet man vielleicht nicht sofort Zugang zu ihnen, aber das wird mit der Zeit.
Erzählt wird in rasch wechselnden Zeitabschnitten (1994, 2017, 2011, 2012) an verschiedenen Orten (Genf, Bonn, Bujumbura, New York). das kann leicht verwirrend sein und man muss sorgfältig lesen, damit sich mehr erschließt. Ich habe streckenweise ganze Abschnitte zweimal gelesen.
Der Roman verträgt kein schnelles, flüchtiges Lesen.
Nora Bossong ist auch Lyrikerin und auch in ihrer Prosa gibt es einige hervorragende Formulierungen, die literarische Qualität besitzen und für Leser, die Feinheiten mögen, einiges bieten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der goldene Käfig
Die Ich-Erzählerin Mira arbeitet für die UN in Genf. Sie will Frieden in Zypern vermitteln. Vorher hat sie in den 90er Jahren eine Friedensmission in Ruanda begleitet.
Petra Morsbachs hat in ihrem Roman "Justizpalast" vom Leben einer Richterin …
Mehr
Der goldene Käfig
Die Ich-Erzählerin Mira arbeitet für die UN in Genf. Sie will Frieden in Zypern vermitteln. Vorher hat sie in den 90er Jahren eine Friedensmission in Ruanda begleitet.
Petra Morsbachs hat in ihrem Roman "Justizpalast" vom Leben einer Richterin erzählt, auch mit ihren privaten Liebesgeschichten. Ihr ist es gelungen, Nora Bossong nicht.
Der Hauptgrund für das Scheitern dieses Buches liegt nicht an den Bandwurmsätzen, sondern an der Überforderung des Lesens. Wenn eine UN-Mitarbeiterin beruflich von einem Ort zum andern wechselt, dann wäre eine chronologische Handlungsabfolge unbedingt notwendig gewesen, was Wedma schon schreibt. UN-Geschichte, wie deren Gründung, das Scheitern des Völkerbunds außer bei den Aland-Inseln hätten in Rückblenden erzählt werden können.
Der Leser weiß gar nicht, wann Mira bei der UN anfing. Noch schwerer wiegt, dass die Liebesgeschichte mit Milan, oder sollte man besser von Beziehung reden, langweilt, was aber eben auch an der fehlenden Chronologie liegt. Und warum wird die wörtliche Rede nicht markiert?
Dennoch hat der Roman auch Stärken, etwa die Rolle der UN in Afrika, die Beschreibung eines Völkermords, der anfangs so nicht genannt werden darf.
Die UN-Mitarbeiter bezeichnen sich als Expats , weil sie „ex patria“ keine Heimat haben. Sie leben wie Flüchtlinge, sind aber deutlich reicher. Sie suchen im Privaten nach festen Beziehungen und leiden weit mehr, wenn die Beziehung zerbricht.
Besonders gefallen hat mir das Nilpferdspiel. Die Expats schreiben in ihren Berichten Dinge, die eigentlich nichts mit dem Geschehen zu tun haben und hoffen, dass dieses Nilpferd in möglichst vielen Ebenen nicht aus dem Bericht gestrichen wird. Ein schönes Beispiel hat mir leider gefehlt, wenn man von den Nilpferden beim Völkermord in Ruanda absieht.
Ich wollte ja nur 2 Sterne vergeben, da das Buch Seiten hat, die man raus reißen sollte. Aber angesichts der aufgezählten positiven Punkte und weil Weihnachten naht, gebe ich 3 Sterne.
Zitat: „Es sind nicht die Augen [..] oder die Seelen oder die Zugehörigkeiten, es ist der Krieg, der Mörder macht. (256)
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Im Büro der Vereinten Nationen in Genf hat Mira viel zu tun, aktuell laufen die Vorverhandlungen für den Friedensprozess auf Zypern. Auf einem Empfang trifft sie Milan wieder, bei dessen Familie sie als Kind einige Monate lebte und dessen Vater von einem Krisenherd zum nächsten flog …
Mehr
Im Büro der Vereinten Nationen in Genf hat Mira viel zu tun, aktuell laufen die Vorverhandlungen für den Friedensprozess auf Zypern. Auf einem Empfang trifft sie Milan wieder, bei dessen Familie sie als Kind einige Monate lebte und dessen Vater von einem Krisenherd zum nächsten flog und dessen Familie ihr die Welt der großen Politik öffnete. Auch Mira verfällt dem Glauben, etwas in der Welt bewegen, Frieden stiften und Unrecht ahnden zu können. Doch je mehr Katastrophen sie in Augenschein nimmt, desto mehr schwindet dieser Glaube und ihr Wirken und das der NGOs wird hinterfragt. Dient sie nur einem Selbstzweck, dem Erhalt der Organisation? Zugleich muss sie sich dann der Frage stellen, welchen Sinn sie in ihrer Lebensführung sieht und vor allem: was Milan ihr eigentlich bedeutet.
„und manchmal, nur manchmal, überkommt mich die Angst, das falsche Leben zu leben, als würde es das richtige irgendwo geben, aber man berührt immer nur den Ersatz, die Fälschung“
Nora Bossongs Roman, nominiert auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2019, verknüpft geschickt unterschiedliche Themen, die ihre Protagonistin beschäftigen: die große Frage nach dem Sinn des Lebens, als junge Frau der Widerspruch zwischen Karriere und Familie und vor allem die große Politik und die Sinnhaftigkeit oder Sinnfreiheit der Friedensmissionen und wie diese vor Ort an den Plätzen unglaublicher Grausamkeiten wahrgenommen werden. Hinter allem lauert aber noch die ganz große Frage, was denn eigentlich wahr ist, wer darüber die Deutungshoheit besitzt und ob es nicht zugleich mehrere Wahrheiten geben kann. Das ist eine ganze Menge und keiner dieser Einzelaspekte ist literarisch einfach und überzeugend umzusetzen. Der Autorin gelingt es aber, diese in einer einzigen Geschichte glaubwürdig motiviert und sprachlich wie dramaturgisch überzeugend zusammenzuführen.
Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, so viel Bemerkenswertes und Erwähnenswertes bietet der Roman. Die Erzählung auf zwei Zeitebenen – Miras Erfahrungen in den unterschiedlichen Krisenregionen einerseits, das Wiedersehen mit Milan während der Genfer Zypernverhandlungen andererseits – erlaubt die zwei großen Handlungsstränge parallel entwickeln zu lassen. Die junge Frau, die mit großen Erwartungen an die Arbeit bei der UNO geht und im Laufe der Zeit einen kritischen Blick für ihr Wirken entwickelt und am Ende sogar fast kapituliert, entwickelt sich parallel zu jener Frau, die in dem Kindheitsfreund plötzlich mehr zu sehen scheint als nur einen alten Vertrauten. Unsicherheit zu Beginn, wohin soll das führen, dann scheint es Möglichkeiten zu geben, Hoffnungen erwachsen, aber die Rechnung war zu einfach, hat wesentliche Faktoren übersehen.
Auch wenn es ein ernüchterndes Fazit ist, das die Protagonistin zieht, so waren doch die Kapitel um den Genozid in Ruanda und die Verantwortung der Weltöffentlichkeit für mich die mit Abstand stärksten. Der Kolonialherrenhabitus, der nie wirklich abgelegt wird, das systematische Wegschauen, weil’s bequemer ist, die Lebenswelt der Lokalbevölkerung, die den Helfern nie wirklich zugänglich ist und überhaupt die Blase, die diese um sich herum bauen und die die Illusion trägt, dass ihre Arbeit richtig und wichtig wäre und einen Beitrag zur Gerechtigkeit leisten könnte, werden plausibel und überzeugend durch die Handlung verdeutlicht ohne so eine mahnende oder gar besserwisserische Stimme zu benötigen.
Nora Bossong entlarvt geschickt Ambivalenzen sowohl auf moralischer wie politischer Ebene und hinterfragt große Begriffe, mit denen sie Ihre Kapitel überschreibt: Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung. Ein Roman, der bisweilen unter die Haut geht und sich nachdrücklich einbrennt. Für mich der heißeste Kandidat auf den Gewinn des Buchpreises in diesem Jahr.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Dieses Werk halte ich für herzlich wenig lesenswert, kurz gesagt: „Möchte-viel-kann-leider-herzlich-wenig“ passt prima dazu.
Schon allein die Schreibe weist erhebliche stilistische Probleme auf. Die Bandwurmsätze, die nicht allzu selten vorkommen, rauben jede Lust am …
Mehr
Dieses Werk halte ich für herzlich wenig lesenswert, kurz gesagt: „Möchte-viel-kann-leider-herzlich-wenig“ passt prima dazu.
Schon allein die Schreibe weist erhebliche stilistische Probleme auf. Die Bandwurmsätze, die nicht allzu selten vorkommen, rauben jede Lust am Weiterlesen. Die ständigen Zeitenwechsel desorientieren den Leser völlig. Folge: Ich war nicht müde, das Buch aus der Hand zu legen.
Und aufgebauscht wird das Minimum von der Substanz bis zum geht nicht mehr. „Viel heiße Luft“, „Schaumschlägerei mit wenig dahinter“ lauten meine nicht seltenen Kommentare auf den Seiten. Kaum gibt es paar klare Worte über den desolaten Zustand der Welt, schon wird die Aussage ins politisch Korrekte gekippt.
All die exotisch klingenden Orte, die jungen Leute aus dem Westen, die sich einbilden, etwas in der Lage zu verstehen und in Afrika etwas Gutes zu tun, und sich deshalb vor eigenen Wichtigkeit vor einander aufplustern, nervten zunehmend. Beim näheren Hinsehen offenbarten sich ihre naiven Träumereien als Chimären, was auch ihnen selbst nach paar Jahren dieses Show-Offs klar wurde, weshalb sie in Zynismus zu verfielen. Dies lässt sich auch über die Beziehung Miras zum verheirateten Familienvater Milan, den sie seit ihren Kindertagen kennt, sagen.
Die ständigen Sprünge in der Zeit rauben mir den letzten Nerv. Mal ist man im Jahr 1994, in dem die Bilder der unglücklichen Kindheit Miras geschildert wurden. Gleich im nächsten Kapitel ist man im Jahr 2017, dann ist man in der Zeit dazwischen, so ging das immer fort, sodass sich der rote Faden mühsam bis gar nicht entdecken ließ, und mich fragen musste, was das bitte soll. Zudem erforderte diese Art zu erzählen viel Aufmerksamkeit, die ich bald nicht mehr bereit war, auf so etwas zu verschwenden.
Es ist einfach zu viel des Herumposierens. Vieles ist bloß angerissen und gleich fallengelassen.
Leider entstand bei mir der Eindruck: Man versucht viel, kann aber wenig, und vor lauter Angeberei findet den eigenen Schwerpunkt nicht.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für