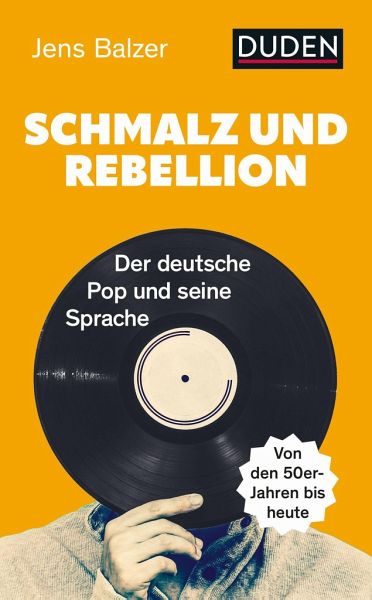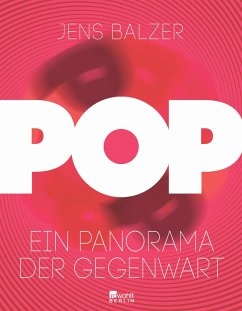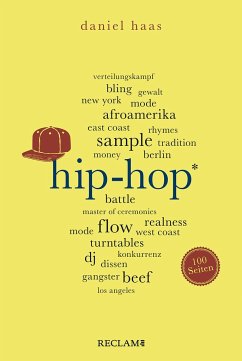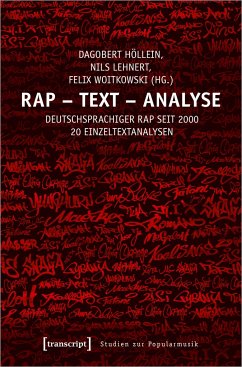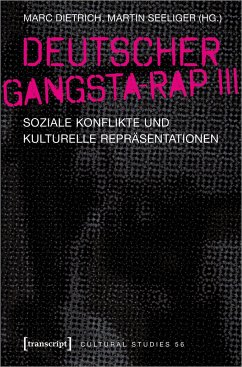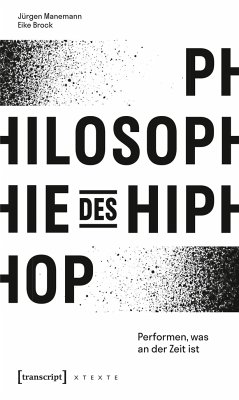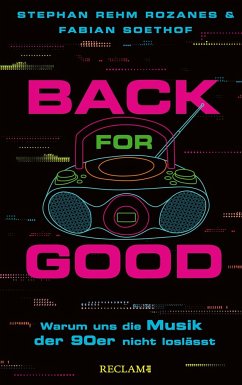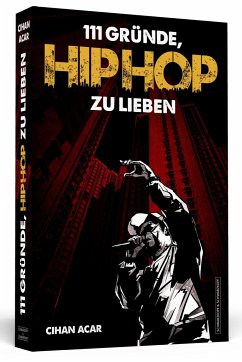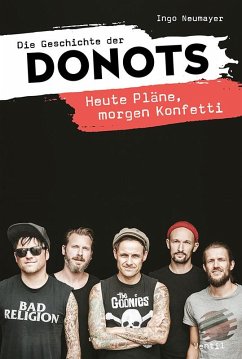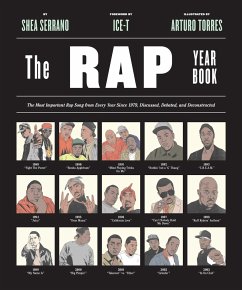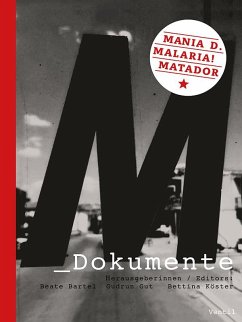PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Über Sex kann man nur auf Englisch singen? So hieß es jedenfalls einst bei Tocotronic. Jens Balzer beleuchtet das spannungsreiche Verhältnis von Popmusik und deutscher Sprache: Die ersten Rockbands singen natürlich auf Englisch, als Rebellion gegen die spießigen Eltern. Politische Liedermacher entdecken Mundarten und Dialekte. In der Neuen Deutschen Welle wird das Spiel mit der Sprache ironisch und kunstvoll. Im Hip-Hop der Gegenwart zeigt sich, wie divers, vielstimmig und auch widersprüchlich die Gesellschaft geworden ist. So entsteht eine Geschichte der Sprache im deutschen Pop - und w...
Über Sex kann man nur auf Englisch singen? So hieß es jedenfalls einst bei Tocotronic. Jens Balzer beleuchtet das spannungsreiche Verhältnis von Popmusik und deutscher Sprache: Die ersten Rockbands singen natürlich auf Englisch, als Rebellion gegen die spießigen Eltern. Politische Liedermacher entdecken Mundarten und Dialekte. In der Neuen Deutschen Welle wird das Spiel mit der Sprache ironisch und kunstvoll. Im Hip-Hop der Gegenwart zeigt sich, wie divers, vielstimmig und auch widersprüchlich die Gesellschaft geworden ist. So entsteht eine Geschichte der Sprache im deutschen Pop - und wie nebenbei eine Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Vor allem aber gibt es viele erstaunliche, oft bizarre, manchmal unglaubliche Songtexte (wieder-)zuentdecken.
Jens Balzer, geboren 1969, ist Autor und Kulturjounalist für ZEIT, Rolling Stone und radioeins. Gemeinsam mit Tobi Müller kuratiert er den Popsalon am Deutschen Theater Berlin. Seine jüngsten Bücher sind: 'Pop. Ein Panorama der Gegenwart' (2016), 'Pop und Populismus. Über Verantwortung in der Musik' (2019), 'Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er' (2019) sowie 'High Energy. Die Achtziger - das pulsierende Jahrzehnt' (Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste im August 2021).
Produktdetails
- Duden - Sachbuch
- Verlag: Duden / Duden / Bibliographisches Institut
- Artikelnr. des Verlages: 8527
- Seitenzahl: 223
- Erscheinungstermin: 16. Mai 2022
- Deutsch
- Abmessung: 207mm x 133mm x 25mm
- Gewicht: 391g
- ISBN-13: 9783411756698
- ISBN-10: 3411756691
- Artikelnr.: 62763672
Herstellerkennzeichnung
Bibliograph. Instit. GmbH
Mecklenburgische Straße 53
14197 Berlin
info@cvk.de
" Es ist ein faszinierendes Panorama, klug geordnet und voll überraschender Einsichten." Der SPIEGEL Der Spiegel Der SPIEGEL
Unterhaltsamer Überblick über 70 Jahre Sprache in der deutschen Popmusik
Aus dem Verlagstext: Jens Balzer beleuchtet das spannungsreiche Verhältnis von Popmusik und deutscher Sprache: Die ersten Rockbands singen natürlich auf Englisch, als Rebellion gegen die spießigen …
Mehr
Unterhaltsamer Überblick über 70 Jahre Sprache in der deutschen Popmusik
Aus dem Verlagstext: Jens Balzer beleuchtet das spannungsreiche Verhältnis von Popmusik und deutscher Sprache: Die ersten Rockbands singen natürlich auf Englisch, als Rebellion gegen die spießigen Eltern. Politische Liedermacher entdecken Mundarten und Dialekte. In der Neuen Deutschen Welle wird das Spiel mit der Sprache ironisch und kunstvoll. Im Hip-Hop der Gegenwart zeigt sich, wie divers, vielstimmig und auch widersprüchlich die Gesellschaft geworden ist. So entsteht eine Geschichte der Sprache im deutschen Pop – und wie nebenbei eine Gesellschafts- und Kulturgeschichte.
Das Cover mit seinem Orange zieht die Aufmerksamkeit auf sich und die abgebildete Schallplatte bietet eine haptische Überraschung, die Rillen sind fühlbar!
Jens Balzer, geboren 1969, ist erfolgreicher Autor und Kulturjournalist für ZEIT, Rolling Stone und radioeins und hat bereits mehrere Bücher über verschiedene Aspekte des Pop geschrieben.
In Schmalz und Rebellion präsentiert er in Zusammenarbeit mit dem Duden-Verlag die Entwicklung der Sprache der Popmusik unterhaltsam, mit vielen Textbeispielen und betrachtet die Sprache im Kontext des Zeitgeschehen.
Von Caterina Valente, Freddy Quinn und Peter Kraus über Beat, Krautrock und Ton Steine Scherben bis Rammstein und Helene Fischer spannt Jens Balzer einen weiten Bogen über Jahrzehnte der deutschen Popmusik. Zur Sprache kommt auch Musik abseits des Mainstream: türkische „Gastarbeiter“-Musik, Lieder auf plattdeutsch und die Geschichte des Punk in der DDR haben mir Überraschendes und Neues nahe gebracht.
Eine Playlist und informative Anhänge wie auch eine Liste von Literatur zum Weiterlesen vervollständigen dieses äußerst unterhaltsame und interessante Buch, das ich mit Vergnügen gelesen habe und gern jedem Leser empfehle, der sich nicht nur für Musikgeschichte, sondern auch für Sprache interessiert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Jens Balzer ist Autor und Kolumnist, unter anderem für die ZEIT, Rolling Stone und den Deutschlandfunk, Sprache ist sein Werkzeug und seit langem ist Pop sein Thema. Nun hat der Duden-Verlag seine äußerst unterhaltsame Betrachtung zur Sprachgeschichte der deutschen Pop-Musik …
Mehr
Jens Balzer ist Autor und Kolumnist, unter anderem für die ZEIT, Rolling Stone und den Deutschlandfunk, Sprache ist sein Werkzeug und seit langem ist Pop sein Thema. Nun hat der Duden-Verlag seine äußerst unterhaltsame Betrachtung zur Sprachgeschichte der deutschen Pop-Musik veröffentlicht.
Balzer rauscht auf gut 200 Seiten durch gut 70 Jahre, vom kitschig-exotischen Fernweh-Schlager der Nachkriegszeit über den Krautrock der 1970er bis hin zu aktuellem Rap, Elektropop oder dem Revival des Shanties. Gekonnt zeigt er auf, welche Entwicklungen in der Musik sich durch gesellschaftliche und kulturelle Besonderheiten erklären lassen. Nicht jeder seiner Thesen stimme ich dabei zu, aber interessant sind sie allemal.
Ich habe viel Unbekanntes entdeckt; als Kind der 1960er in Bayern sind sowohl die Musik der DDR als auch norddeutsche Shantys bislang fast spurlos an mir vorübergegangen. Krautrock war mir zwar ein Begriff, nicht aber dessen große internationale Wahrnehmung.
Natürlich muss bei einem so schmalen Buch, das mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte behandelt eine strikte Auswahl getroffen werden, unweigerlich werden wichtige Künstler fehlen. Doch ist Balzers Zusammenstellung in manchen Kaptiteln sehr subjektiv und für mich nicht immer nachvollziehbar. Ausgerechnet die gecastete Hip-Hop-Girl-Group Tic Tac Toe hat es zum Beispiel ins Buch geschafft, während Sabrina Setlur oder Nina (MC) unerwähnt bleiben.
Ein großes Plus bietet dafür die Spotify-Playlist, die der Autor aus einigen im Buch erwähnten Songs zusammengestellt hat. So kann man parallel zur Lektüre auch noch akustisch in die jeweilige Zeit eintauchen.
Meine Empfehlung für alle, die Pop nicht nur gerne hören, sondern sich darüber hinaus auch mit den Texten und Entwicklungen auseinander setzen wollen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Kein musikgeschichtliches Kompendium, sondern kurzweiliger, feinsezierender, zitatereicher Abriss popkultureller Einflüsse und Relevanzen.
Von süßlicher Fernwehschlagerverklärtheit bis aggressiver Identitätsbekundung
"Yeah, yeah, yeah."
Jens Balzer belegt …
Mehr
Kein musikgeschichtliches Kompendium, sondern kurzweiliger, feinsezierender, zitatereicher Abriss popkultureller Einflüsse und Relevanzen.
Von süßlicher Fernwehschlagerverklärtheit bis aggressiver Identitätsbekundung
"Yeah, yeah, yeah."
Jens Balzer belegt anhand zahlreicher Beispiele und Liedzitate Einfluss und Entwicklung der deutschen Musikkultur zwischen züchtiger, romantisch-verbrämter Nachkriegsschlagervergessenheit und hypermännlicher, vor Aggression strotzender Identitätssuche. Das ist ebenso unterhaltsam zu lesen, wie erkenntnisreich, denn er konzentriert sich - anders als der Buchtitel vermuten lässt - nicht auf tatsächlich einer breiten Gesellschaft bekannte "musikalische Zeugnisse", sondern räumt insbesondere der eher unbekannten "Untergrundkultur" Platz ein.
Obwohl mir im gesamten Text etwas zu oft das Wort "reüssieren" (vielleicht gibt es aber auch einfach kein gutes Äquivalent dazu) vorkam, fand ich ihn (obwohl mir viele Bands/Künstler:innen nicht mal namentlich ein Begriff waren) interessant und einen großen Bogen über 50 Jahre Musikgeschichte spannend.
Der Autor wird an keiner Stelle hämisch oder überlegen, sondern begibt sich mit feiner Ironie und ausgeprägtem Hintergrundwissen auf die Suche nach relevanten Strömungen, liefert gut erklärte Zusammenhänge und zeichnet nebenbei das Bild einer sich entwickelnden Gesellschaft, deren Wertesystem sich einerseits stark an einem tradierten Rollenverständnis orientiert und von diesem geprägt ist, andererseits aber mit (kultureller) Aneignung spielt und somit diverser wird.
Besonders imponiert haben mir Wortwitz und die messerscharfe Treffsicherheit Balzers, mit ein, zwei Begrifflichkeiten genau das Störgefühl zu benennen, das ich beim "Rezipieren" bestimmter Texte habe, aber nicht so recht fokussieren kann.
Jens Balzer lässt mit diesem schmalen Buch sprachliche und kulturelle Entwicklung anhand ausgewählter Songtextzitate greifbar werden und überrascht mit Beispielen, die vielen Leser:innen unbekannt sein dürften.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die deutsche Musik hatte schon immer eine zwiegespaltene Haltung zu "ihrer" Sprache. Wie sie sich seit den späten 40ern verändert und an einigen Stellen gerade nicht verändert hat, wird mit diesem Spaziergang durch die Jahrzehnte deutschsprachiger Popmusik …
Mehr
Die deutsche Musik hatte schon immer eine zwiegespaltene Haltung zu "ihrer" Sprache. Wie sie sich seit den späten 40ern verändert und an einigen Stellen gerade nicht verändert hat, wird mit diesem Spaziergang durch die Jahrzehnte deutschsprachiger Popmusik beleuchtet.
Dabei wird auch auf die historischen und kulturellen Hintergründe eingegangen und es werden zum Beispiel das Lebensgefühl der Nachkriegszeit oder der DDR so verständlich beschrieben, sodass auch jüngeren Menschen die Verbindungen zur Musik klar werden.
Es werden allerdings nicht nur die Radiohits erwähnt, die jede Person, die zu der Zeit gelebt hat, kennt, sondern auch Musik abseits vom Mainstream, zum Beispiel in migrantischen Communities. Dadurch wird der Inhalt dem Untertitel des Buches, "Der deutsche Pop und seine Sprache" gerecht, denn es werden auch diese unbekannteren Beispiele aufgezählt, deren Verbindung zur Sprache sehr interessant sind.
Sowieso wird immer sehr differenziert vorgegangen und es werden sowohl emanzipatorische, als auch reaktionäre Elemente der jeweiligen Musikrichtungen beschrieben. Verklärt wird hier nichts, stattdessen wird ein sachlicher, aber auch humorvoller Blick auf die Musikgeschichte geworfen.
Insgesamt hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es bietet eine detailreiche, aber nicht ausufernde Reise durch die Zeit und Genres und ist gleichzeitig unterhaltsam und informativ.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Die Sprache der deutschen Popmusik
Dieses Buch hat sofort meine Neugierde geweckt, da mich der deutsche Pop seit den 50er Jahren bis heute nach wie vor begeistert. Die Platte auf dem Cover hatte sogar Rillen wie eine echte Vinyl-Scheibe. Und total genial fand ich die Playlist per QR-CODE direkt …
Mehr
Die Sprache der deutschen Popmusik
Dieses Buch hat sofort meine Neugierde geweckt, da mich der deutsche Pop seit den 50er Jahren bis heute nach wie vor begeistert. Die Platte auf dem Cover hatte sogar Rillen wie eine echte Vinyl-Scheibe. Und total genial fand ich die Playlist per QR-CODE direkt am Anfang, damit man direkt die passende musikalische Untermalung beim Lesen hatte. Eine Ohrwurm-Garantie. Aber genauso beim Lesen. Der Autor hat sich sehr wortgewandt artikuliert und ich musste so oft schmunzeln oder auch laut lachen. Außerdem gab es meistens ein paar Textzeilen zu dem jeweiligen Lied. Das Thema des Buches war ja auch die Geschichte der Sprache im deutschen Pop.
In den 50er und 60er Jahren habe ich definitiv sehr viel Neues erfahren. Da gab es Bands, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Aber auch in anderen Jahrzehnten gab es immer wieder Neues für mich. Auch die Musik in der damaligen DDR hatte eigene Abschnitte. Das meiste sagte mir allerdings nichts. Ich fand es trotzdem sehr interessant und auch gut, dass auf die gesamte deutsche Musikszene eingegangen wurde. Durch die Analyse einiger mir sehr wohl bekannten Liedern, habe ich sehr viel erfahren, dass mir überhaupt nicht bewusst war. Nicht jede Musikrichtung in den Jahrzehnten hat mir zugesagt, weder sprachlich noch musikalisch, aber trotzdem blieb es immer interessant und informativ.
Fazit:
Dieses Buch kann ich jeden Musikfreund nur empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Jens Balzer setzt sich in seinem 224-seitigen Buch mit der deutschen Popmusik und deren Einfluss auf die deutsche Sprache auseinander. Der Betrachtungszeitraum reicht von den 50er Jahren bis in die Gegenwart.
Als musik- und sprachaffine Leserin habe ich mich auf die Lektüre dieses Sachbuchs …
Mehr
Jens Balzer setzt sich in seinem 224-seitigen Buch mit der deutschen Popmusik und deren Einfluss auf die deutsche Sprache auseinander. Der Betrachtungszeitraum reicht von den 50er Jahren bis in die Gegenwart.
Als musik- und sprachaffine Leserin habe ich mich auf die Lektüre dieses Sachbuchs sehr gefreut. Leider bin ich mit etwas anderen Vorstellungen an das Buch herangetreten und hatte mir im Vorhinein gewünscht mehr über Mainstreambands, NDW und die Musik der 80er zu lesen. Doch gerade zu diesen Epochen/Themen fiel Balzers Input eher dürftig aus. Er scheint eher ein Autor der Nischenbands und unbekannten Musik zu sein. Auch mit seiner mehrseitigen Betrachtung von deutschen Gangsta-Rap-Texten und der Krautrockszene konnte er mich nicht mitreißen. Die ersten beiden Kapitel über die Musik der 50er bis 80er lasen sich noch spannend, weil allerhand bekannte Musikgrößen/Titel/Bands von den Capri-Fischern über Beatles bis zu Falco eine Rolle spielten. Sprachlich wurden mehr Liedtexte einfach abgedruckt als kommentiert und gedeutet. Natürlich kann man auf so wenigen Seiten nicht alle Musikstile und -farben hinreichend abbilden, aber es wäre ein Leichtes gewesen, zumindest die allseits bekannten Bands kurz zu streifen.
Ein paar Fotos und Grafiken hätten der manchmal recht eintönigen Lektüre sicher gut getan.
Den unmissverständlichen Titel des Buchs finde mit Blick auf die beiden Hauptrichtungen der Popmusik treffend. Einmal besingt sie die heile, schöne Welt und einmal versucht sie sich von dem Bestehenden zu lösen bzw. gar gegen die Musik der Eltern zu rebellieren. Eines kann man allerdings nicht abstreiten, dass sich Musik und Sprache stets im Wandel befinden und das ist gut so.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Etwas anderes erwartet
Erst einmal muss ich wirklich das Cover loben! Ich mag die Schallplatte, bei der man sogar die Riefen fühlen kann. Da das Buch aus dem Dudenverlag stammt, habe ich mir etwas völlig anderes versprochen. Meist ist der Duden ein Nachschlagewerk, bei dem alles …
Mehr
Etwas anderes erwartet
Erst einmal muss ich wirklich das Cover loben! Ich mag die Schallplatte, bei der man sogar die Riefen fühlen kann. Da das Buch aus dem Dudenverlag stammt, habe ich mir etwas völlig anderes versprochen. Meist ist der Duden ein Nachschlagewerk, bei dem alles übersichtlich erklärt wird. Das ist bei diesem Buch nicht der Fall! Das Werk ist komplett als zusammenhängender Text verfasst, bei dem der Autor über die vergangenen Musikepochen schwadroniert. Es werden kurze Songtexte eingeflochten und Hintergrundinformationen geliefert. Packen konnte mich das nicht! Gerade was die 2010er Jahre anbelangt, wurde wieder alles politisch korrekt dargeboten. Am Ende habe ich mich dann gefragt, für wen das Buch überhaupt von Nutzen ist. Vermutlich nur echten Musikliebhabern. Das sich die Sprache über die Jahre ändert, kann man heute leider jeden Tag aufs Neue erleben. Und das manche Songs mal mehr mal weniger Sinn ergeben leider auch. Positiv sei noch erwähnt, dass nichtgegendert wurde – nicht mal bei den Kapiteln aus der heutigen Zeit.
Schmalz und Rebellion erzählt eine lange Geschichte über den deutschen Pop und seine Sprache. Es gibt eine Menge Quellenangaben, die aus anderen Texten mit eingearbeitet wurden, um einen runden Textfluss zu erzeugen. Ich denke, das Buch ist wirklich nur was für Musikliebhaber oder gar Sprachwissenschaftler. Ich gebe zu, bei einer Leseprobe hätte ich mir das Buch sicher nicht zu Gemüte geführt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für