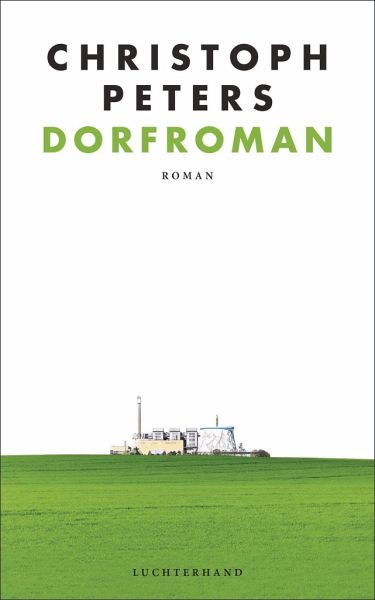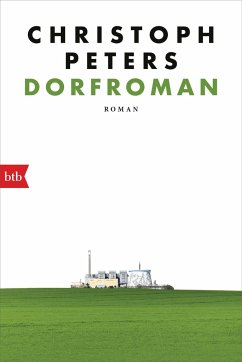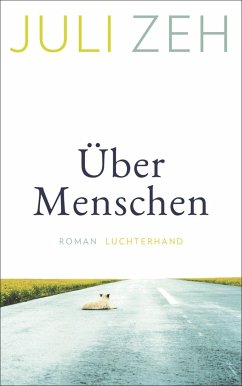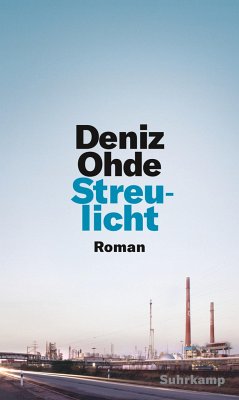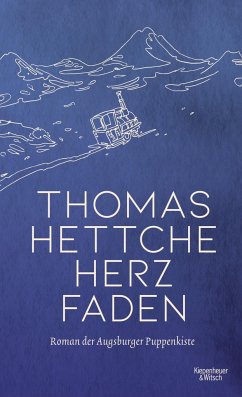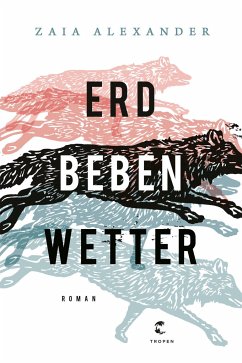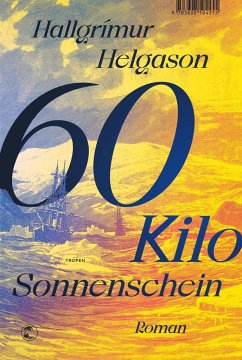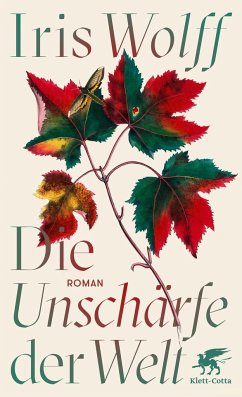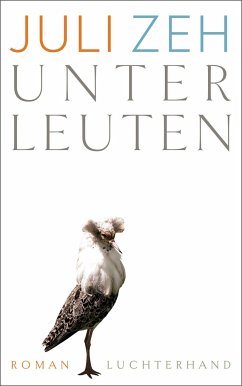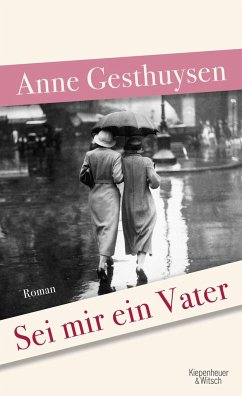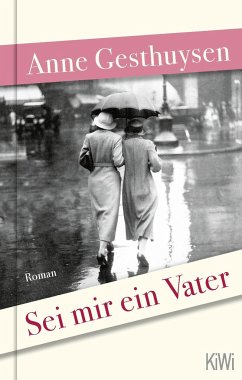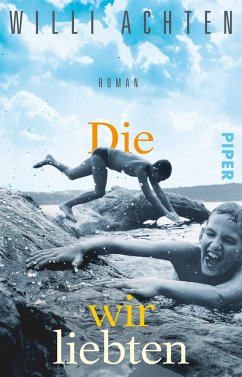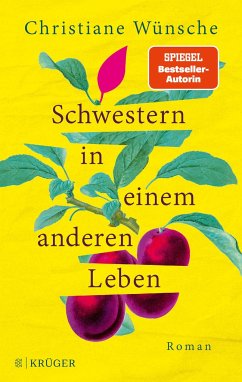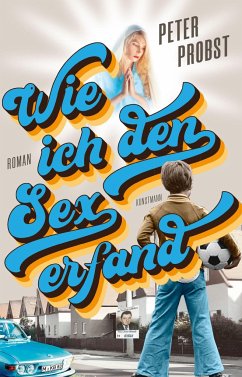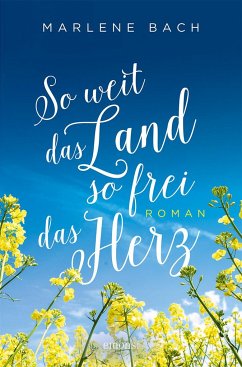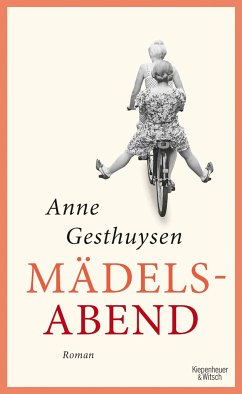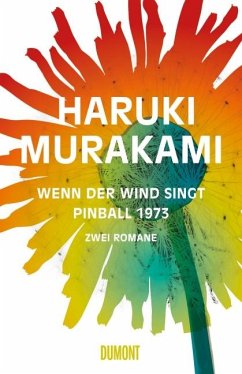Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Im Schatten des Reaktors - ein fulminanter Rückblick auf die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre.Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des "Schnellen Brüters", eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ga...
Im Schatten des Reaktors - ein fulminanter Rückblick auf die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre.
Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des "Schnellen Brüters", eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig mögliche ist - und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die linke Gegenkultur einführt...
Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren Zerreißproben eines jungen Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist der große Roman über den turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir heute leben.
Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des "Schnellen Brüters", eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig mögliche ist - und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die linke Gegenkultur einführt...
Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren Zerreißproben eines jungen Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist der große Roman über den turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir heute leben.
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018), dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021) sowie dem Niederrheinischen Literaturpreis (1999 und 2022). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand die ersten beiden Teile einer an Wolfgang Koeppen angelehnten Trilogie: "Der Sandkasten" (2022) und "Krähen im Park" (2023).
Produktdetails
- Verlag: Luchterhand Literaturverlag
- Originalausgabe
- Seitenzahl: 416
- Erscheinungstermin: 24. August 2020
- Deutsch
- Abmessung: 221mm x 140mm x 45mm
- Gewicht: 656g
- ISBN-13: 9783630875965
- ISBN-10: 3630875963
- Artikelnr.: 59132386
Herstellerkennzeichnung
Luchterhand Literaturvlg.
Neumarkter Str. 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
»Ein Buch wie eine ganze Welt.« Denis Scheck / Das Erste "druckfrisch"
Name ist Programm
Selten gab es ein Buch, in dem der Inhalt so gut zum Titel passte. Im Buch heißt das Dorf Hülkendonck. In der realen Welt Hönnepel. Der Ort ist nicht deswegen berühmt geworden, weil Fußballgott Ailton am Ende seiner Karriere als Spieler des KFC …
Mehr
Name ist Programm
Selten gab es ein Buch, in dem der Inhalt so gut zum Titel passte. Im Buch heißt das Dorf Hülkendonck. In der realen Welt Hönnepel. Der Ort ist nicht deswegen berühmt geworden, weil Fußballgott Ailton am Ende seiner Karriere als Spieler des KFC Uerdingen beim SV Hönnepel-Niedermörmter antreten musste, worüber selbst Arndt Zeigler berichtete, sondern weil auf den Wiesen der Kirche der Schnelle Brüter gebaut wurde. Sonst wäre das Buch wohl auch nicht so interessant.
Und das wäre auch meine schärfste Kritik: Braucht es wirklich über 100 Seiten, um zu beschreiben, welcher Bauer welche Kinder, was im Fernsehen, wie die Spieler von Mönchengladbach heißen und welche Tiere in den Sendungen von Grzimek vorkamen? Als dann noch der Vater des Ich-Erzählers auf Platt mit seinen Kollegen schwätzte, hat es wirklich gereicht.
Eigentlich habe ich dieses Buch gelesen, weil ich wissen wollte, wie es im Protestcamp zuging. Und ab Seite 100 erfahre ich auch in jedem zweiten Kapitel von Juliane, der Freundin des Ich-Erzählers. Sie lebt im Camp in einer anderen Welt als der Dorfschüler, der in seiner Freizeit auf Schmetterlingsjagd aus wissenschaftlichen Zwecken ging, was natürlich spätestens alle 10 Seiten mal erwähnt werden muss. Der Vater des Schülers ist im Kirchenvorstand, der vom Bischof aufgelöst wurde, weil die Mehrheit das Kirchenland nicht zum Bau des Brüters verkaufen wollte. Ich will nicht schreiben, dass es gänzlich uninteressant war, wie das Dorf durch den Bau gespalten wurde, ich fand es aber zu ausführlich. Außerdem bauen neben dem Elternhaus des Protagonisten noch die Stauders, um zu zeigen, wie schwer die Integration von Zugezogenen im Dorf verläuft.
Was mich wundert, dass Denis Scheck, der Siegfried Lenz als Langweiler der deutschen Nachkriegszeit bezeichnet, dieses Buch empfiehlt. Auch Peters beschreibt zu viel. Da ich jedoch ebenfalls am Niederrhein aufgewachsen bin – wenn auch nicht in Hönnepel – und vieles wieder entdecken konnte, insbesondere den katholischen Konservatismus, will ich dem Buch trotz seiner Mängel 4 Sterne geben.
Ich habe auch überlegt, ob es nicht besser wäre die Geschichte in zwei Strängen zu erzählen. Einer von der Geburt des Ich-Erzählers bis zum Bau des Brüters und einer rückwärts von heute bis zum Bau. Vermutlich hätte mir das besser gefallen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Märkische Behaglichkeit am Niederrhein
Im Titel «Dorfroman» hat Christoph Peters die Genrebezeichnung seines neuen Buches bereits benannt, Handlungsort ist nämlich ein kleines Dorf am Niederrhein, nähe Kalkar. Und mit dem Ort wird auch gleich die Thematik deutlich, es …
Mehr
Märkische Behaglichkeit am Niederrhein
Im Titel «Dorfroman» hat Christoph Peters die Genrebezeichnung seines neuen Buches bereits benannt, Handlungsort ist nämlich ein kleines Dorf am Niederrhein, nähe Kalkar. Und mit dem Ort wird auch gleich die Thematik deutlich, es geht um den Schnellen Brüter, jenen neuen Kernreaktortyp, der in den 70er Jahren an diesem Standort gebaut wurde. Und wie an den anderen Brennpunkten im Kampf gegen die Atomlobby, so entsteht auch in der kleinen Ortschaft ein improvisiertes Lager streitbarer Atomkraftgegner, direkt gegenüber dem Bauplatz des Atommeilers, auf der anderen Rheinseite.
Der in Berlin lebende Ich-Erzähler besucht seine Eltern in Hülkendonck, dem Ort seiner Kindheit, beide sind schon lange im Ruhestand. Bereits bei der Anfahrt mit dem Auto werden beim Anblick vieler vertrauter Plätze manche Erinnerungen wieder in ihm wach. Vieles hat sich zwar verändert, seit er vor dreißig Jahren dieses Kaff verlassen hat, aber manches ist ihm immer noch wohl vertraut. In seinem ehemaligen Kinderzimmer stößt er dann auf all die Dinge, die dort noch immer für ihn aufbewahrt werden, und mit jedem einzelnen verbinden sich irgendwelche Geschichten aus seinem Leben damals. Sein Vater war Meister in einem Betrieb für Landmaschinen, ist in dem bäuerlich geprägten Dorf geboren und kennt fast jeden. Die Mutter stammte aus der Stadt, als Lehrerin aber ist sie hier schon bald ebenfalls eng verwurzelt. Der geplante Bau des Reaktors spaltet die Dorfgemeinschaft nun in zwei Lager. Der Vater des Ich-Erzählers gehört als Kirchenvorstand, anders als seine Kollegen dort, entschieden zu den Reaktor-Befürwortern. Durch ihren Beschluss, das der Kirche gehörende Baugelände nicht zu verkaufen, blockiert eine deutliche Mehrheit im Kirchenvorstand aber den Verkauf, die Auseinandersetzungen im Dorf eskalieren. Die meisten versprechen sich neue Arbeitsplätze, und die Kirchenoberen freuen sich schon auf das viele Geld, mit dem dann auch die uralte Kirche saniert werden könnte.
Der Roman schildert sehr anschaulich das behütete Leben des Helden, das familiäre Zusammenleben, die Nachbarn, Freunde und all die Bauern, die das Dorfleben prägen. Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders mit ihrer spießigen Nierentisch-Romantik. Eine geistige Ödnis, zu der vor allem auch ein naiver Katholizismus beiträgt, von dem er sich aber in der Pubertät allmählich immer mehr abwendet. Entscheidend ist dabei Juliane, eine sechs Jahre ältere Aktivistin aus dem benachbarten Protestcamp, in die er sich als fast Sechzehnjähriger unsterblich verliebt hat und mit der er schließlich auch seine Initiation erlebt. Als Schmetterlings-Sammler mit dem schwärmerischen Berufswunsch ‹Tierschützer› á la Grzimek oder Sielmann entwickelt er sich unter Julianes Einfluss zum Atomkraftgegner. Seinem drögen Leben in dörflicher Idylle wird im Roman mit dem ‹Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll› der skurrilen Typen des Protestcamps ziemlich brutal ein alternativer Lebensentwurf gegenüber gestellt. Der Roman lebt vor allem von diesem extremen Spannungsfeld.
Mit seiner ruhigen Erzählweise erinnert der Autor ein wenig an Fontane, anschaulich schildert er das ländliche Milieu einer wohlversorgten Familie aus dem Mittelstand und die Sitten und Gebräuche am Niederrhein. Die Sprache ist der kindlichen Perspektive seines jugendlichen Helden stimmig angepasst, wobei vor allem dessen naive Naturliebe, die ja in krassem Widerspruch steht zum ökologischen Wahnsinn des Atomreaktors, in wunderbaren Naturbeschreibungen zum Ausdruck kommt. Nicht ganz verständlich ist, warum im Roman von Calcar geredet wird, obwohl die kleine Stadt seit 1936 offiziell Kalkar heißt. Und dass der Heranwachsende mit seiner promiskuitiven Geliebten sich selbst unverändert als Kind bezeichnet ist ebenfalls fragwürdig. Von den Figuren wirkt besonders der Vater als ein stimmig beschriebener, kantiger Charakter fontanescher Prägung überaus sympathisch, märkische Behaglichkeit also auch am Niederrhein!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Tradition und/oder Moderne, zwischen diesen beiden Polen pendeln die beiden Romane, die ich bisher von Christoph Peters gelesen habe, ein Thema, das ihn auch in seinem „Dorfroman“ beschäftigt.
In der unmittelbaren Nähe eines verschlafenen Ortes am Niederrhein soll ein …
Mehr
Tradition und/oder Moderne, zwischen diesen beiden Polen pendeln die beiden Romane, die ich bisher von Christoph Peters gelesen habe, ein Thema, das ihn auch in seinem „Dorfroman“ beschäftigt.
In der unmittelbaren Nähe eines verschlafenen Ortes am Niederrhein soll ein Kernkraftwerk, ein „schneller Brüter“ gebaut werden, ein Vorhaben das für tiefe Risse in der dörflichen Gemeinschaft sorgt. Auf der einen Seite die Zauderer, die an den Beziehungen und den gewachsenen Strukturen des dörflichen Lebens festhalten wollen, auf der anderen Seite die Fortschrittsgläubigen, die auf Veränderung und wirtschaftlichen Wohlstand hoffen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von außerhalb, die Anti-Atomkraft-Aktivisten, von beiden Seiten misstrauisch beäugt, die den Bau um jeden Preis verhindern wollen und mit ihren politischen Aktionen zusätzliche Unruhe in das Dorf bringen.
In diesem Spannungsfeld wächst der Ich-Erzähler auf, der identisch mit dem Autor ist. In drei Zeitebenen – Kind, Teenager, Erwachsener – beschreibt er nicht nur die durch den Kraftwerksbau ausgelösten Veränderungen seiner Heimat, das Auseinanderbrechen dörflicher Strukturen, sondern auch seine persönliche Entwicklung. Die Auseinandersetzungen mit den Eltern, das allmähliche Hinterfragen unumstößlicher Autoritäten, die erste Liebe, die Entwicklung eines politischen Bewusstseins, die Abkehr und die Heimkehr.
Peters‘ melancholischer Rückblick ist nicht nur eine Mischung aus Coming-of-Age Roman und Beschreibung einer politischen Sozialisation, sondern auch ein bemerkenswertes Zeitzeugnis. Und das werden am ehesten diejenigen bestätigen können, die wie der Autor in diesen Jahren aufgewachsen sind. Und übrigens, Kalkar, der „schnelle Brüter“, wurde zwar gebaut, ging aber niemals ans Netz.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für