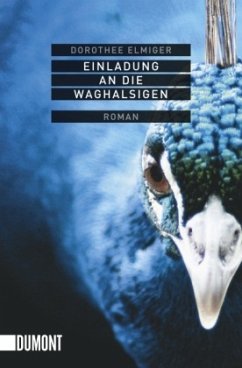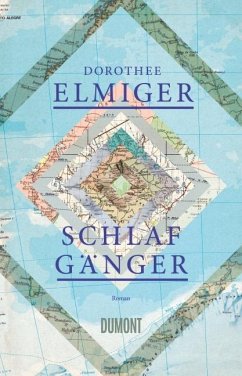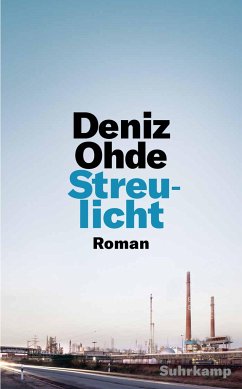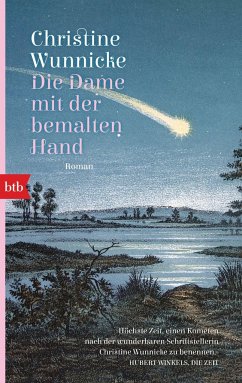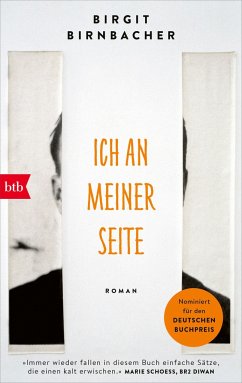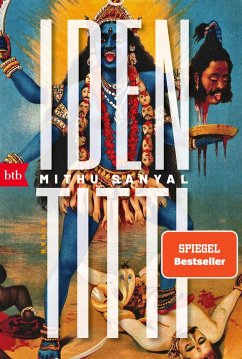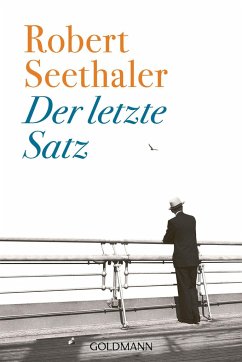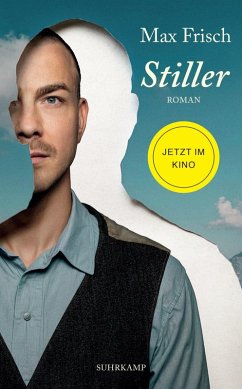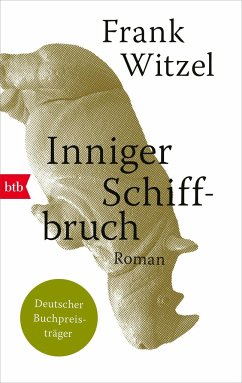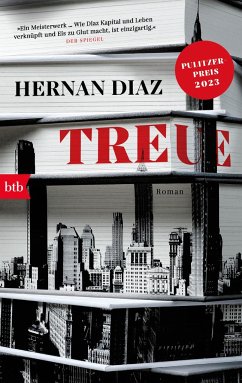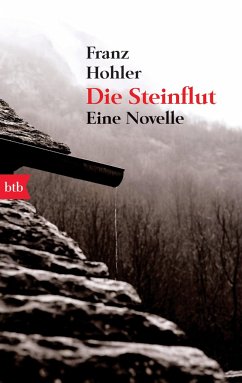Dorothee Elmiger
Broschiertes Buch
Aus der Zuckerfabrik
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Shortlist Deutscher Buchpreis und Schweizer Buchpreis - »Ein fulminantes literarisches Unikat, das Roman und Essay zugleich ist.« NZZ»Aus der Zuckerfabrik« ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt. 'My skills never end' steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer hinaus. Nachts drängen sich Ziegen am Bett der Autorin. Dorothee Elmi...
Shortlist Deutscher Buchpreis und Schweizer Buchpreis - »Ein fulminantes literarisches Unikat, das Roman und Essay zugleich ist.« NZZ
»Aus der Zuckerfabrik« ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt. 'My skills never end' steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer hinaus. Nachts drängen sich Ziegen am Bett der Autorin. Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern, Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn.
»Aus der Zuckerfabrik« ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen, Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt. 'My skills never end' steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer hinaus. Nachts drängen sich Ziegen am Bett der Autorin. Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern, Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn.
Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman 'Einladung an die Waghalsigen', 2014 folgte der Roman 'Schlafgänger'. Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich-Fried-Preis und zuletzt dem Nicolas-Born-Preis. Für 'Aus der Zuckerfabrik' (2020) erhielt sie den Franz-Hessel-Preis 2021 und war auf der Shortlist für den Schweizer und für den Deutschen Buchpreis 2020.
Produktdetails
- Verlag: btb
- Seitenzahl: 270
- Erscheinungstermin: 13. März 2024
- Deutsch
- Abmessung: 188mm x 121mm x 25mm
- Gewicht: 251g
- ISBN-13: 9783442771394
- ISBN-10: 3442771390
- Artikelnr.: 67722711
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
"Dorothee Elmiger erinnert [...] daran, was postmoderne Formen leisten können, gerade wenn man zeitgenössische, auch politisierte Texte schreiben will: Sie führen formal mitten in den Strudel der Probleme, statt so zu tun, als könne Literatur die Konflikte kontrollieren. Hier gibt es nichts zu beherrschen: Das ist der antiautoritäre Realismus ihres Schreibens." Tobi Müller, republik.ch, 12.10.20 "Ist das ein Roman, ein Traum oder ein Essay über das Begehren? Dorothee Elmigers 'Aus der Zuckerfabrik' ist vor allem ein erfreulicher Angriff auf den Literaturbetrieb." Jan Wiele, FAZ, 06.10.20 "'Aus der Zuckerfabrik' ist eine Materialsammlung zum Thema Heißhunger und Askese, Glückssuche und wirtschaftlicher Zwang, eine Recherche, für die man das
Mehr anzeigen
Haus nicht verlassen muss und bei der das Internet hilft - fast alles lässt sich rasch nachvollziehen. Zugleich könnte das Internet das mangels bequemer Stichworte nicht bieten ohne die Fantasie, die Findigkeit und die weiträumigen Lektüren der Schriftstellerin. [...] Zu Elmigers glasklarer Anklage gegen Verhältnisse, in denen über Menschen im Großen oder Kleinen verfügt oder hinweggegangen wird, kommt ein musikalischer Umgang mit den Motiven, die in Variationen wiederkehren." Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 21.09.20 "Der Clou ist jetzt, dass dies nicht in der müden Aussage endet: Alles hängt mit allem zusammen. Und das liegt an dieser Form, die eben keine feststehende Ordnung in dem Gestrüpp aus Zeichen suggeriert, das die Erzählerin sich in der Sprache imaginiert. 'Mit jedem Gang' durch den Text 'scheinen die Dinge in neue Verhältnisse zu treten.'" Insa Wilke, Süddeutsche Zeitung, 19.09.20 "Die Qualität dieses Buchs und sein sehr einnehmender Charme liegen vielmehr in der intelligenten Selbstreflexion, mit der hier eine Schriftstellerin die Schritte ihres Denkens und Schreibens untersucht und dokumentiert. Weil sie dabei alle selbstgewisse Erzählroutine vermeidet, vermag die Lust an den riskanten Wendungen des Textes umso mehr zu fesseln. 'Aus der Zuckerfabrik' ist ein literarisches Experiment von jener Art, wie sie derzeit nur selten unternommen werden." Eberhardt Falcke, SWR2 Lesenswert Magazin, 20.09.20 "Dorothee Elmigers poetischer Zugriff macht die verwirrenden und irren Zusammenhänge der Welt kenntlich, ohne Antworten zu liefern. Mit staunenswerter Konsequenz und in leuchtender Sprache erkundet sie seit ihrem Debüt 'Einladung an die Waghalsigen' globale Verstrickungen wie jene des Zuckers und der Glückssucher, die Überschreitung europäischer Grenzen oder den Abbau von Rohstoffen. Und auch wenn sie sich dabei im Gestrüpp verirrt, folgt man ihr gern, denn man entdeckt dabei ganz bestimmt etwas, was man noch nie gesehen und gesucht hat, das sich aber in die Netzhaut einbrennt." Martina Läubli, NZZ am Sonntag, 30.08.20 ",Aus der Zuckerfabrik' ist [...] vor allem anderen eine Übung zur Hingabe: an die rätselhaften und immer wieder mirakulösen Verstrickungen des Lesens." Björn Hayer, DIE ZEIT, 27.08.20 "Man darf das als Schule der Wahrnehmung bezeichnen, als Aufforderung, die Welt mit zärtlichem Respekt zu betrachten" Michael Wolf, der Freitag, 27.08.20 "Genau dieses Kunststück gelingt Dorothee Elmiger mit 'Aus der Zuckerfabrik'. Indem sie die Zusammenhänge infrage stellt, erstrahlt die Welt in ihrer kühnen eleganten Sprache als lust- und schmerzvolle Herausforderung für jede einzelne von uns. So lustig und so nonchalant wie die Dirigentin in der Basler Oper, über die sie sich einmal im Text so sehr freut, erweckt Dorothee Elmiger Lotto, Liebe, Hunger, Übersee und so weiter zum Leben, um unseren Blick dafür zu schärfen, wie wir uns die Welt vielleicht in Zukunft erzählen." Lisa Kreißler, NDR Kultur, 26.08.20 "In 'Aus der Zuckerfabrik' bergen diese Netze Begehren und Zurückweisung. Ekstatische Grenzüberschreitung und rohe Gewalt. Unbekümmerte, gefrässige Neugier und dumpfen Hunger. Sie holen auch den Stoff grosser Debatten ans Licht: Sexismus, Rassismus, ökonomische Ungleichheit und ökologischen Raubbau. Aber auch das Kleine findet sich zwischen den Maschen. Neben all den vielen berühmten Glückssucherinnen und Glückssuchern, neben Traumtänzern wie Vaslav Nijinsky und Mystikerinnen wie Teresa von Avila, glänzt nicht minder hell zum Beispiel ein dickes Kind in einem Schnellimbiss. [...] Mit seiner ganz eigenen Vorstellung von Himmel fügt es Dorothee Elmigers Erzählfabrik ein funkelndes Körnchen Zucker hinzu." Franziska Hirsbrunner, SRF2 Kultur, 26.08.20 "Egal an welcher Stelle man das Buch aufschlägt, man wird sofort hineingezogen in den Wald der Querverweise und die berauschende Reise, um Gier, Geld, Zucker, Kolonialismus und weibliches Begehren. Eine fast nie enden wollende Reise, die nach der Lektüre im Kopf weitergeht." Linda Schildbach, MDR Kultur, 25.08.20 "'Aus der Zuckerfabrik' ist eine Befreiung der Literatur aus dem Korsett des Romans, ein Fest des Erzählens, eine tollkühne Forschungsreise in die Ökonomie der Macht und des Begehrens und in die Abgründe unserer kollektiven Phantasmen. Elmiger ist Dichterin, Historikerin, Analytikerin, Theoretikerin und begnadete Erzählerin in einem." Martina Süess, WOZ - Die Wochenzeitung, 20.08.20 "Was Max Frisch, Teresa von Avila und ein am Ende verarmter Schweizer Lottomillionär miteinander zu tun haben, weiss man nach der Lektüre dieses fulminanten literarischen Unikats, das Roman und Essay zugleich ist. Woraus bestehen Wünsche, was ist das Begehren? 'Aus der Zuckerfabrik' unternimmt eine psychologische Bestandsaufnahme, deren Erkenntnisse durch eine forciert literarische Methode beglaubigt sind. Elmiger erzählt und argumentiert gleichzeitig, aber beides in einer tastenden Bewegung." Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 17.08.20
Schließen
Gebundenes Buch
Gattungsmischmasch
Ich nehme mir immer vor, wenigstens die Bücher der Shortlist des Deutschen Buchpreises zu lesen. Es wird wohl Ostern werden bis ich meinen Plan vollendet haben.
Ursprünglich glaubte ich in diesem Buch tatsächlich einen Roman über die Missstände des …
Mehr
Gattungsmischmasch
Ich nehme mir immer vor, wenigstens die Bücher der Shortlist des Deutschen Buchpreises zu lesen. Es wird wohl Ostern werden bis ich meinen Plan vollendet haben.
Ursprünglich glaubte ich in diesem Buch tatsächlich einen Roman über die Missstände des Zuckeranbaus zu finden. Aber es ist kein Roman.
Als ich Anfang Dezember Aphorismen von Lichtenberg gelesen habe, hoffte ich dann hier ähnliches zu finden. Aber es sind keine Aphorismen.
Dann sah ich den Kommentar von Elke Heidenreich im Literaturclub. Sie würde im Gegensatz zu Denis Scheck aus Respekt vor dem Autor schlechte Bücher nicht in die Tonne werfen. Na gut, dann nicht. Bis S.61 tapfer durchgehalten, aber es gilt die Regel: angefangenes Buch = 1 Stern
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Und noch ein Buch von der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2020. „Aus der Zuckerfabrik“ stammt aus der Feder von Dorothee Elmiger, einer Schweizerin, und es ist ihre dritte Veröffentlichung. Frau Elmiger zog es auf wie ein Notizbuch. Von einem Arbeiter mit dem bedruckten Shirt, …
Mehr
Und noch ein Buch von der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2020. „Aus der Zuckerfabrik“ stammt aus der Feder von Dorothee Elmiger, einer Schweizerin, und es ist ihre dritte Veröffentlichung. Frau Elmiger zog es auf wie ein Notizbuch. Von einem Arbeiter mit dem bedruckten Shirt, geht es zum ersten Lottomillionär der Schweiz, über eine Flug bis zu einem Autorentreffen. Ihre Gedanken bestehen oft aus wenigen Sätzen und eine Lösung gibt es nicht. Es ist eine Recherchereise durch Zeiten und Welten.
Es ist beileibe kein Buch, welches ich in wenigen Stunden las. Wie beschrieb es die Journalistin eines Radiosenders? Frau Elmiger fordere die Intelligenz der Leser. Das halte ich allerdings für unangebracht. Zum Beispiel darum: Wer sich auf ein fremdes Pferd setzt, ohne Zaum und Sattel, der ist nicht intelligent, der ist dumm. Viele Ereignisse führt sie nicht oder erst viele Seiten später weiter und beendet sie kaum. Aber nein, es ist beileibe nicht schlecht. Es gibt viele gute Ansätze in dem Buch.
Toll fand ich zum Beispiel den Hinweis auf das schöne Gemälde über den „Ursprung der Welt.“ Oder die vielen Hinweise auf Literatur aus der Vergangenheit. Dazu hat sie im Anhang eine lange Liste der Titel sowie ihrer Quellen aufgeführt. Sie stellte sich immer wieder die Frage, was denn bei einer Veröffentlichung auf dem Cover stehen sollte. Roman, oder doch lieber Recherchebericht? Wie sie lesen, wurde keins der beiden Wörter gewählt. Kann man über das Wort Liebe diskutieren? Nein? Doch! Frau Elmiger zeigt es in ihrem Buch. Und sie gibt sogar zu, dass sie nicht imstande ist etwas zu tun, was die Allgemeinheit unter „erzählen“ versteht. Sie kann nicht bei einem Thema bleiben.
Und warum trägt das Werk diesen Titel? Weil es immer mal wieder um den Zucker geht. Wie die Pflanzen geerntet und zu dem weißen Stoff verarbeitet werden oder welche Historie dieses Gewürz hat. Dann gab es noch ein Treffen, welches ich gut fand. Als sie nämlich zu einer Literaturrunde fuhr und dort von den „alten Hasen“ so begrüßt wurde: „Wie jung sie sind.“ Und dass viele glauben, sie würde Romane, vorzüglich „Nackenbeißer“ schreiben. Das hat sie bestens auf den Punkt gebracht, diese Vorurteile gegenüber junge Autoren. Auch ich musste lernen, dass sie gar nicht mal so „wirres Zeug“ schreibt, wie ich erst dachte. Leser müssen sich darauf einlassen und vorher bedenken, dass es eine kaum bekannte Art der Literatur ist. Also vier Sterne und eine Empfehlung für Mutige gebe ich hier.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Dorothee Elmigers ungewöhnliches und reichhaltiges Buch ist schon eine Herausforderung an den Leser. Die Schweizer Autorin selbst nennt Aus der Zuckerfabrik ein Recherchetagebuch. Themen sind ausgehend von dem Siebzigerjahre Lottogewinner Werner Bruni u.a. Reichtum, Gier und Ausbeutung sowie …
Mehr
Dorothee Elmigers ungewöhnliches und reichhaltiges Buch ist schon eine Herausforderung an den Leser. Die Schweizer Autorin selbst nennt Aus der Zuckerfabrik ein Recherchetagebuch. Themen sind ausgehend von dem Siebzigerjahre Lottogewinner Werner Bruni u.a. Reichtum, Gier und Ausbeutung sowie Literatur.
Es gibt eine Spurensuche, der man nicht leicht folgen kann und es gibt viele literarische, biografische wie autobiografische oder Film- bzw. kunsthistorische Bezüge. Diese kann ich genießen, wenn ich einen eigenen Bezug dazu habe, zum Beispiel mit Marie Louise Kaschnitz, James Joyce, Kleist, D.H.Lawrence oder Deborah Levy, die Elmiger zitiert. Diese Zitate können manchmal auch im Original, also in Englisch oder Französisch sein.
Weniger begeistert haben mich die Abschnitte mit Das Kapital von Karl Marx, aber ich verstehe, das selbst das einbezogen werden musste.
Ich persönliche habe aber die Abschnitte, in der Literatur eine Rolle spielt, am meisten gemocht, z.B. das Kapitel Montauk. Da geht es um Max Frisch. Für mich ein Höhepunkt des Buches.
Es sind immer wieder Abschnitte mit ausgezeichneten Formulierungen dabei.
Am Ende hat Dorothee Elmiger es tatsächlich geschafft, für den Lottokönig zu interessieren.
Was die Autorin anmerkt oder zitiert ist in der Regel nicht das offensichtliche, deshalb muss man sich auf den Text einlassen und man wird nicht alles sofort verstehen. Eine zweite Lektüre des Buches habe ich mir schon vorgenommen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ungewöhnlich, intensiv, packend
„Wenn ich meine Hefte und Kopien durchblättere, die Abbildungen, Schemata und Fotografien, wenn ich die im Verlauf der vergangenen Monate erstellten Dateien öffne, sehe ich keinen Pfad, keine sich an den Rändern überlagernden, …
Mehr
Ungewöhnlich, intensiv, packend
„Wenn ich meine Hefte und Kopien durchblättere, die Abbildungen, Schemata und Fotografien, wenn ich die im Verlauf der vergangenen Monate erstellten Dateien öffne, sehe ich keinen Pfad, keine sich an den Rändern überlagernden, aufeinander hinweisenden Bilder, Illuminationen, sondern einen Platz, einen Punkt, von dem ich vor vier oder fünf Jahren ausgegangen bin; seither habe ich alles, was mir in die Hände fiel, alles, was ich so sah, das in einem Zusammenhang mit diesem ersten Ort zu stehen schien, dorthin zurückgetragen und vorläufig abgestellt auf diesem weitläufigen Platz.“ (Zitat Pos. 45)
Inhalt
Eine Ich-Figur, Schriftstellerin, sieht einen Dokumentarfilm über den ersten Schweizer Lottomillionär Werner Bruni und eine Szene, eine Versteigerung, ist einer der Auslöser für viele Fragen, die sich daraus ergeben. Der symbolische Gang durch ein Gestrüpp, am Beginn und am Ende des Buches steht für die immer neuen Verästelungen und Themen, die in Fragmenten auftauchen, durch neue Gedankenverbindungen unterbrochen und dann später irgendwann weitergeführt werden. Daraus ergibt sich ein vielfältiges Mosaik aus Themen und Fragen unserer Gesellschaft und Zeit.
Thema und Genre
An einer Stelle des Buches stellt die Ich-Figur fest, ihr Buch sei kein Roman, sondern ein Recherchebericht. Es geht um Zucker, als Metapher für Gier, Ausbeutung aus wirtschaftlichen Gründen, Geldgier, aber auch für Gier im Sinne von Begierde, die Sehnsucht nach Süßem, nach Liebe.
Handlung und Schreibstil
Es sind Fragmente, Geschichten, die zwischen den Jahrhunderten pendeln, Szenen und Auszüge aus Biografien, aus bekannten literarischen Werken, teilweise neu gedeutet und neu verknüpft. Von der Schweiz an die amerikanische Ostküste, mit Max Frisch nach Montauk, nach Port-au-Prince, zu den Sklaven auf den Zuckerplantagen auf Haiti, führt die Reise kreuz und quer, dokumentiert durch Notizen der Recherchen in Bibliotheken, dazwischen Tagebucheinträge, manchmal nur in Stichworten, Textauszüge und Originalzitate in mehreren Sprachen, die sich immer wieder neu um den Grundbegriff „Zucker“ ergeben, ohne Ordnung und dennoch irgendwie geordnet. „Jetzt alles noch einmal revidieren: Zu allen Dingen ein letztes Mal zurückkehren, sie ins Licht halten, befragen.“ (Zitat Pos. 2690)
Eine literarische Achterbahnfahrt, manchmal episch schildernd, langsam sich steigernd, dann atemlos rasch, Satzteile, Ereignisse über Zeilen aneinandergereiht, weil ja auch in der Realität viele Dinge immer gleichzeitig geschehen, dazu kommen noch die sich dazu aufdrängenden Überlegungen und genau so will die Ich-Figur es auch erzählen. Das Ende?
„Aber wenn du glaubst, es gebe ein Ende, dann täuschst du dich.“ (Zitat Pos. 2529)
Fazit
Ein ungewöhnliches Buch, das eine der Facetten der aktuellen Gegenwartsliteratur zeigt, komplexe Themen, kritische Fragen unserer Zeit in eine neue Form des Erzählens gebracht. Keine leichte Lektüre, aber gerade wegen dieser sprunghaften Gedankenläufe, der unvorhersehbaren, breit gefächerten Geschichtenfragmente interessant und packend und nach einem ersten erstaunten, etwas verwirrten Innehalten las ich mit neugieriger Begeisterung weiter, gespannt, wohin mich die nächste Seite führen würde.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Viel gelobt wurde und wird dieses Buch von Kritikerinnen und Kritikern; es kam auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020, des weiteren wurde es für den Bayrischen wie auch den Schweizer Buchpreis nominiert. Dann muss es doch ein gutes Buch sein – oder?
Um ehrlich zu sein: …
Mehr
Viel gelobt wurde und wird dieses Buch von Kritikerinnen und Kritikern; es kam auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020, des weiteren wurde es für den Bayrischen wie auch den Schweizer Buchpreis nominiert. Dann muss es doch ein gutes Buch sein – oder?
Um ehrlich zu sein: Na ja, es geht so. Es ist weder ein Roman noch ein Sachbuch mit einem festen Thema, sondern mehr ein Sammelsurium von Gedanken, Ideen, Träumen, Zitiertem und Erlebtem der Ich-Erzählerin, die nahe an der Person der Autorin angelegt ist. Ausgehend von einem Dokumentarfilm, in dem Dinge eines früheren Lottomillionärs versteigert werden, hat sie
"… alles, was ich so sah, das in einem Zusammenhang mit diesem ersten Ort zu stehen schien, dorthin zugetragen und vorläufig abgestellt auf diesem weitläufigen Platz." (S. 12)
Und so geht es kunterbunt
"Mit jedem Gang durch das Chaos, über die Ananasfelder von Monte Plata, durch die Pariser Vorstädte oder den längst verlassenen Garten eines Sanatoriums, über die sizilianischen Berge, vorbei an den Russischen Bädern von Philadelphia zu den Ufern des Swan River in Australien, scheinen die Dinge in neue Verhältnisse zueinander zu treten." (S. 12)
Und es sind nicht nur die Orte, die ständig wechseln, sondern auch die Themen und die Art des Erzählens: Es geht um den Kapitalismus und die Industrialisierung in Europa, den transatlantischen Handel, die Revolution der Sklaven auf Haiti, Sucht und Begehren. Auf Träume folgen Gespräche, Gedanken oder Textauszüge aus einem der vielen Werke, die im Anhang aufgeführt sind und zuguterletzt gibt es auch Auszüge aus den Leben von Karl Marx, Max Frisch, der Mystikerin Teresa von Avila und einiger Anderer mehr. Manches scheint völlig zusammenhanglos hintereinander zu stehen, Anderes zeigt wirklich überraschende Verbindungen auf, dazwischen immer wieder auch Banalitäten und Unverständliches.
Auf den ersten 50, 60 Seiten war ich immer wieder kurz davor abzubrechen und das Buch als unlesbar weiterzugeben. Aber Frau Elmiger hat einen sehr angenehmen Schreibstil, es liest sich stellenweise wie das Tagebuch einer Freundin und weil die Abschnitte meist sehr kurz gehalten sind, hatte ich ruckzuck 20, 30 Seiten durch. Da immer wieder nicht nur Überraschendes sondern auch Interessantes zu entdecken ist und ich wusste, dass das Meiste auf tatsächlichen Geschehnissen beruht, fing ich an ein bisschen zu recherchieren, um beispielsweise etwas mehr über die Psychiatriepatientin Ellen West zu erfahren (durchaus lohnend!).
Doch was am Ende bleibt, hat kaum mehr Nährwert als der titelgebende Zucker. Unterhaltend ist dieses Buch definitiv nicht und die Informationshäppchen zu den unterschiedlichsten Gebieten und Personen sind und bleiben Häppchen. Da helfen auch die gelegentlich tiefgründigen Gedanken nicht mehr – es bleibt ein Zettelkasten. Doch wie meint Frau Elmiger selbst:
"Eine geniale Erzählerin oder ein genialer Erzähler könnte aus einem Stoffkonglomerat eine Erzählung machen, die die Dinge nicht schmälert, eindeutig macht, sondern im Gegenteil noch komplexer. Ich kann es nicht." (Dorothee Elmiger, ZEIT-Online, 17. August 2020)
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Unikat der Postmoderne
Das dritte Buch von Dorothee Elmiger mit dem Titel «Aus der Zuckerfabrik» verdeutlicht durch die fehlende Genrebezeichnung die Probleme bei der Definition der Gattung Roman. Bei Wikipedia wird dieses Buch nonchalant als ‹Roman› klassifiziert, eine …
Mehr
Unikat der Postmoderne
Das dritte Buch von Dorothee Elmiger mit dem Titel «Aus der Zuckerfabrik» verdeutlicht durch die fehlende Genrebezeichnung die Probleme bei der Definition der Gattung Roman. Bei Wikipedia wird dieses Buch nonchalant als ‹Roman› klassifiziert, eine literarische Form, die von Georg Lukács als «Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit» bezeichnet wurde, die Schweizer Autorin selbst hat ihr Buch als Recherchetagebuch bezeichnet. Auf potentielle Leser kommt also ein ungewöhnliches, verwirrendes Stück Prosa zu, soviel sei vorab schon mal gesagt.
Als Leitthema fungiert, dem Buchtitel entsprechend, der Zucker als Metapher für Begehren und Genuss, die Zuckerfabrik dient als Sinnbild der Gesellschaft. Ferner sind Gewalt, Kolonialismus, Ökonomie, Verteilungsgerechtigkeit, Glückssuche, Sexismus und anderes mehr markante Themen dieses konsequent abstrakt bleibenden, literarischen Sammelsuriums. Aber auch die Literatur ist, oft mit längeren Zitaten, breitgefächert vertreten. Peter Kurzeck wird genannt und Max Frisch, aber auch Joseph Roth, Marie Luise Kaschnitz oder Heinrich von Kleist. Zu den absonderlichen Geschichten, die häufig wiederkehrend im Buch thematisiert werden, gehört auch die des ersten Schweizer Lottokönigs von 1979 Werner Bruni. Der Titel seines Buches «Einmal Millionär und zurück» veranschaulicht besonders deutlich die Gedanken von Dorothee Elmiger zum Thema Geld. Mit Ellen West wiederum, berühmte Patientin des Schweizer Psychiaters Ludwig Binswanger, wird das Thema Suizid aufgegriffen, und der Russe Vaslav Nijnsky schließlich steht als begnadeter Tänzer für Ruhm, aber auch für ein tragisches Ende in geistiger Umnachtung. Die im Buch durch Karl Marx und Adam Smith vertretene Ökonomie wird, ihre Maßlosigkeit betreffend, mit einer köstlichen, filmreifen Szene beschrieben: Während einer Teestunde nimmt Adam Smith, ganz in Gedanken verloren, ein Stück Zucker nach dem anderen aus der Zuckerschale und isst es auf, bis die verstörte Gastgeberin die Schale vom Tisch nimmt und in Sicherheit bringt.
All diese vielen Textfragmente sind scheinbar ziemlich zusammenhanglos aneinandergereiht, ihr tieferer Sinn erschießt sich oftmals nicht. Die Ich-Erzählerin, in der die Autorin unschwer zu erkennen ist, gibt offen zu, sie sei nicht in der Lage, «ihr Material in eine Erzählung zu fügen». Man hat es quasi mit einem prall gefüllten Zettelkasten in Buchform zu tun. In dem sind weder Zeit noch Ort konkret fassbar. Von allen Zwängen befreit, wie die Grübeleien ihrer phantasiebegabten Schöpferin auch, werden vielmehr in wilden, unkoordinierten Sprüngen mühelos sämtliche realen Dimensionen überwunden. Was hier erzählt wird sind Schnappschüsse und Szenen aus den Gedanken und Visionen einer Schriftstellerin, die sich verzweifelt bemüht, die Gegenwart zu verstehen. Dabei landet ihre Ich-Figur erzählerisch sehr häufig in einem «Gestrüpp», Sinnbild für Weglosigkeit und Unbehaustheit.
Dieses Buch ist eine berührende Anklage gegen die himmelschreiende Ungerechtigkeit und die unvermindert anhaltenden, eklatanten Fehlentwicklungen des 21ten Jahrhunderts. Sprachlich umgesetzt wird dieses Lamento durch ein brüchiges, inkonsistent erscheinendes Narrativ mit einer ausgesprochen eigenwilligen Syntax, die durch häufige fremdsprachige Einsprengsel und Zitate noch zusätzlich sperriger wird. Allein die sechs Seiten mit Quellenangaben zeugen davon, dass von flüssigem Lesen in diesem Buch wahrlich nicht die Rede sein kann. Dass die Autorin sich dieser Schwierigkeiten bewusst ist, wird an mehreren Stellen deutlich. Während sie am Schreibtisch sitze, sagt die Ich-Figur einmal selbstreflexiv, passiere gleichzeitig um sie herum alles Mögliche, «und das muss dann natürlich alles auch erzählt werden, weil das ja die Bedingungen sind, unter denen der Text entsteht». Kaum vorstellbar, dass diese experimentelle Prosa, ein Unikat der Postmoderne, den diesjährigen Frankfurter Buchpreis gewinnt, - aber man soll ja nie Nie sagen!
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für