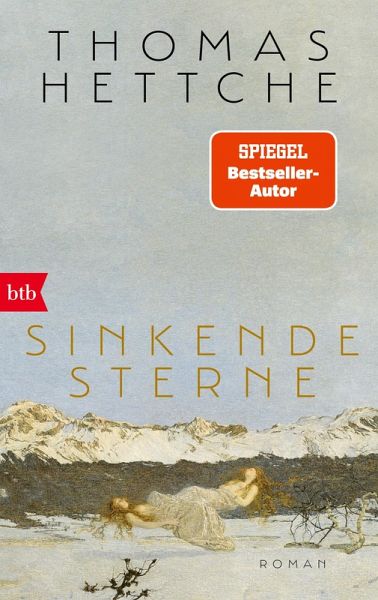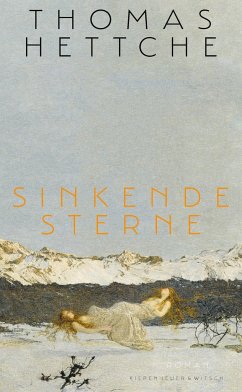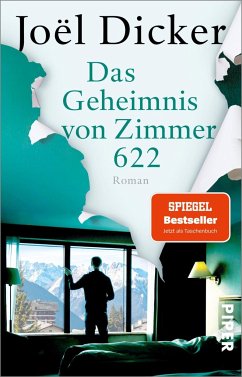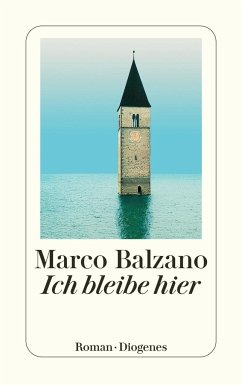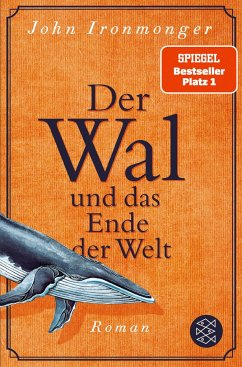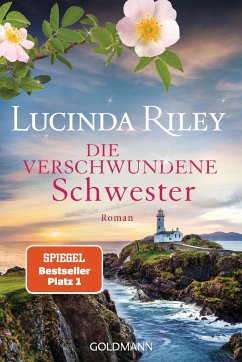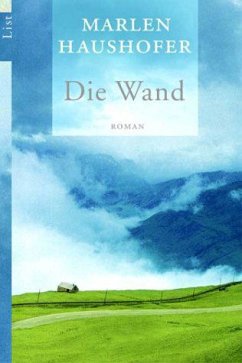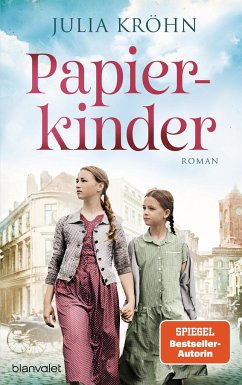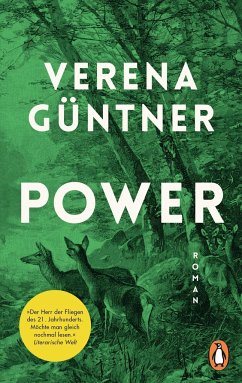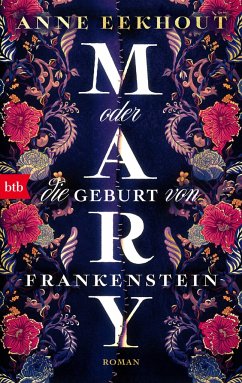Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Der neue Roman von SPIEGEL-Bestsellerautor Thomas Hettche jetzt als TB - Eine Idylle, die zur Bedrohung wird. Ein Erzähler, der plötzlich alles in Frage stellt.Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart. Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was ist hier Autobiografie, was Roman? Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalte...
Der neue Roman von SPIEGEL-Bestsellerautor Thomas Hettche jetzt als TB - Eine Idylle, die zur Bedrohung wird. Ein Erzähler, der plötzlich alles in Frage stellt.
Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart. Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was ist hier Autobiografie, was Roman? Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalterliche, bedrohliche Welt. Sindbad und Odysseus haben ihren Auftritt, Sagen vom Zug der Toten Seelen über die Gipfel, eine unheimliche Bischöfin und Fragen nach Gender und Sexus, Sommertage auf der Alp und eine Jugendliebe des Erzählers. In grandiosen Schilderungen taucht Thomas Hettche ein in die Natur und die vergessene Lebensform ihrer Bewohner. Im Kern aber kreist »Sinkende Sterne« um die Fragen, was es in den Umbrüchen unserer Zeit zu verteidigen gilt und welcher Trost im Erzählen liegt.
Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart. Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was ist hier Autobiografie, was Roman? Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalterliche, bedrohliche Welt. Sindbad und Odysseus haben ihren Auftritt, Sagen vom Zug der Toten Seelen über die Gipfel, eine unheimliche Bischöfin und Fragen nach Gender und Sexus, Sommertage auf der Alp und eine Jugendliebe des Erzählers. In grandiosen Schilderungen taucht Thomas Hettche ein in die Natur und die vergessene Lebensform ihrer Bewohner. Im Kern aber kreist »Sinkende Sterne« um die Fragen, was es in den Umbrüchen unserer Zeit zu verteidigen gilt und welcher Trost im Erzählen liegt.
Thomas Hettche wurde in einem Dorf am Rande des Vogelsbergs geboren und lebt in Berlin. Seine Essays und Romane, darunter 'Der Fall Arbogast' (2001), 'Die Liebe der Väter' (2010), 'Totenberg' (2012) und 'Pfaueninsel' (2014) wurden in über ein Dutzend Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Grinzane Cavour, dem Wilhelm-Raabe-Preis, dem Solothurner Literaturpreis und dem Josef-Breitbach-Preis. Sein Roman 'Herzfaden' (2020) stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Produktdetails
- Verlag: btb
- Seitenzahl: 213
- Erscheinungstermin: 10. September 2025
- Deutsch
- Abmessung: 186mm x 116mm x 17mm
- Gewicht: 185g
- ISBN-13: 9783442775316
- ISBN-10: 3442775310
- Artikelnr.: 72053314
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Ein Bergsturz hat im Wallis die Rhone aufgestaut und etliche Täler geflutet. Die Menschen, die überlebt haben, nutzen die Gelegenheit, sich ganz abzuschotten von anderen, vorzugsweise französischsprachigen Wallisern. Dies ist die Ausgangslage von Thomas Hettches Roman "Sinkende Sterne", erzählt Rezensentin Angela Gutzeit. Der Ich-Erzähler, der nach dem Ferienhaus seiner Eltern sehen will, aber auch die Entlassung von seinem Uni-Job verdauen muss, wird von misstrauischen Soldaten empfangen. Seine Entlassung verdankt er seiner Weigerung, Gender- und Identitätsdiskurse in seinen Vorlesungen so zu berücksichtigen, wie die Leitung es wünscht, erfahren wir. Hettche nimmt die Abgeschiedenheit im Wallis zum Anlass, seinen Protagonisten über Ästhetik und Kulturkritik nachdenken zu lassen und vermischt das mit einer teils phantastischen Handlung, erklärt Gutzeit. Ihr gefällt die "Lebendigkeit" von Hettches Überlegungen, aber irgendwann ermüdet sie. Interessante Themen, aber zu viel davon, ließe sich ihre Kritik resümieren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»ein sehr kluges Buch, ein differenziertes, ein ambivalentes Buch« Denis Scheck WDR 2 Buchtipp 20240204
Tief dringt Rezensent Philipp Theisohn in Thomas Hettches neues Buch ein, in dem wieder, wie wir lernen, ein Ort eine besondere Rolle spielt. Und zwar ein Walliser Chalet, das dem Erzähler aus der Kindheit vertraut ist und in das er nun zurückkehrt. Und das außerdem, führt Theisohn aus, von den Witterungsbedingungen bedroht wird, was Hettches Buch aber keineswegs automatisch zum Klimaroman macht. Jedenfalls kapselt sich in den Alpen eine Gemeinschaft von ihrer Umgebung ab, heißt es weiter, und das Wallis wird zu einem Reich der Allegorie, in dem Hettche poetologische Fragen verhandelt. Es tauchen auch Figuren auf, die an gegenwärtige Kulturkämpfe - Stichworte Corona, political correctness - erinnern, was dem Rezensenten nicht gar so gut gefällt, weil dadurch interessantere Fragen in den Hintergrund zu rücken drohen. Denn tatsächlich handele das Buch vom Schreiben als einer Macht des Nichtidentitären und des Selbstverlusts. Am Ende geht es allerdings vor allem, schließt die dem Buch insgesamt äußerst zugetane Rezension, um den Vater des Erzählers.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Wirkmächtigkeit von Literatur
Für seinen dystopischen Roman mit dem kryptischen Titel «Sinkende Sterne» hat Thomas Hettche ein kurioses Szenarium ersonnen, in dem er auf kunstvolle Art seine These von der universellen Schönheit herauf beschwört. Gleich zu Beginn …
Mehr
Wirkmächtigkeit von Literatur
Für seinen dystopischen Roman mit dem kryptischen Titel «Sinkende Sterne» hat Thomas Hettche ein kurioses Szenarium ersonnen, in dem er auf kunstvolle Art seine These von der universellen Schönheit herauf beschwört. Gleich zu Beginn wird er deutlich: «Was uns interessierte, war der Raum von Freiheit jenseits der Moral. Doch die Klugheit des Ästhetizismus ist schon immer auch seine Dummheit gewesen». Das mit unzähligen Referenzen und Verweisen durchmischte Buch zitiert ein Interview mit Isabelle Huppert, in dem sie Männer als «sinkende Sterne» bezeichnet hat, wobei der Autor denn auch gleich auf Odysseus und Sindbad verweist, die ja bekanntlich im Meer versunken seien. So wie er auf die universelle Schönheit als Thematik seines Romans setzt, verwehrt er sich gleichermaßen vehement gegen einen ideologisch bedingten Missbrauch der Literatur. Keine leichte Lektüre, soviel vorab!
Eine schriftliche Vorladung aus der Schweiz ruft den Ich-Erzähler, der auf den Namen Thomas Hettche hört (sic!), in die Schweiz, wo seine Eltern vor Jahrzehnten ein Chalet im Kanton Wallis gekauft haben, in dem er einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Er hat gerade seine Stelle an der Uni verloren, weil von den wenigen zu seinem Seminar angemeldeten Studenten schon bald nur noch einer übrig geblieben ist, denn diese Thematik war offensichtlich aus der Zeit gefallen. Ein Erdrutsch von apokalyptischem Ausmaß hatte vor Jahren das Tal der Rhone verschüttet. Der in Folge entstandene See hat viele Dörfer im Wallis überflutet, der gewaltige Naturdamm ist danach zu einer deutsch-französischen Sprachgrenze geworden, die auch zu einer politischen Trennung geführt hat. Auf dem Amt eröffnet ihm nun der Kastellan, dass die ererbte Immobilie enteignet werden müsse, weil er Nicht-Schweizer sei. Hilfe suchend wendet sich der Schriftsteller auf Rat des Notars an die einflussreiche Bischöfin, die er in einer surrealen Szene in der Kirche bei der Messe antrifft. Sie verspricht ihm danach in Eile, sich für ihn einzusetzen, legt dabei schon Stück für Stück ihr bischöfliches Talar ab und knöpft dann auch noch ihr langes Unterkleid auf. Unter dem ist sie nackt, und er sieht erstaunt, dass sie einen Penis hat.
Der Ich-Erzähler befindet sich in einer veritablen Lebenskrise und beschließt, erstmal in das jahrelang unbewohnte Haus einzuziehen. Nicht weit entfernt wohnt seine ehemalige Jungendfreundin Marietta mit ihrer kleinen Tochter. Sie erzählt ihm von den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, die sich nach der Naturkatastrophe ereignet haben, und weiht ihn ein in die Mythen und Sagen, die das Leben in dem abgeschotteten Tal nun, wie einst im Mittelalter, deutlich wieder beeinflussen. Der lebensfremd wirkende und entschluss-unfähige Ich-Erzähler hat die Bodenhaftung jedenfalls eindeutig verloren und scheint zudem extrem bindungsarm zu sein. Er stellt eine wenig überzeugende, zentrale Figur dar, zu der man kaum emotionale Nähe aufzubauen vermag.
Dieser handlungsarme Roman ohne erkennbares Ziel ist ein Sammelsurium von Reflexionen, Verweisen, Zitaten und essayistischen Notizen zum Thema Literatur und deren Quellen. In dem Selbstfindungs-Prozess des Protagonisten sind Gedanken eingewoben, die zum Nachdenken anregen und unbedingt auch ein ständiges Mitdenken erfordern. Fast beherrschend, und mit der Zeit leider zunehmend immer langweiliger werdend, erscheint beim Lesen die schiere Fülle von Naturbeschreibungen. Seien es die der alpinen Flora oder die der höhenbedingt wechselnden Fauna, die da immer wieder erneut beschrieben und bewundert werden. Gefühlt hundert Mal hört man die Krähen über dem Haus krakeelen, von Wind, Wolken, Regen und Schnee ganz zu schweigen! Literarisch als ein Abgesang auf die Postmoderne angelegt, ist dieser zwischen magischem Realismus, Heimat-Opus und angedeuteter Liebelei in ländlicher Kulisse angesiedelte Roman ein Fanal der Wirkmächtigkeit von Literatur, welches deren gottähnliche, völlig ungebundene Schöpfer (natürlich) mit einschließt!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der namensgleiche Protagonist in Thomas Hettches neuem Buch hat seinen Job als Hochschullehrer verloren und macht sich auf ins Wallis, wo das Haus seiner Kindheit steht. Erinnerungen und Vergänglichkeit erwarten ihn im Chalet seiner verstorbenen Eltern. Doch im Ort ist man ihm nicht …
Mehr
Der namensgleiche Protagonist in Thomas Hettches neuem Buch hat seinen Job als Hochschullehrer verloren und macht sich auf ins Wallis, wo das Haus seiner Kindheit steht. Erinnerungen und Vergänglichkeit erwarten ihn im Chalet seiner verstorbenen Eltern. Doch im Ort ist man ihm nicht wohlgesonnen. Als Deutscher habe er kein Bleiberecht mehr, sein Haus würde in einer Kürze versteigert und er müsse das Land verlassen.
Irgendwie ist alles noch so, wie es war, aber eigentlich ist doch nichts mehr so. Vor einiger Zeit hat es einen massiven Bergrutsch gegeben, der die Rhone zu einem See angestaut hat und dabei etliche Dörfer versenkt hat. Alte Machtstrukturen haben sich wieder etabliert, nachdem sich das deutschsprachige Wallis vom französischsprachigen separiert hat.
Doch Hettche bleibt. Vielleicht ist auch seine alte Jugendliebe Marietta der Grund. Eine der wenigen, die geblieben ist, und nun in alter Tradition das Vieh im Sommer in die Berge treibt. Ihr folgt er für ein paar Wochen in die karge Welt der Hochalpen, wo er ihr wieder näherkommt, bei der Käserei hilft und Serafine, Mariettas Tochter, ihm Mythen der Berge erzählt.
Hettche hat mich mit seiner bildgewaltigen Sprache und kraftvollen Naturbeschreibungen durch die erste Hälfte des Buches getragen. Auch seine Erinnerungen an seine Gespräche mit seinem letzten Studenten Dschamil über die Odyssee und Sindbad mochte ich gern folgen. Etwas abgefahrener war da schon das Treffen mit einer etwas seltsamen Bischöfin. Aber dann hat er mich langsam verloren.
Auch wenn ich der Suche und dem Irren des Protagonisten oft folgen konnte, seine Zweifel an der immer schneller werdenden Zeit, die alles infrage stellt, verstehen konnte, verlor sich seine anfängliche Handlung in ausschweifenden, essayartigen Reflexionen. Immer wieder bezugnehmend auf Literatur und Kunst hätte ich wahrscheinlich unzählige Werke lesen müssen, um die Essenz dahinter zu verstehen. Ich fand es äußerst mühsam, seinen Gedanken und Ausführungen zu folgen, und habe gleichzeitig auf den Fortgang der Handlung gehofft. Doch anfänglich aufgeworfene Konflikte versanden, der Protagonist versinkt in einem Fieberwahn und schreibt lieber über Rilke.
Ich bin halt nur eine Durchschnittsleserin, und mich interessiert keine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Schreibprozess oder wenn er über Wittgenstein, Proust oder Lukrez doziert. Sollen sich die Literaturkritiker daran erfreuen, ich bin raus. So wurde nach anfänglicher Freude das Buch für mich leider zur Enttäuschung.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes steht am Beginn dieses Buches: ein Bergsturz im unteren Wallis hat das Tal verschüttet, die Rhone wurde zurückgestaut und bildet nun einen gewaltigen See, der die Dörfer des Tals in sich begräbt. Der Autor hält sich …
Mehr
Eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes steht am Beginn dieses Buches: ein Bergsturz im unteren Wallis hat das Tal verschüttet, die Rhone wurde zurückgestaut und bildet nun einen gewaltigen See, der die Dörfer des Tals in sich begräbt. Der Autor hält sich nicht auf mit Erläuterungen oder Hinweisen zu den vermutlichen Ursachen des Bergsturzes. Kein Wort über Dauerregen, Gletscherschmelzen, Klima und dergleichen, sondern er kommt sofort zu seinen eigentlichen Themen.
Der Protagonist, namensidentisch mit dem Autor, ein alternder und beruflich gestrandeter Literat, reist nun in das Tal, um nach dem Tod seiner Eltern sein Elternhaus zu verkaufen. Und da beginnt schon das Irritierende: er kommt in seine Heimat und ist dort ein unerwünschter Fremder.
Der gewaltige Erdrutsch hat nicht nur die Dörfer zerstört, sondern hat auch die bisherigen gesellschaftlichen Strukturen, die Zivilisation, die Neuzeit im Element Wasser begraben. Ein gewaltiges Totenreich ist hier entstanden, eingerahmt von den mächtigen und unzugänglichen Bergen der Hochalpen. Die überlebende Bevölkerung schließt sich ab und installiert eine restriktive feudale Ordnung. Hier kann sich der Autor einige diskrete Seitenhiebe auf das rückwärtsgewandte bürokratische Selbstverständnis der Schweizer und ihren ausgeprägten Geschäftssinn nicht verkneifen.
Der unheimlich dunkle See kann mit einer Fähre überquert werden, und hier gelingen dem Auto sehr eindringliche und archaische Bilder, die an griechische Mythen erinnern und die Motive der Vergänglichkeit und des Todes noch verstärken.
Durch den Untergang des Jetzigen tauchen die alten, vorschriftlichen Mythen und Sagen wieder aus der Versenkung auf, und der Leser lauscht mit dem Protagonisten den Sagen von Hungersnöten, von Totenwanderungen über die Gebirgskämme, von todbringenden Schneewehen, von den heimatlos umherirrenden Armen Seelen und ihren gefährlich verlockenden Lichtern. Der Autor schafft hier eine düstere und unheimliche Atmosphäre, der sich der Leser nicht entziehen kann – und die verstärkt und gleichzeitig verschönt wird durch die einfach nur grandiosen Beschreibungen des unwirtlichen, stürmischen Wetters und der Natur.
An diesem Punkt zweigen sich Hettches andere Themen ab. In breit angelegten Reflexionssträngen sinniert sein Protagonist über die vielschichtigen und existenziellen Themen Tod und Vergänglichkeit und vor allem um die Möglichkeiten, beides zu überwinden. Hier zeigt sich ein Walliser Mythos als Hoffnungsschimmer: weit oben im Gletscher befinde sich eine blühende Landschaft, in der die Sonne scheine, in der Kirsch- und Zwetschgenbäume wachsen und in der jeder Irrende und Suchende seine Heimat finden könne. Wo ist dieses Paradies, das den Tod überwindet? Die Antwort auf diese Frage hebt sich den Autor für den Schluss auf...
Hier schließt sich ein poetologischer Diskurs an, in dem Hettche gedankenreich und durchaus spannend Homers Ilias und die Sagen um Sindbad, den Seefahrer bemüht. Was für ein schöner Gedanke: Morgenland und Abendland treffen sich in ihrer phantasievollen Erzählfreude! Beiden Helden fühlt sich der Protagonist ähnlich: sie sind vaterlos und heimatlos wie er, Suchende und Irrende auf dem Wasser. Aber es geht um das Erzählen, um die Macht des Erzählens, das Konstrukt einer fiktiven Realität und das Verhältnis von Realität/Wahrheit und Fiktion.
Homer konnte seine Welt, also die Welt des Odysses, noch als Sinnganzes begreifen, und so begreift sie auch Odysseus: er glaubt "an die Welt, so wie sie ist".
Das geht heute nicht mehr, sinniert der Protagonist. Unsere Wirklichkeit ist dekonstruiert, d. h. sie ist in Einzelwahrnehmungen zersplittert, und das Sinnganze existiert nicht mehr bzw. kann nicht mehr gesehen werden. Dichter und Leser sind nicht mehr durch ein gemeinsames Weltverständnis miteinander verbunden.
Und das verändert auch das Erzählen. Die Dichtung, meint der Protagonist, führt den Dichter und den Leser aus seiner Welt heraus, anders als bei Homer. Dichtung versucht, die Welt zu erreichen, aber es bleibt bei dem Versuch; Dichtung ist immer eine Konstruktion in dem Sinn, dass sie die subjektive Wahrheit des Dichters wiedergibt, aber nicht wie bei Homer die der Welt.
Die Folge ist, dass Literatur und Sprache eine eigene Dynamik entfalten, die Figuren werden quasi selbstständig und bestimmen selber ihr Leben. Die Begriffe Realität und Wahrheit sind nicht mehr fest umrissen, sondern taumeln wie „sinkende Sterne“, ihrer festen Konturen beraubt.
Am Schluss des Romans wird die Frage nach dem Paradies beantwortet, und hier schließen sich alle Themen des Buches nahtlos und ungemein elegant zusammen.
Das Paradies ist die Überwindung der Zeit und der Vergänglichkeit, und die gelingt in der Kunst. Und die Kunst kann eine Wahrheit bieten, die die tatsächliche Wirklichkeit nicht bieten kann.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ich bin eine Kraft der Vergangenheit
Was im Klappentext beschrieben ist, wird auf leicht poetische und reflektierende Art erzählt.
Der Erzähler reist in die Schweiz in das Ferienhaus seiner Eltern, das seiner Jugend. Dss erweckt natürlich Erinnerungen. Und sie führen …
Mehr
Ich bin eine Kraft der Vergangenheit
Was im Klappentext beschrieben ist, wird auf leicht poetische und reflektierende Art erzählt.
Der Erzähler reist in die Schweiz in das Ferienhaus seiner Eltern, das seiner Jugend. Dss erweckt natürlich Erinnerungen. Und sie führen ihn weiter durch Stationen seines Lebens.
Hettches Blick auf die Vergangenheit ist teils wehmütig verklärend, teils bereuend und desilludioniert, doch die Gegenwart ist erschreckend.
Beeindruckend auch die vielen Zitate aus Film und Literatur sowie Philosophie. Dennoch behindert dass das handlungsorientierte.
Es tat gut, mal wieder ein Buch von einem Autor zu lesen, dem die Sprache wichtig ist und die er sorgfältig einsetzt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Thomas Hettche begibt sich mit diesem "Roman" in die Schweiz seiner Kindheit und versetzt sie gleichzeitig in eine dystopisch anmutende Zeit ohne rechten Rahmen. Manches ist einfach eigenartig, wirkt wirr und unpassend, wird aber nicht näher erläutert.
Ich würde dieses …
Mehr
Thomas Hettche begibt sich mit diesem "Roman" in die Schweiz seiner Kindheit und versetzt sie gleichzeitig in eine dystopisch anmutende Zeit ohne rechten Rahmen. Manches ist einfach eigenartig, wirkt wirr und unpassend, wird aber nicht näher erläutert.
Ich würde dieses Buch nicht als Roman bezeichnen. Dafür ist die Rahmenhandlung einfach zu wenig. Der Autor lässt sein Alter Ego manchmal in Erinnerungen schwelgen und manchmal lässt er seinen Gedanken einfach freien Lauf. Dabei schreibt er über Literatur und das Schreiben im Allgemeinen und zwischendurch erläutert er uns die Odyssee und lässt uns eine Abhandlung über Rilke lesen.
Für mich war das alles nicht ganz stimmig. Es wirkt sehr belehrend und gleichzeitig ziemlich zusammenhanglos und obwohl der Autor sein Handwerk beherrscht, konnten mich diese Zeilen nicht erreichen. Immer wenn sich etwas Lesefluss eingestellt hat, schweift die Geschichte in eine andere Ecke und ich quälte mich von Neuem.
Zweifelsohne kann Herr Hettche meisterhaft schreiben und das blitzt auch aus diesem Buch immer wieder heraus, weswegen ich mich doch für 3 Sterne entschieden habe. Aus der Geschichte mit dem abgeschnitten Wallis hätte auch was entstehen können, aber indem der Autor seine autofiktionale Figur am Ende im Fieberwahn schwafeln lässt, bleibt sowieso offen, wie viel davon Bedeutung hat.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Biographie und Phantastik vermengen sich zu einem tiefgründenden Roman über die Kunst des Erzählens
In seinem neuesten Roman entführt uns der Autor in eine Mischwelt aus Autobiographie, Phantastik und gelebte Mythen im Wallis/Schweiz.
Die Eltern des Autors sind verstorben, …
Mehr
Biographie und Phantastik vermengen sich zu einem tiefgründenden Roman über die Kunst des Erzählens
In seinem neuesten Roman entführt uns der Autor in eine Mischwelt aus Autobiographie, Phantastik und gelebte Mythen im Wallis/Schweiz.
Die Eltern des Autors sind verstorben, und er erhält vom Kanton Wallis eine Vorladung. Er reist in den Schweizer Kanton, um die Angelegenheit zu richten, und das Chalet zu verkaufen. Allein die Anreise verwischt sich zu einem kleinen Strudel aus Biographie und Fiktion. Das Wallis ist nur mehr über die Pässe zu erreichen, denn ein mächtiger Felssturz hat die Rhone aufgestaut, den Tunnel und einige Ortschaften geflutet. Er wird von Soldaten mit Maschinengewehren in Empfang genommen, und so nach und nach kristallisiert sich heraus, dass der Karton mit seinen Dörfern zu einer Eigenständigkeit mit einem mächtigen Kastlan (und Bannherr der Sieben Zenden) an der Spitze zurückgekehrt ist. Alte Familienstämme haben wieder das Sagen, und nichts geht ohne die Bischöfin. Viele Orte sind verlassen, oder nur mehr mit einer Fähre zu erreichen.
Im Haus angekommen, überwältigen Hettche seine Kindheitserinnerungen. Und auch die Begegnung mit seiner Freundin Marietta aus Kindestagen nimmt unerwartete Wendungen. So wird aus einem geplanten Verkauf der Wunsch, in diese Welt und Natur, welche in gewissen Maße zu einer Ursprünglichkeit zurück gezwungen wurde, zu bleiben. Er hilft Marietta auf der Alm so gut er kann, aber die Zeit, sein Ultimatum, läuft ab.
Im Prinzip ist das nur ein grober Rahmen, denn der Autor beschäftigt sich sehr viel mit der Literatur. Was kann, soll, und darf der Schreibbetrieb wirklich? Wo liegt auch hier die Essenz, das Wesentliche. Es wird Rilke zitiert, welcher im Wallis seine letzte Ruhestätte fand. Und es folgen viele Streifzüge durch Homers Odyssee, versucht Parallelen zu Sindbads Abenteuer in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht zu finden. Es wird ein Strudel aus Hettches Gedankenwelt, und auch die Walliser Sagenwelt mit dem „Zug der Toten Seelen“ finden Einklang in seinen Überlegungen.
S.91: „Die Alpe fällt nur für wenige Monate im Jahr in das Recht der Menschen. Wenn wir im Herbst wieder hinabgehen ins Tal, beziehen Geister die verlassenen Hütten. Im Winter sollte man nicht hier sein. Wer trotzdem hochkommt, kann ihnen begegnen.“
Der Roman überzeugt sprachlich voll, denn das Schreiben beherrscht der Autor. Auf den Inhalt muss man sich tatsächlich sehr einlassen können. Besonders die vielen gedanklichen Einflüsse und Zitate setzen einen wachen Geist während der Lektüre voraus. Aber nichts desto trotz birgt der Roman ein sehr interessantes Lesevergnügen über das Leben im Allgemeinen, die Literatur im Besonderen. Insofern verschwimmen auch hier die Grenzen. In diesem Fall zwischen Roman und Lang-Essay.
Der Satz im Klappentext: „Ein schwebend abgründiger Roman über den Zauber der Literatur“ bringt es auf den Punkt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für