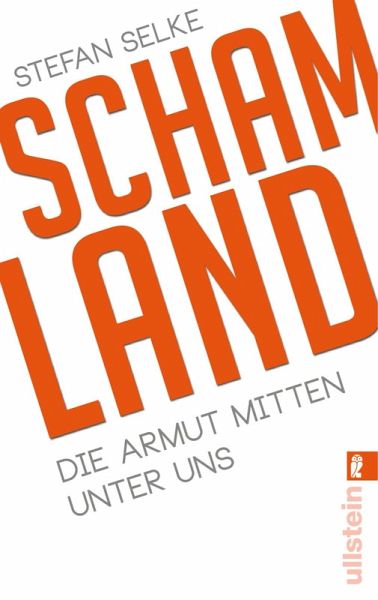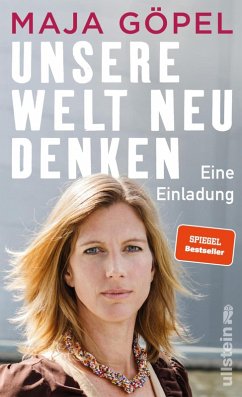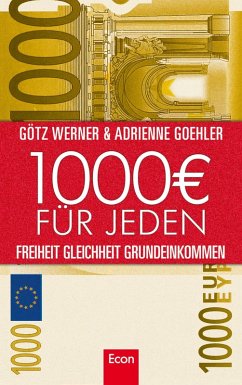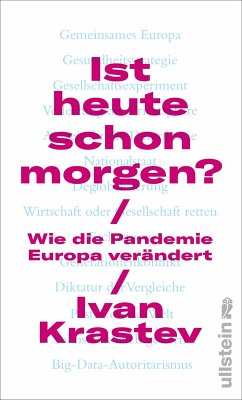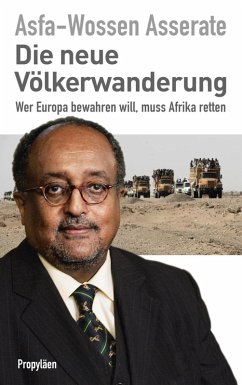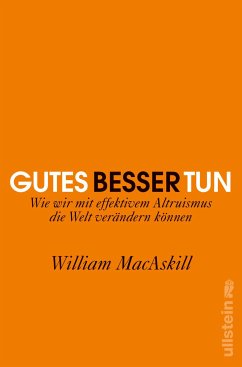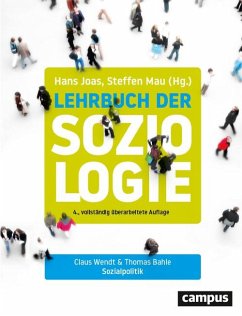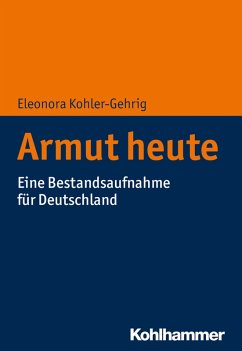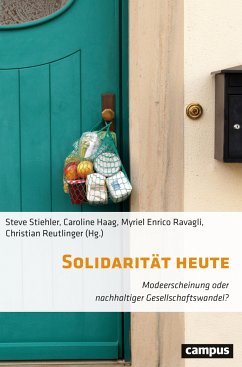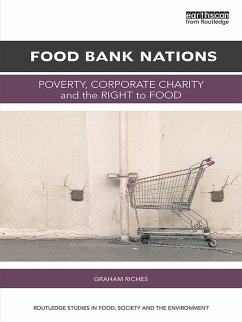PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





In einer einzigartigen Mischung aus Sozialreportage und messerscharfer Gesellschaftsanalyse nimmt Stefan Selke uns mit in die unbekannte Welt der Armen. Er zeichnet das Leben jener Menschen, die einst in der Mitte der Gesellschaft lebten und sich verzweifelt bemühen, ein Stück Normalität zu bewahren.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.34MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Bekannt für fehlende wesentliche Barrierefreiheitsmerkmale
Stefan Selke , *1967, ist Professor an der Hochschule Furtwangen mit dem Lehrgebiet "Gesellschaftlicher Wandel". Im Rahmen seiner Feldforschungen beschäftigt er sich seit 2006 mit der modernen Armenspeisung in Suppenküchen und Tafeln. Er ist Mitgründer des "Kritischen Aktionsbündnisses 20 Jahre Tafeln" (aktionsbuendnis20.de) und als Tafelforscher und öffentlicher Soziologe ein begehrter Gesprächspartner in den Medien.
Produktdetails
- Verlag: Ullstein Taschenbuchvlg.
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 12. April 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783843705394
- Artikelnr.: 37606168
Stefan Beilke kritisiert hier anhand von Beispielen, vor allem aber am Beispiel der Tafeln (aufgrund dessen 20 jährigen Jubiläums), den Umgang unserer sozialen Marktwirtschaft mit Armut. In fünf große Kapitel aufgeteilt nähert sich der Autor seiner Meinung immer mehr an, …
Mehr
Stefan Beilke kritisiert hier anhand von Beispielen, vor allem aber am Beispiel der Tafeln (aufgrund dessen 20 jährigen Jubiläums), den Umgang unserer sozialen Marktwirtschaft mit Armut. In fünf große Kapitel aufgeteilt nähert sich der Autor seiner Meinung immer mehr an, aber bereits im Vorwort wird die Richtung in die er geht klar.
Sachlich und wissenschaftlich geschrieben, ohne dabei den Leser aus dem Auge zu verlieren, schafft es der Autor einen nicht einfachen Stoff, der auch nicht leicht verdaulich ist, gut zu verpacken. Dabei bringt er seine Auffassung detailliert und gut verständlich an den Leser. Vieles davon hat man schon gewusst, aber hier werden einem nochmal alle Gesichtspunkte und deren Auswirkungen vor Augen geführt.
In den Anmerkungen sind die Quellenangaben erfasst, so dass die Grundlagen nachgewiesen sind, auch wenn natürlich die Schlüsse die hieraus gezogen werden durchaus diskutabel sind. Aber hier werden auch immer beide Seiten des „Problems“ betrachtet, was ich sehr angenehme finde, so wird keine Meinung aufgedrängt, auch wenn der Autor seine Meinung zu diesem Thema hat.
Heraus zu heben ist das Kapitel „Der Chor der Tafelnutzer“, wo Stefan Beilke die Stellungsnahmen von vielen verschiedenen Tafelnutzern zusammenfasst, eine wirklich bedrückende Stimmung entsteht und man kann die Tafelnutzer richtig verstehen und lernt die Denkweise zu begreifen. Ebenfalls ist das Kapitel „Trostbrot“ sehr anschaulich, weil hier einige Fälle beschrieben werden, wie Menschen in diese Armut gelangen und wie sie selbst die Chancen ansehen diese wieder zu verlassen. Hier steigt man tief in die Praxis der Hilfe gegen die Armut ein.
Fazit: Ein Buch das sehr nachdenklich stimmt. Manchmal auch unter die Haut geht und dennoch immer dem wissenschaftlichen Ansatz treu bleibt.
Weniger
Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Die Publikation des Sachbuches "Schamland" überschneidet sich interessanterweise mit dem Tod Maggie Thatchers. Die konservative Politikerin war in England als "Eiserne Lady", "Milchräuberin" und Totengräberin der Gewerkschaften bekannt. Ihre rigorose, …
Mehr
Die Publikation des Sachbuches "Schamland" überschneidet sich interessanterweise mit dem Tod Maggie Thatchers. Die konservative Politikerin war in England als "Eiserne Lady", "Milchräuberin" und Totengräberin der Gewerkschaften bekannt. Ihre rigorose, sozial kalte Politik gründete auf der Prämisse, dass es so etwas wie "die Gesellschaft" nicht gebe & dass quasi Jedermann für sein Heil selbst verantwortlich sei ...man fühlt sich an die amerikanische Losung vom "Streben nach Glück" erinnert.
Thatcher stand in Grossbritannien für den sozialen Kahlschlag. Begründete sie den Trend der neoliberalen Politik ? Auf jeden Fall aber gilt sie vielen Analysten als die Person, die "merry old England" zu Grabe trug.
Jahre später sollte sich auch still und leise das Konzept der "sozialen Marktwirtschaft" und "Sozialhilfe" zugunsten von Raubtierkapitalismus und Hartz IV mehr oder weniger aus dem wiedervereinten Deutschland verabschieden. Von der Bonner Republik & katholischer Soziallehre à la Adenauer sollte wenig übrig bleiben.
Doch zurück zu "Schamland".
Diese Publikation hat mich wirklich positiv überrascht. Sie genügt wissenschaftlichen Standards und verfügt über Endnoten. Kein "Blabla" ins Blaue hinein, sondern harte Fakten, für jeden nachvollziehbar!
Der Autor ist Soziologe und lässt seine Forschungen in "Schamland" einfliessen.
Die Gliederung kann mit geistreichen Kapitelüberschriften ("Trostbrot")und kleinen Unterkapiteln überzeugen.
Für eine fast wissenschaftliche Publikation ist "Schamland" ferner extrem gut lesbar! Manchmal quält man sich durch Fachliteratur und Sachbücher ob des knochentrockenen Stils nur so durch. Nicht so hier! Der Autor schreibt pointiert, scharfsinnig und anschaulich.
Ich muss gestehen, dass ich über die "Tafeln" vor der Lektüre ein unkritisches, von Hochglanzmedien und "Charity Ladies" geprägtes Bild hatte.
Selke jedoch stellt den Nutzen der "Tafeln" infrage und zeigt auf, dass diese zu einem System der "Armutsökonomie " gehören. Anhand von Fallbeispielen aus der Feldforschung zeigt er auf, dass in der reichen Industrienation Deutschland mitnichten nur der "Pöbel" arm ist & zur "Tafel" geht: Da gibt es das Studentenpärchen, die Dialysepatientin und auch das ehemalige Unternehmerpärchen, das einst periodisch zum Skilaufen in die Schweiz fuhr, um im Alter mangels Einzahlungen quasi am Hungertuch zu nagen.
Selkes Kernthese besagt, dass das System der "Tafeln" primär sich selbst dient - eine These, die mir einleuchtend erscheint.
Schleichend ist dabei der Prozess, der Aufwendungen der öffentlichen Hand zunehmend privatisiert. Eine Amerikanisierung der Verhältnisse ?
Der Autor behält jedoch durchaus einen scharfen Blick und verfällt nie in Schwarzweissmalerei. Er zeigt auf, mit welchen Mechanismen Armut eher verschlimmert als gemildert wird. Und er redet Tacheles : Armut betrifft mittlerweile alle Gesellschaftsschichten(besser gesagt: auch ehemals scheinbar "krisenfeste" Schichten), Armut generiert Scham.
Selkes Interviewpartner berichten mehr oder weniger einhellig davon, wieviel Überwindung sie der Gang zur "Tafel" kostete und dass sie mit "denen da" eigentlich nicht sprechen wollten. Arm, das seinen die "Anderen". Nur mittels dieser Selbsttäuschung lasse sich ein positives Selbstbild und ein letzter Rest Würde aufrecht erhalten.
Ich muss sagen, dass ich während der Lektüre teils recht überrascht war, da mir viele Sachverhalte unbekannt waren.
Der Wissenschaftler Selke stellt seine Erkenntnisse löblicherweise in Buchform der ganzen deutschen Gesellschaft zur Verfügung. Akademischer Elfenbeinturm? Nicht bei Selke! Ich hoffe nur, dass seine Ausführungen Gehör - sprich Leser - finden werden.
Ein wenig schade finde ich, dass ein vergleichsweise "enges" Themengebiet behandelt wird, denn der Autor hat die seltene Gabe, komplexe Phänomene auch dem Laien verständlich zu erklären. Deshalb gebe ich 4/5 Sternen. Ein exzellentes Sachbuch!
Weniger
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Stefan Selke setzt sich in diesem Sachbuch „Schamland – Die Armut mitten unter uns“ kritisch mit dem Sozialsystem in Deutschland und vor allem dem pseudo-wohltätigen Tafelsystem auseinander.
So geht er in den ersten Kapiteln nunmehr darauf ein, welche seine Beweggründe …
Mehr
Stefan Selke setzt sich in diesem Sachbuch „Schamland – Die Armut mitten unter uns“ kritisch mit dem Sozialsystem in Deutschland und vor allem dem pseudo-wohltätigen Tafelsystem auseinander.
So geht er in den ersten Kapiteln nunmehr darauf ein, welche seine Beweggründe zum Schreiben dieses Buches sind und was ihn antreibt, um dann im Folgenden sehr authentisch und vielseitig Gespräche mit einigen Betroffenen zu schildern. Ferner bildet er auch einen von ihm so genannten „Chor der Tafelnutzer“, in dem er ausschließlich Zitate zu einem zusammenhängendem Text zusammenfügt, sodass man auch aus der „Wir“ - Perspektive noch einmal einen Eindruck von der Situation in der Tafel oder der Armut im Alltag bekommt.
In diesem Teil des Buches wird vor allem erkenntlich, wie sehr die Empfänger von Sozialleistungen mit sich im Zwiespalt stehen, denn zu Einen erkennen sie zwar an, dass sie sich ohne den Gang zur Tafel so manches „Extra“ vielleicht nicht leisten könnten, machen aber zum Anderen auch sehr deutlich, dass sie sich von der Herablassung der „Helfer“ und der allgemeinen Abhängigkeit sehr gedemütigt fühlen. Auch haben mich diese Kapitel eine Menge über das System Tafel gelehrt, von dem ich zwar zuvor schon eine grobe Vorstellung hatte, es mir aber dennoch nicht klar war, wie sehr Menschen dort zu – ich möchte sagen Untermenschen – degradiert werden. Dass einem Menschen ein derart großes Misstrauen entgegengebracht wird, man alles offenlegen und auf generelle Bedürftigkeit geprüft werden muss. Der Autor gibt an dieser Stelle auch ein sehr gutes Zitat wieder:
„Die gehen davon aus, dass der Mensch schlecht ist. Daher muss er kontrolliert werden.“
Insgesamt ein wirklich sehr informatives Kapitel. Abschließend wertet er noch das System Tafel aus, und fasst noch einmal zusammen, warum es denn eigentlich in einem Staat wie Deutschland überflüssig sein sollte.
Alles in allem finde ich hat Stefan Selke hier schon ein sehr gutes Buch geschrieben, dass mich zu großen Teilen echt aufgeregt hat (unsere Politik, nicht der Autor), aber das mich auch zum Teil ein wenig enttäuscht hat, da ich bereits sehr hohe Erwartungen hatte.
Also zum ersten bin ich natürlich schon sehr glücklich, dass sich dem Thema überhaupt mal einer öffentlich so kritisch zuwendet, denn gerade die sozial schwachen Menschen fühlen sich mit ihren Problemen oft alleine gelassen. Ich bin sehr froh, dass Stefan Selke ihnen eine Stimme gegeben hat.
Auch habe ich vieles aus diesen Ausführungen gelernt, was mir vorher nicht so klar war. Denn obwohl ich vorher schon eine ähnliche Meinung vertrat wie der Autor, hat dieser mich nur in meinen Gedanken bestärkt, sodass ich jetzt noch stärker das Gefühl habe, hier läuft etwas so gewaltig falsch, das müssen wir ändern; Vor allem hat sich bei mir ein außerordentlich starkes Bedürfnis entwickelt, andere Menschen davon zu überzeugen, dass nicht jeder Hartz IV Empfänger ein assozialer „Hartzer“ ist. Da viele meiner Mitschüler (10. Klasse) sehr vehement diese Meinung vertreten, hat mich der Autor mit seinem Buch dazu bewegt, in der kommenden Woche die Armut mitten unter uns für mein Deutsch Referat zu thematisieren, da ich das Gefühl habe, diese Problematik ist zu wichtig, um von gerade so jungen Menschen wie uns ignoriert zu werden.
Enttäuscht war ich vor allem davon, wie wenig Lösungsvorschläge Stefan Selke angeführt hat. Denn man kann nicht einfach immer nur rum meckern und die Politiker kritisieren, dass sie alles falschen machen, wenn man selbst keine Lösungsvorschläge vorbringen kann. Das hätte mir als ein abschließendes Kapitel das Buch noch wertvoller gemacht.
Insgesamt gab es auch viele Wiederholungen, sodass sich das Lesen zeitweilig wirklich hinzog und man es hätte deutlich kürzer machen können.
Insgesamt trotzdem ein sehr bewegendes Werk, das mich definitiv weitergebracht und sehr bereichert hat.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Inhalt:
In dem Sachbuch setzt sich der Autor mit dem Thema der Armutsökonomie auseinander.
Er schildert das Thema konsequent aus der Sicht der Armen. Also derjenigen in unserem Land, die auf die Tafeln, Armenküchen und Kleiderkammern angewiesen sind.
Er berichtet, was es für die …
Mehr
Inhalt:
In dem Sachbuch setzt sich der Autor mit dem Thema der Armutsökonomie auseinander.
Er schildert das Thema konsequent aus der Sicht der Armen. Also derjenigen in unserem Land, die auf die Tafeln, Armenküchen und Kleiderkammern angewiesen sind.
Er berichtet, was es für die Betroffenen bedeutet zu den Tafeln zu gehen: Wie beschämend dies ist. Und wie sich diese Scham anfühlt.
Hier spricht der Autor Tacheles.
Ich finde es außerordentlich wichtig, dass der Autor darauf hinweist, dass die Politik gar kein Interesse daran hat, an den derzeitigen Zuständen überhaupt etwas zu ändern.
Denn warum sollte die Politik Geld in die Hand nehmen, um etwas zu verbessern, wenn dies von den karitativen Einrichtungen geleistet wird. Diese Leistungen, die nicht der Staat, sondern karitative Einrichtungen erbringen, sind also in der Politik bereits einkalkuliert.
Deshalb wird von Politiker-Seite lieber alles schön-geredet und keine Änderungen am Status-Quo initiiert. Denn es ist doch viel einfacher die Symptombehandlung der Armut an Tafeln und Kleiderkammern zu delegieren.
Und: Für die Spenderfirmen sind die Tafeln von Vorteil, weil sie damit ihr soziales Image aufpolieren können.
Gut, dass diese Diskussion nun angestoßen wurde (sie war längst überfällig) und dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen wird!
Kritikpunkte am Buch:
Der Autor bietet keine direkten Lösungsvorschläge an.
Der Autor fühlt sich sehr den Armen verpflichtet; d.h. er stellt das Thema konsequent aus ihrer Sicht dar (was natürlich legitim ist); was aber dafür andere Gesichtspunkte (wie die der ehrenamtlichen Helfer) außen vor lässt.
Mich hätte auch interessiert, wie sich die Tafeln finanzieren. Denn er beschreibt ja, dass die Tafeln im Grunde nur Logistiker sind, die Lebensmittel von A nach B transportieren. Aber können die ganzen Kosten (wie Fuhrpark und Benzin) von dem obligatorischen Euro der "Kunden" gedeckt werden?!
Fazit: Aber ein wertvolles und wichtiges Buch.
Hoffentlich lesen die Organisatoren der Tafeln sowie deren Unterstützer dieses Buch.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Wenn man dieses Buch liest, bleibt es nicht aus, dass man über sein eigenes Konsumverhalten nachdenkt.
Es kann heute so schnell gehen, dass man ohne Schuld verarmt. Es ist schlimm, immer nachdenken zu müssen, was man einkaufen kann und was nicht und trotzdem zu wissen, dass es am Ende …
Mehr
Wenn man dieses Buch liest, bleibt es nicht aus, dass man über sein eigenes Konsumverhalten nachdenkt.
Es kann heute so schnell gehen, dass man ohne Schuld verarmt. Es ist schlimm, immer nachdenken zu müssen, was man einkaufen kann und was nicht und trotzdem zu wissen, dass es am Ende wieder nicht reichen wird. Wenn man dann die Tafeln in Anspruch nimmt, bleibt von Menschenwürde nicht viel übrig.
Es ist ganz klar, dass die Tafeln und ähnliche Organisationen die Probleme nicht an der Wurzel packen, sondern nur die Symptome behandeln. Das aber führt dazu, dass die Politik nicht eingreifen muss: Es funktioniert ja irgendwie.
Das Buch bietet keine Lösungsvorschläge, zeigt die Probleme nur aus einer Sicht. Hier kommen nur Betroffene zu Wort, die auf Tafeln zurückgreifen müssen. Die ehrenamtlichen Helfer kommen nicht zu Wort, sie werden teilweise als Egoisten beschrieben.
Obwohl das Buch also das Ganze ziemlich einseitig schildert, bietet es trotzdem eine gute Grundlage, sich mehr Gedanken zu machen.
Weniger
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Wer an die 'Tafeln' denkt, dem fällt zumeist eines ein: Gemeinnützig! Ehrenamtliche verteilen stark verbilligt Lebensmittel an Arme, die der Tafel zuvor gespendet wurden. Eine gute und sinnvolle Idee - wer würde etwas Schlechtes dagegen sagen oder schreiben wollen? Stefan Selke zum …
Mehr
Wer an die 'Tafeln' denkt, dem fällt zumeist eines ein: Gemeinnützig! Ehrenamtliche verteilen stark verbilligt Lebensmittel an Arme, die der Tafel zuvor gespendet wurden. Eine gute und sinnvolle Idee - wer würde etwas Schlechtes dagegen sagen oder schreiben wollen? Stefan Selke zum Beispiel, Soziologieprofessor und Autor dieses Buches, der schon früher die These aufstellte, dass Angebote wie die Tafeln Armut nicht versuchen zu beseitigen, sondern statt dessen festschreiben. Auch in seinem neuen Werk ist dies das Hauptthema. Er besucht Nutzerinnen und Nutzer dieser Wohlfahrtsangebote, fragt nach, wie es dazu kam und wie es ihnen dabei geht. Es sind ganz unterschiedliche Personen, die er da trifft: eine studentische Kleinfamilie, eine chronisch kranke Frau die noch nicht aufgegeben hat aus diesem System auszubrechen, ein chronisch krankes Rentnerehepaar, die sich in diesem Dasein jetzt mehr schlecht als recht eingerichtet haben. Alle eint sie, dass sie diese Angebote eigentlich nicht wollen, aber aufgrund ihrer Verhältnisse müssen, weil es keinen anderen Weg gibt.
Selke beschreibt nicht nur Zustände, er schildert auch detailliert wie sich der Umgang mit Armen im Laufe der Geschichte verändert hat: von der Entwicklung der reinen Almosenempfänger im alten Griechenland wie auch im Mittelalter, die sich glücklich schätzen durften zu den 'guten' Bedürftigen gezählt zu werden und somit die Gnade von Zuwendungen zu erfahren bis hin zu gleich- UND anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in der Gegenwart durch das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip (Art. 20, Abs. 1). Doch diese Entwicklung scheint sich wieder in ihr Gegenteil umzukehren: Ansprüche werden auf ein solches Mindestmaß reduziert, dass Berechtigte gezwungen sind, Angebote von Almosen (und nichts anderes sind Tafeln und weitere Institutionen der Armutsökonomie ja) anzunehmen. Statt Betroffenen zu helfen aus diesen Problemsituationen wieder herauszukommen, wird selbst vom Staat Armut als akzeptabler Dauerzustand dargestellt, der ja durch die vielfältigen (und immer wieder lobend erwähnten wie auch kräftig unterstützten) Freiwilligenangebote durchaus erträglich ist. Was jedoch passiert, wenn (aus welchen Motiven auch immer) sich die Anbieter solcher freiwilligen Dienstleistungen irgendwann zurückziehen, wird aus naheliegenden Gründen nicht thematisiert. Für die Empfangenden, die sich dieser Problematik durchaus bewusst sind, ist dies ein schrecklicher Zustand: nicht nur die Verhältnisse an sich sondern auch die Tatsache, abhängig zu sein vom Wohlwollen einiger Weniger.
Selke vergisst auch nicht aufzuzeigen, dass Armut neben den direkten Kosten (die konkrete finanzielle Unterstützung) auch eine Reihe weiterer Kosten entstehen lässt, die sich nicht nur in Zahlen darstellen lassen. Berufliche Kompetenzen gehen verloren, größere Aufwendungen durch Krankheit, Demokratiedefizite entstehen...
Wer sich konkrete Lösungsvorschläge erhofft, um eine Besserung dieser Situation herbeizuführen, findet diese nur indirekt. Diejenigen, die noch arbeiten können, möchten eine Beschäftigung von der sie auch leben können - eine klare Absage an PolitikerInnen, die gegen Mindestlöhne sind und weiterhin eine Förderung von Mini-, 1-Euro-Jobs, befristeten Beschäftigungen und dergleichen unterstützen. Andere wie Kranke, Rentner, Alleinerziehende eint der Wunsch, nicht als BittstellerInnen auftreten zu müssen - das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Frühjahr 2010 war ein Schritt in diese Richtung, dem jedoch weitere bisher nicht folgten.
Selkes Verdienst ist es, einer großen Gruppe der Gesellschaft eine Stimme gegeben zu haben, die bisher aus Scham lieber schwieg und sich versteckte. Und trotz seines Status als Soziologieprofessor ist sein Buch gut lesbar und ebenso verständlich - und ganz und gar nicht 'sehr fachlich und wissenschaftlich' wie in einer Rezension vermerkt. Es bleibt zu hoffen, dass viele viele Menschen dieses Buch lesen - und sich etwas bewegt!
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für