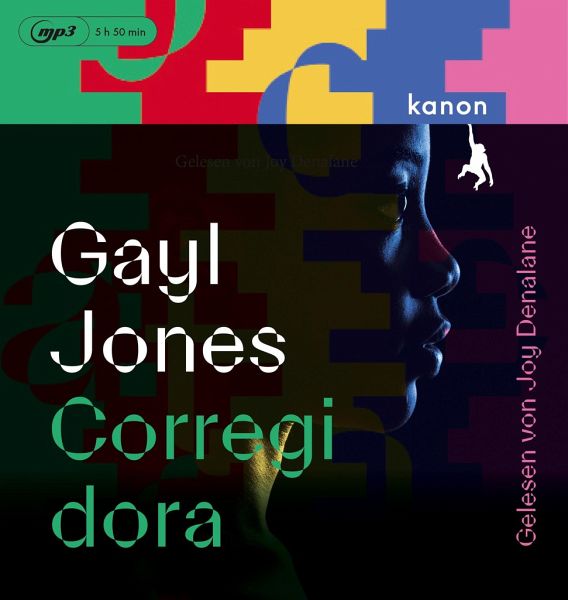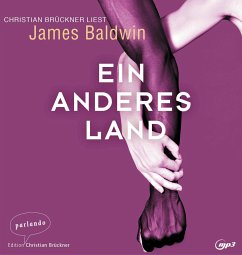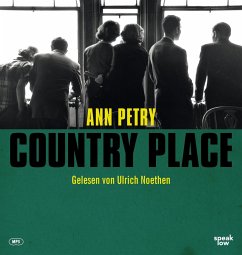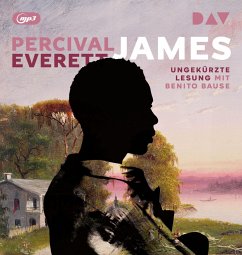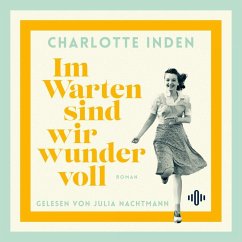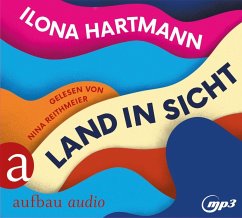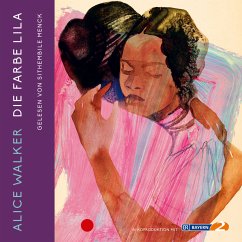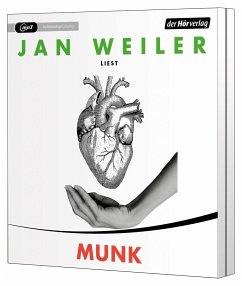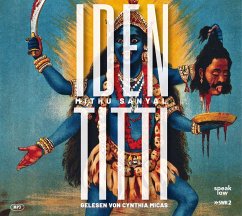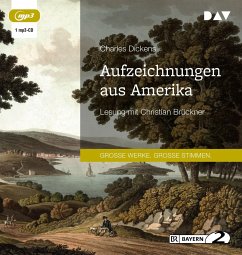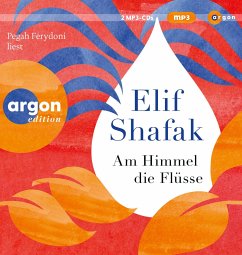Gayl Jones
MP3-CD
Corregidora
Roman. Ungekürzte Lesung (1 MP3-CD). 351 Min.
Übersetzung: Biermann, Pieke;Gesprochen: Denalane, Joy
Sofort lieferbar
Statt: 23,00 €**
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!





Die größte vergessene Schriftstellerin Amerikas!Kentucky 1947: Jeden Abend singt Ursa in Happy's Café den Blues. Die Männer hängen an ihren Lippen. Denn Ursas Gesang handelt vom Schmerz und vom Bösen. Er gilt Corregidora, einem Sklavenhalter des vergangenen Jahrhunderts, der gleichzeitig ihr Großvater und Urgroßvater ist. Diesen Fluch muss Ursa überwinden. Nur wenn sie in ihrem Takt singt, wenn sie auf ihre Art liebt, wenn sie endlich zu sich kommt, kann sie Corregidora bannen. - Ein zutiefst ergreifender Roman über die Schmach des amerikanischen Erbes und die Sehnsucht nach Selbstbe...
Die größte vergessene Schriftstellerin Amerikas!Kentucky 1947: Jeden Abend singt Ursa in Happy's Café den Blues. Die Männer hängen an ihren Lippen. Denn Ursas Gesang handelt vom Schmerz und vom Bösen. Er gilt Corregidora, einem Sklavenhalter des vergangenen Jahrhunderts, der gleichzeitig ihr Großvater und Urgroßvater ist. Diesen Fluch muss Ursa überwinden. Nur wenn sie in ihrem Takt singt, wenn sie auf ihre Art liebt, wenn sie endlich zu sich kommt, kann sie Corregidora bannen. - Ein zutiefst ergreifender Roman über die Schmach des amerikanischen Erbes und die Sehnsucht nach Selbstbehauptung.Gayl Jones' Roman»Corregidora«ist ein Klassiker der afroamerikanischen Literatur. Am Beispiel der Blues-Sängerin Ursa erzählt er von den generationsübergreifenden Traumatisierungen des Gewaltsystems der Versklavung. Entdeckt und veröffentlicht wurde dieser bahnbrechende Roman in den USA von Toni Morrison im Jahr 1975. Danach könne kein Roman über eine Schwarze Frau mehr sein wie vorher, sagtedie spätere Nobelpreisträgerin. Denn Gayl Jones hat das Unfassbare in Worte gefasst.Fast 50 Jahre später erscheint»Corregidora«nun auf Deutsch in der Übersetzung von Pieke Biermann im Kanon Verlag. Verlag und Übersetzerin sind sich der großen Herausforderung und Verpflichtung bewusst, die mit der Neuveröffentlichung eines "Slave Narratives" im heutigen Kontext einhergehen. Kritisch wurde etwa hinterfragt, ob rassistisches Vokabular wiederverwendet werden muss, da es retraumatisierend auf Betroffene wirken kann und keinesfalls im täglichen Sprachgebrauch reproduziert werden sollte. Gewissenhaft wurde letztlich entschieden, einige abwertende Begriffe wiederzugeben oder im englischen Original zu belassen. Pieke Biermanns Übersetzung gibt die brutale Sprache eines ganzen Jahrhunderts wieder. Das ist mitunter schwer erträglich, in seiner Intensität aber Zeugnis einer klaren Haltung gegenüber der Geschichte: Sie darf nicht vergessen werden.
Gayl Jones wurde 1949 in Kentucky geboren, wo sie auch heute noch zurückgezogen lebt. Sie hat am Wellesley College und der University of Michigan gelehrt. Corregidora ist ihr erster Roman, der 1975 in den USA erschien. Ihr zweiter Roman Evas Mann aus dem Jahr 1976 wird 2023 im Kanon Verlag erscheinen.
Produktdetails
- Verlag: Kanon, Berlin
- Originaltitel: Corregidora
- Gesamtlaufzeit: 351 Min.
- Erscheinungstermin: 22. August 2022
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783985680412
- Artikelnr.: 63786414
Herstellerkennzeichnung
Kanon Verlag Berlin GmbH
Nicolaistraße 27
12247 Berlin
info@kanon-verlag.de
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.12.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.12.2022Hass ist von solcher Liebe nicht zu trennen
Nach fast einem halben Jahrhundert kommt ein zentraler Roman schwarzer Selbstvergewisserung auf Deutsch: "Corregidora" von Gayl Jones
Gayl Jones wurde 1949 in Kentucky geboren. Ihr Debütroman "Corregidora", 1975 in den Vereinigten Staaten erschienen und jetzt endlich auch auf Deutsch, setzt im Jahr 1948 ein und beginnt mit einem Sturz. Die fünfundzwanzigjährige Icherzählerin Ursa, so alt wie ihre Autorin bei der Niederschrift des Romans, kann sich danach zwar nicht erinnern, wie sie gestürzt ist, doch es geschah bei einem Eifersuchtsanfall ihres frisch angetrauten Ehemanns Mutt. Ein paar Seiten später unterhält sich Ursa mit Cat, ihrer besten Freundin, über das Ereignis.
Nach fast einem halben Jahrhundert kommt ein zentraler Roman schwarzer Selbstvergewisserung auf Deutsch: "Corregidora" von Gayl Jones
Gayl Jones wurde 1949 in Kentucky geboren. Ihr Debütroman "Corregidora", 1975 in den Vereinigten Staaten erschienen und jetzt endlich auch auf Deutsch, setzt im Jahr 1948 ein und beginnt mit einem Sturz. Die fünfundzwanzigjährige Icherzählerin Ursa, so alt wie ihre Autorin bei der Niederschrift des Romans, kann sich danach zwar nicht erinnern, wie sie gestürzt ist, doch es geschah bei einem Eifersuchtsanfall ihres frisch angetrauten Ehemanns Mutt. Ein paar Seiten später unterhält sich Ursa mit Cat, ihrer besten Freundin, über das Ereignis.
Mehr anzeigen
Als Cat es als Unfall bezeichnet, lautet Ursas Antwort: "Du klingst, wie wenn er hier sitzt, genau das würd er sagen. Oach, Süße, ich war betrunken. Oach, Süße, das warn Unfall. Das wollt ich ja gar nicht. Hätt ich doch nie getan, weißt du doch." Bei dem Sturz hat Ursa innere Verletzungen erlitten, die die Entfernung ihrer Gebärmutter erforderten. Und mutmaßlich hat sie auch ein Kind verloren, mit dem sie schwanger war. Das deutet der Roman nur an. Aber die Tatsache, dass der handlungsauslösende Sturz und die Geburt der Autorin in enger zeitlicher Nachbarschaft stehen, ist bedeutsam.
Der Roman heißt "Corregidora". Das ist der Familienname von Ursa, deren familiäre Herkunft gewaltgeprägt ist. Der Urgroßvater, dessen Namen sie trägt, war aus Portugal nach Brasilien gegangen und dort als Plantagenbesitzer zu Reichtum gekommen. Unter seinen Sklavinnen befand sich Ursas Urgroßmutter, die von Corregidora erst zur Prostituierten und dann zu seiner eigenen Favoritin gepresst worden war. Auch die gemeinsame Tochter wurde vom Vater vergewaltigt und floh, nun selbst schwanger, in die Vereinigten Staaten. Dort kam Ursas Mutter zur Welt, abermals ein Kind von Corregidora, der seinen Zugriff auf die von ihm begehrten Frauen selbst aus der Ferne nicht lockerte; auch Ursa sieht sich noch mit ihm konfrontiert, wenn auch nur in den Erzählungen ihrer Vorfahren, die, kursiv abgesetzt, wie böse Albträume ihren Bericht vom eigenen Schicksal durchsetzen. Denn jede Frau hat der jeweiligen Tochter und deren Tochter erzählt, was ihr angetan worden ist, damit die Erinnerung an all die erlittenen Grausamkeiten nicht verloren geht. Deshalb ist Fortpflanzung Pflicht für die Corregidora-Frauen. "Generationen machen" lautet ihre immer weitergegebene Erwartung - der Ursa nach dem Sturz aber nicht mehr gerecht werden kann.
Dieses Trauma des Traditionsabbruchs ist jedoch zugleich eine Befreiung aus dem Bann des Dämons Corregidora und des Hasses gegen ihn. Der Roman "Corregidora" ist doppeldeutig in vielerlei Hinsicht: im Titel natürlich schon, denn der Name steht eben nicht nur für Ursa, sondern genauso für den Vergewaltiger und Menschenschinder wie für dessen Zwangsgeliebte. Und jegliche Liebe im Roman ist durchdrungen von Hass. So hat die Mutter von Ursa ihr einmal davon erzählt, dass sie mit ihrem amerikanischen Geliebten zunächst nicht schlafen mochte, bis der sie fragte, was sie sich nie zu fragen getraut habe: "Was daran Hass auf Corregidora war und was Liebe."
An der Anklage, die Gayl Jones mit ihrem Roman erhebt, gibt es indes keinen Zweifel: Ihre Ursa ist eine Symbolfigur durch und durch, nicht nur der phonetischen Verwandtschaft ihres Vornamens mit den USA wegen, sondern auch durch die erzwungene Kinderlosigkeit, die ihr auferlegt, eine andere Form der Gewaltbewältigung zu finden. Die selbst nicht der Gewalt komplett entsagen kann. Dass es zum Finale nach jahrelanger Trennung ausgerechnet wieder Mutt ist, von dem sie sich nach dem "Unfall" hatte scheiden lassen, mit dem Ursa zusammenkommt, ist ein unheimlich anmutendes Handlungsmoment, aber eines, das konsequent zu Ende gedacht ist: Hass ist von Liebe nicht zu trennen, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat wie die vier Corregidora-Frauen. In einem Liebesakt, der von Jones wie ein Wechselgesang inszeniert ist, wiederholt Ursa auf die mehrfache Bemerkung Mutts, er wolle keine Frau, die einem wehtut, immer nur: "Dann willst du mich nicht." Aber natürlich will er sie. Und sie will ihn auch.
Es ist die Sprache des Blues, derer sich Jones immer wieder bedient: explizit wie im Schema des call & reponse bei diesem Schlussdialog und auch schon diverser Erzählpassagen zuvor und implizit durch die Profession von Ursa: Sie ist Sängerin. Und die Liebe zur Musik, die Bewunderung für Della Reese, Ella Fitzgerald und vor allem Billie Holiday, führt sie und Mutt schließlich wieder zusammen. Dieser Roman ist wie ein großer Klagegesang, der aber gerade dadurch Trost bereithält, dass er erklingt. Das unterscheidet Jones' "Corregidora" von den zwei Generationen älteren Romanen der Harlem Renaissance als erster erfolgreichen Artikulation einer eigenständigen schwarzen Literatur in den Vereinigten Staaten. Gayl Jones erzählt nicht nur von ihrer schwarzen Herkunftswelt, sie erzählt - literarisch transponiert - auch in deren eigener Ausdrucksform.
Wie kann man dafür eine deutsche Stimme finden? Pieke Biermann hatte es 2020 mit dem Roman "Oreo" von Fran Ross vorgemacht, für dessen Übersetzung sie den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, und mit "Corregidora" liefert sie jetzt ihr Meisterstück ab. In einem zehnseitigen Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel "This is (not) a love-song" beschreibt sie Jones' und damit auch die eigene Vorgehensweise auf der Suche nach einer literarischen Bluesstimme, und was besonders beeindruckt an dieser Selbstauskunft, ist, dass Biermann sich gar nicht erst aufhält mit identitätspolitischen Fragen wie etwa der nach der Übertragung des von Jones in wörtlicher (schwarzer) Figurenrede gebrauchten Wortes "Nigger" oder auch nach der Berechtigung einer weißen Übersetzerin, sich dieses Textes anzunehmen. Das Resultat spricht jeweils für sich.
Auch verliert sie kein Wort über die vielfältigen Kontroversen, die Gayl Jones in ihrer Heimat mit wenig kompromissbereitem Auftreten in den Jahrzehnten nach Erscheinen von "Corregidora" ausgelöst hat. Denn auch das tut in der Tat nichts zur Sache dieses Romans, und über ihn gibt es noch weitaus mehr zu sagen, als Pieke Biermann es tut. Fertig wird man mit ihm nicht werden; zu sehr rührt die Verwundbarkeit seiner Hauptfigur an Erfahrungen, die hier nicht nur nachvollziehbar, sondern geradezu spürbar dargeboten sind. Ungeachtet der exakten zeitlichen Einordnung des Geschehens in die späten Vierziger- bis späten Sechzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts und einer eindeutigen Situierung ins nie namentlich genannte, aber klar erkennbare Lexington, Kentucky, den Heimatort von Jones, leistet "Corregidora" das, was nur ganz große Literatur vermag: Allgemeingültigkeit über Zeit und Raum hinweg zu vermitteln. Nicht einmal ein solcher Spaß der Verfasserin wie ihr Einwurf: "Heute tragen ja alle Shaft-Mäntel. Er hatte damals bestimmt seinen Dick-Tracy-Mantel an", der uns Leser für einen Augenblick aus der Handlungs- in die Schreibzeit entführt, ist ohne Hintersinn. Denn dieser im Buch einmalige Verweis aufs Erleben der Verfasserin verbindet sie mit der Erzählerin. Und macht Gayl Jones zu jener Generation, die ihre Ursa nicht mehr hat gebären können. Erzählt vom Leid wird trotzdem weiter. ANDREAS PLATTHAUS
Gayl Jones: "Corregidora". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann. Kanon Verlag, Berlin 2022.
222 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der Roman heißt "Corregidora". Das ist der Familienname von Ursa, deren familiäre Herkunft gewaltgeprägt ist. Der Urgroßvater, dessen Namen sie trägt, war aus Portugal nach Brasilien gegangen und dort als Plantagenbesitzer zu Reichtum gekommen. Unter seinen Sklavinnen befand sich Ursas Urgroßmutter, die von Corregidora erst zur Prostituierten und dann zu seiner eigenen Favoritin gepresst worden war. Auch die gemeinsame Tochter wurde vom Vater vergewaltigt und floh, nun selbst schwanger, in die Vereinigten Staaten. Dort kam Ursas Mutter zur Welt, abermals ein Kind von Corregidora, der seinen Zugriff auf die von ihm begehrten Frauen selbst aus der Ferne nicht lockerte; auch Ursa sieht sich noch mit ihm konfrontiert, wenn auch nur in den Erzählungen ihrer Vorfahren, die, kursiv abgesetzt, wie böse Albträume ihren Bericht vom eigenen Schicksal durchsetzen. Denn jede Frau hat der jeweiligen Tochter und deren Tochter erzählt, was ihr angetan worden ist, damit die Erinnerung an all die erlittenen Grausamkeiten nicht verloren geht. Deshalb ist Fortpflanzung Pflicht für die Corregidora-Frauen. "Generationen machen" lautet ihre immer weitergegebene Erwartung - der Ursa nach dem Sturz aber nicht mehr gerecht werden kann.
Dieses Trauma des Traditionsabbruchs ist jedoch zugleich eine Befreiung aus dem Bann des Dämons Corregidora und des Hasses gegen ihn. Der Roman "Corregidora" ist doppeldeutig in vielerlei Hinsicht: im Titel natürlich schon, denn der Name steht eben nicht nur für Ursa, sondern genauso für den Vergewaltiger und Menschenschinder wie für dessen Zwangsgeliebte. Und jegliche Liebe im Roman ist durchdrungen von Hass. So hat die Mutter von Ursa ihr einmal davon erzählt, dass sie mit ihrem amerikanischen Geliebten zunächst nicht schlafen mochte, bis der sie fragte, was sie sich nie zu fragen getraut habe: "Was daran Hass auf Corregidora war und was Liebe."
An der Anklage, die Gayl Jones mit ihrem Roman erhebt, gibt es indes keinen Zweifel: Ihre Ursa ist eine Symbolfigur durch und durch, nicht nur der phonetischen Verwandtschaft ihres Vornamens mit den USA wegen, sondern auch durch die erzwungene Kinderlosigkeit, die ihr auferlegt, eine andere Form der Gewaltbewältigung zu finden. Die selbst nicht der Gewalt komplett entsagen kann. Dass es zum Finale nach jahrelanger Trennung ausgerechnet wieder Mutt ist, von dem sie sich nach dem "Unfall" hatte scheiden lassen, mit dem Ursa zusammenkommt, ist ein unheimlich anmutendes Handlungsmoment, aber eines, das konsequent zu Ende gedacht ist: Hass ist von Liebe nicht zu trennen, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat wie die vier Corregidora-Frauen. In einem Liebesakt, der von Jones wie ein Wechselgesang inszeniert ist, wiederholt Ursa auf die mehrfache Bemerkung Mutts, er wolle keine Frau, die einem wehtut, immer nur: "Dann willst du mich nicht." Aber natürlich will er sie. Und sie will ihn auch.
Es ist die Sprache des Blues, derer sich Jones immer wieder bedient: explizit wie im Schema des call & reponse bei diesem Schlussdialog und auch schon diverser Erzählpassagen zuvor und implizit durch die Profession von Ursa: Sie ist Sängerin. Und die Liebe zur Musik, die Bewunderung für Della Reese, Ella Fitzgerald und vor allem Billie Holiday, führt sie und Mutt schließlich wieder zusammen. Dieser Roman ist wie ein großer Klagegesang, der aber gerade dadurch Trost bereithält, dass er erklingt. Das unterscheidet Jones' "Corregidora" von den zwei Generationen älteren Romanen der Harlem Renaissance als erster erfolgreichen Artikulation einer eigenständigen schwarzen Literatur in den Vereinigten Staaten. Gayl Jones erzählt nicht nur von ihrer schwarzen Herkunftswelt, sie erzählt - literarisch transponiert - auch in deren eigener Ausdrucksform.
Wie kann man dafür eine deutsche Stimme finden? Pieke Biermann hatte es 2020 mit dem Roman "Oreo" von Fran Ross vorgemacht, für dessen Übersetzung sie den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, und mit "Corregidora" liefert sie jetzt ihr Meisterstück ab. In einem zehnseitigen Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel "This is (not) a love-song" beschreibt sie Jones' und damit auch die eigene Vorgehensweise auf der Suche nach einer literarischen Bluesstimme, und was besonders beeindruckt an dieser Selbstauskunft, ist, dass Biermann sich gar nicht erst aufhält mit identitätspolitischen Fragen wie etwa der nach der Übertragung des von Jones in wörtlicher (schwarzer) Figurenrede gebrauchten Wortes "Nigger" oder auch nach der Berechtigung einer weißen Übersetzerin, sich dieses Textes anzunehmen. Das Resultat spricht jeweils für sich.
Auch verliert sie kein Wort über die vielfältigen Kontroversen, die Gayl Jones in ihrer Heimat mit wenig kompromissbereitem Auftreten in den Jahrzehnten nach Erscheinen von "Corregidora" ausgelöst hat. Denn auch das tut in der Tat nichts zur Sache dieses Romans, und über ihn gibt es noch weitaus mehr zu sagen, als Pieke Biermann es tut. Fertig wird man mit ihm nicht werden; zu sehr rührt die Verwundbarkeit seiner Hauptfigur an Erfahrungen, die hier nicht nur nachvollziehbar, sondern geradezu spürbar dargeboten sind. Ungeachtet der exakten zeitlichen Einordnung des Geschehens in die späten Vierziger- bis späten Sechzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts und einer eindeutigen Situierung ins nie namentlich genannte, aber klar erkennbare Lexington, Kentucky, den Heimatort von Jones, leistet "Corregidora" das, was nur ganz große Literatur vermag: Allgemeingültigkeit über Zeit und Raum hinweg zu vermitteln. Nicht einmal ein solcher Spaß der Verfasserin wie ihr Einwurf: "Heute tragen ja alle Shaft-Mäntel. Er hatte damals bestimmt seinen Dick-Tracy-Mantel an", der uns Leser für einen Augenblick aus der Handlungs- in die Schreibzeit entführt, ist ohne Hintersinn. Denn dieser im Buch einmalige Verweis aufs Erleben der Verfasserin verbindet sie mit der Erzählerin. Und macht Gayl Jones zu jener Generation, die ihre Ursa nicht mehr hat gebären können. Erzählt vom Leid wird trotzdem weiter. ANDREAS PLATTHAUS
Gayl Jones: "Corregidora". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann. Kanon Verlag, Berlin 2022.
222 S., geb., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Nach Corregidora wird kein Roman über eine Schwarze Frau jemals so sein wie zuvor." Toni Morrison
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Tief beeindruckt ist Rezensent Andreas Platthaus von dem nun endlich in deutscher Übersetzung erscheinenden Roman "Corregidora" von Gayl Jones. Jones ist schwarz, wie auch ihre Protagonistin Ursa, die von ihrem Ehemann Mutt verprügelt wird und ihr Kind verliert. Doch das ist nicht das einzige Trauma, das sich in ihrer Biografie verbirgt, wie der Rezensent verrät: Der Urgroßvater, dessen Namen sie und das Buch tragen, vergewaltigte seine Sklavinnen und zeugte mit ihnen Kinder. Die brutale Geschichte ihrer Herkunft wird von Generation zu Generation weitergegeben, nun aber zwangsläufig durch Ursa unterbrochen, die wegen der Schläge ihres Mannes, zu dem sie nach Jahren der Trennung letztlich doch wieder zurückkehrt, keine Kinder mehr bekommen kann, lesen wir. Platthaus lobt den herausragenden musikalischen Sound, der sich sowohl durch den Rhythmus der Sprache von Jones als auch die vielen Verweise und Anlehnungen an den Blues bemerkbar macht, und dem deutschen Publikum durch die kongeniale Übersetzung von Pieke Biermann zugänglich gemacht wird, wie er besonders hervorhebt. Der Kritiker ist tief beeindruckt von der "Allgemeingültigkeit" dieser Erzählung über Trauma und Gewalt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
eBook, ePUB
Corregidora hieß der portugiesische Sklavenhalter, der bereits Ursas Urgroßmutter zur Prostitution zwang. Er zeugte sowohl ihre Großmutter als auch ihre Mutter, nach Abschaffung der Sklaverei werden Unterlagen vernichtet, um die brutalen Methoden zu vertuschen, doch die …
Mehr
Corregidora hieß der portugiesische Sklavenhalter, der bereits Ursas Urgroßmutter zur Prostitution zwang. Er zeugte sowohl ihre Großmutter als auch ihre Mutter, nach Abschaffung der Sklaverei werden Unterlagen vernichtet, um die brutalen Methoden zu vertuschen, doch die traumatische Vergangenheit wird innerhalb der Familie weiter vererbt, Ursa soll "Generationen machen", damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät - doch sie kann keine Kinder bekommen und äußert ihre Emotionen in dem Blues, den sie jeden Abend im Happy´s Café singt.
"Corregidora" von Gayl Jones ist ein Buch, mit dem ich trotz des wichtigen Themas ziemlich zu kämpfen hatte, der sperrige Schreibstil und die Sprünge zwischen den Szenen haben es mir nicht leicht gemacht, einen emotionalen Zugang zu Ursa und ihrer Geschichte zu finden. Es sind recht kleine Abschnitte, die die Verletzungen der einst versklavten Frauen durch Corregidora zum Ausdruck bringen, doch zwischen aktuellen Passagen aus Ursas Leben, wiederholen sich ständig die Erinnerungen an den verhassten Sklavenhalter, dessen Namen Ursa weiterhin trägt, auch als sie heiratet behält sie den portugiesischen Familiennamen bei.
Zwischenzeitlich verschwimmen die Grenzen zwischen den vier Generationen der Frauen, es scheint, als ob Corregidoras Opfer eine Art kollektives Gedächtnis entwickeln, um für seine Taten Zeugnis abzulegen.
Zweifelsohne hat die Autorin ein wichtiges Zeitdokument geschaffen, das in teilweise brutaler Ausdrucksweise eine Vergangenheit ans Licht zerrt, die das Trauma ganzer Generationen ehemaliger Sklaven widerspiegelt. Wer den Blues im Blut hat, mag dieses Buch intuitiv verstehen und entsprechend wertschätzen, mir hat sich die eigenwillige Erzählweise, die von Wiederholungen und zeitlichen Sprüngen geprägt war, während des Lesens nicht wirklich erschlossen. Erst das Nachwort des Übersetzers, der den Schreibstil mit der musikalischen Darstellung des Blues vergleicht, konnte mein Verständnis für die zäh empfundene Lektüre etwas verbessern.
Fazit: Der sperrige und sprunghafte Schreibstil hat es für mich schwierig gestaltet, emotional in die Geschichte einzutauchen, dennoch betrachte ich dieses Buch als wichtiges Zeugnis einer Vergangenheit, die Generationen ehemalige Sklaven traumatisiert hat.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
1975 erstmals erschienen, spielt der Roman Corregidora von Gayl Jones im Kentucky des Jahres 1947.
Doch das Trauma, von dem dieses Buch erzählt, beginnt weit früher. Corregidora, Plantagenbesitzer & Sklaventreiber, zwingt Ursas Urgroßmutter zur Prostitution. Daran gewöhnt, …
Mehr
1975 erstmals erschienen, spielt der Roman Corregidora von Gayl Jones im Kentucky des Jahres 1947.
Doch das Trauma, von dem dieses Buch erzählt, beginnt weit früher. Corregidora, Plantagenbesitzer & Sklaventreiber, zwingt Ursas Urgroßmutter zur Prostitution. Daran gewöhnt, sich selbst immer zu nehmen, was er will, schwängert er sie: Ursas Großmutter wird geboren. Und damit beginnt ein Trauma, welches sich über Generationen erstreckt, schwängert Corregidora doch auch Ursas Großmutter, also somit seine eigene Tochter.
Damit diese schreckliche Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, nachdem Corregidora nach der Abschaffung der Sklaverei alle Dokumente & Unterlagen verbrannte, soll auch Ursa Kinder bekommen, „Generationen machen“ nennen es die Frauen, die Ursa diese Geschichte wieder & wieder erzählen.
Aber nach einem Streit mit ihrem Ehemann, woraufhin Ursa sogar ins Krankenhaus muss, kann sie keine Kinder mehr bekommen. Darum erzählt die Sängerin ihre Geschichte auf der Bühne: Verpackt in den Blues zeigt Ursa ihr Trauma & auch das der Generationen vor ihr. Doch auch ihr Leben abseits der Bühne sieht nicht viel besser aus: Geprägt von Gewalt & Erniedrigung, eine nicht enden wollende Abwärtsspirale an Emotionen, so sehen Ursas Tage aus, vor allem innerhalb ihrer Partnerschaften.
Der Roman ist alles andere als leichte Kost, weder inhaltlich (was jeder Person klar sein sollte) noch stilistisch. Dass die Themen schwierig sind, voller negativer Emotionen, ist offensichtlich: Es geht um Rassismus, um Gewalt, um Sklaverei, die daraus resultierenden Traumata & den kläglichen Versuch der eigenen Identitätsfindung. Der Stil ist derb, die Gespräche meist knapp gehalten & plump. Kombiniert mit den zeitlichen Sprüngen im Buch wird dadurch die Negativität, die Verzweiflung, zum Teil die Resignation als Ausdruck dessen genutzt, was häufig noch immer Alltag nachfolgender Generationen ehemaliger Sklaven ist. Ist Zeiten der #Blacklivesmatters-Bewegung & dem immer noch täglich bestehenden Kampf vieler BIPoC ist es kein Wunder, dass der Roman ein Klassiker der Afroamerikanischen Literatur ist.
Und das zu Recht, behandelt die Geschichte doch Themen, welche mit der vollen Kraft & ungeschönt noch immer & auch für immer erzählt werden sollten, damit sie irgendwann, eines Tages, vielleicht doch nur noch Teil einer traurigen Vergangenheit sind
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Gewalt und Schmerz
"Corregidora" von Gayl Jones ist ein Buch über Gewalt, über Missbrauch und Sklaverei, über Selbstbestimmung, Rassismus und auch über die Rolle der Frau.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht Ursa, aber auch die Generationen von Frauen vor ihr, die in …
Mehr
Gewalt und Schmerz
"Corregidora" von Gayl Jones ist ein Buch über Gewalt, über Missbrauch und Sklaverei, über Selbstbestimmung, Rassismus und auch über die Rolle der Frau.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht Ursa, aber auch die Generationen von Frauen vor ihr, die in Sklaverei lebten und teilweise von dem selben Mann, Corrergidora, missbraucht und sogar gezeugt wurden. Die Sklaverei ist vorüber und soll in den Köpfen der Frauen weiterleben, um das Unrecht und die Schmach nicht vergessen zu machen, und so von Generation zu Generation weitergegeben.
Ursa ist jetzt die letzte, sie wird keine Generationen mehr machen, da sie einen Unfall erleidet und ihr Kind verliert, weitere sind ihr nicht möglich. Ursache hier ist Gewalt, denn auch Ursa erlebt in ihrem Leben, in ihrem nächsten Umfeld, Gewalt.
Sie ist eine Sängerin, eine selbstständige und vernünftig denkende Frau und dennoch gelingt es auch ihr nicht, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es ist eine kraftvolle Geschichte, mit einer tiefen Aussage.
Ich hadere bei diesem Buch mit der Schreibweise, auch der Struktur. Hier wird über Gewalt berichtet, das ist richtig, auch über Sex und auch Vergewaltigung. Die Worte, die hier benutzt werden, zeigen diese Gewalt, es ist fast Gewalt dem Leser gegenüber und es zeigt auch Wirkung. Leider konnte ich dadurch immer nur kurze Passagen am Stück lesen, ehe es mir zu schwer zu ertragen wurde. Das sollte man wissen, ehe man das Buch liest, es ist kein Unterhaltungsroman, es geht unter die Haut.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Traumata der Vergangenheit, bis in die vierte Generation hinein
Kentucky, 1947, Ursa heißt sie, die Sängerin, ihr Nachname ist Corregidora, der Name, den schon ein portugiesischer Sklavenhändler trug, der vier Generationen zuvor, zur Zeit der Sklaverei, bereits ihre …
Mehr
Die Traumata der Vergangenheit, bis in die vierte Generation hinein
Kentucky, 1947, Ursa heißt sie, die Sängerin, ihr Nachname ist Corregidora, der Name, den schon ein portugiesischer Sklavenhändler trug, der vier Generationen zuvor, zur Zeit der Sklaverei, bereits ihre Urgroßmutter, Großmutter und Mutter vergewaltigt hat. Ursa singt den Blues, jeden Abend in Happy´s Café. Es ist ihre Art, mit den Traumata ihrer female Familyline, Sklaverei, Vergewaltigung, Rassismus in all seinen Ausprägungen, umzugehen. Und sie ist schwanger. Doch durch die Gewalttat ihres Ehemanns verliert sie ihr Kind und zudem für immer die Möglichkeit "Generationen zu machen", damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Zu ihrem Mann wird Ursa nicht zurückkehren, zu Happy´s Café und dem Blues schon. Diese Musik gibt ihr wieder ein Leben, eine Aufgabe, für so viele andere, die Stimme zu erheben, dem Schmerz freien Lauf zu lassen und gehört zu werden.
Diese Geschichte, ihre Weise, die Dinge präsent zu halten, ins Licht zu holen und doch die Gegenwart, als Ankerpunkt für alles, nicht verwischen zu lassen, auch das erfolgt im Rhythmus des Blues. Manchmal hält man das Lesen kaum aus, so hart, auch in der Sprache, wird hier mit den Menschen, mit dem Leben umgegangen. Aber man macht weiter, genau wie die Protagonistin selbst. Und man erlebt weiter, intensiv und ohne Gnade.
Was für ein Buch! 1975 in den USA veröffentlich, nun, ins Deutsche übersetzt, hier bei uns. Nur wenige Autor*innen können so etwas schreiben, dass einem zudem so unter die Haut geht, einen so viel, auch Machtlosigkeit, fühlen lässt.
Ich werde dies hier noch lange in mir spüren und dazu den Blues.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Im Zentrum steht die schöne und faszinierende Ursa, eine geschundene Seele, eine junge, schwarze Bluessängerin, aufgewachsen in Armut und Elend, gewohnt an Gewalt und Ausbeutung, Missbrauch von Männern, auf der Suche nach Liebe und Selbstbestimmung.
Im Gesang verwirklicht sie sich, …
Mehr
Im Zentrum steht die schöne und faszinierende Ursa, eine geschundene Seele, eine junge, schwarze Bluessängerin, aufgewachsen in Armut und Elend, gewohnt an Gewalt und Ausbeutung, Missbrauch von Männern, auf der Suche nach Liebe und Selbstbestimmung.
Im Gesang verwirklicht sie sich, ihre Stimme wird über die Zeit immer spröder und rauer, sie gewinnt an Persönlichkeit durch die vielen belastenden Erfahrungen im Laufe der Zeit. Ursas Leben erinnert mich an die Biographie von Billie Holiday, die auch so vieles durchlebt hat und deren Schmerz sich in ihrem Gesang widerspiegelt.
Auch wenn der die Sprache sehr harsch, roh, brutal und immer wieder äußerst vulgär ist, passt es zu der Geschichte und wirkt trotzdem nicht wirklich obszön. Es stimmt traurig und die unglaubliche Verzweiflung und Ausweglosigkeit aus diesem Leben wird deutlich.
Ein furchtbares und tabubrechendes Vergehen in der Vergangenheit bietet die Grundlage für das Lebensgefühl Ursas: Junge schwarze Frauen, die nur als Sexualobjekte gesehen und immer wieder vergewaltigt wurden. Ein Vater, der vor seinen eigenen Töchtern nicht Halt macht, Männer ohne Gefühl, ohne Respekt, Frauen, die als Ware gesehen werden, nur dazu da, dem Sklavenbesitzer und den Freiern zu dienen. Dieses Wissen lässt kaum Hoffnung auf Veränderung zu, ein Kreislauf aus Gewalt, Sexualität, Verlangen und Sehnsucht ist der Tenor des Romans, den der traurige, sehnsüchtige Gesang des Blues widerspiegelt.
Das Nachwort der Autorin Gayl Jones, Professorin für Literatur, stimmt mich sehr nachdenklich und die Zitate und Erklärungen von anderen Schriftstellern, von Motivation und Anspruch, vom Willen nach Ausdruck und Gestaltung des gesprochenen Wortes sind einleuchtend und sinnstiftend. Die sprachlichen und inhaltlichen Wiederholungen, Schleifen - Call and Response - diese Parallelen zu den Stilmitteln des Blues finde ich großartig.
Die Autorin betont, dass sie nicht zum Mitleid anregen will, sondern in schonungsloser Sprache zeigen möchte, was die Realität alles beinhaltet. Besonders getroffen hat mich auch der Begriff "vergewaltigungsfarben", weil so vieles an Gewalt und grausamer Geschichte der Sklaverei dahintersteckt und eine Flut von qualvollen Bildern ausgelöst wird.
Ein wirklich besonderes Buch, das zum Nach- und Weiterdenken anregt, das die bittere Realität schonungslos darstellt, das Augen öffnet, die Schrecken der Vergangenheit und die immer noch aktuellen Auswirkungen auf die Betroffenen thematisiert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für