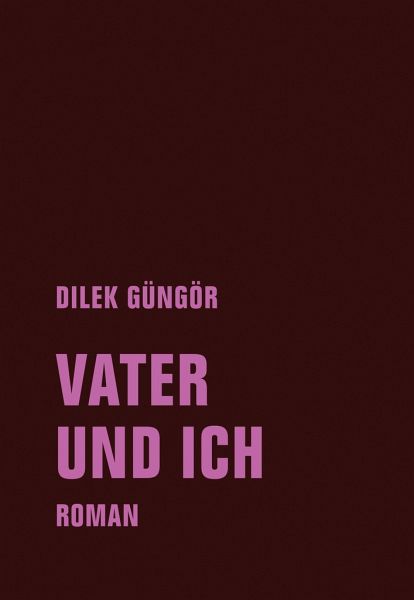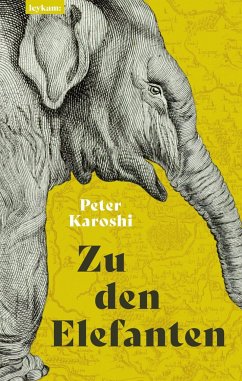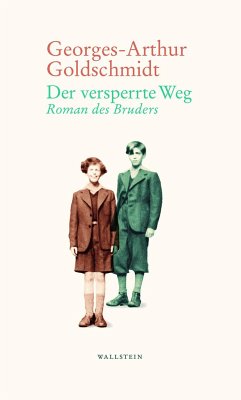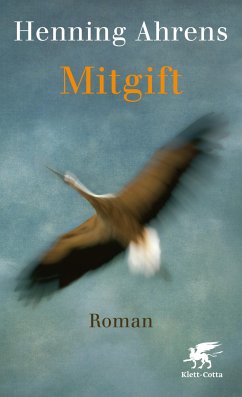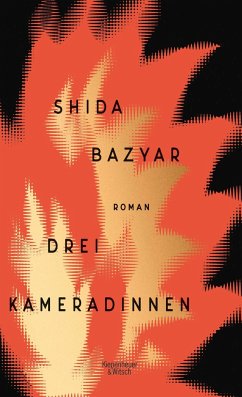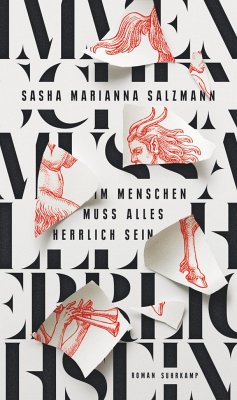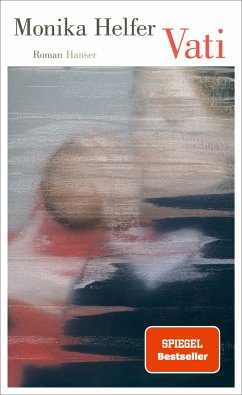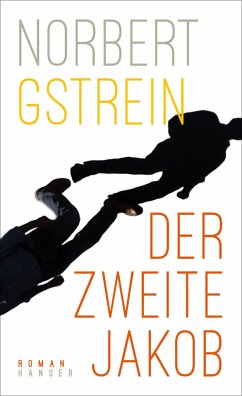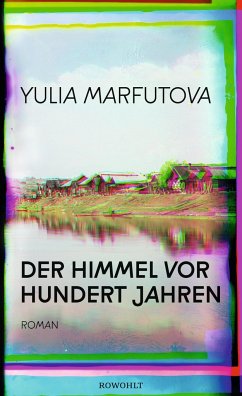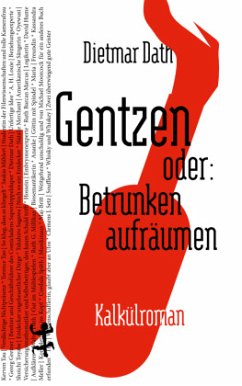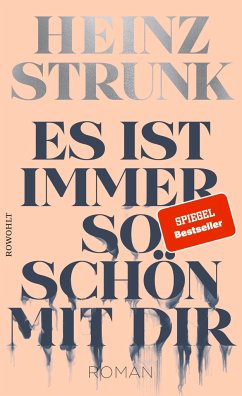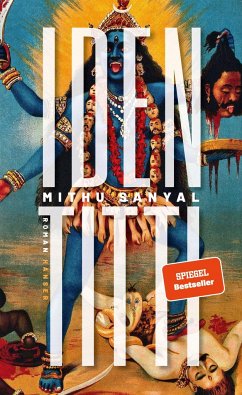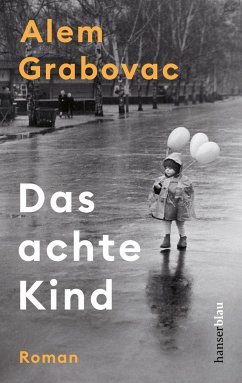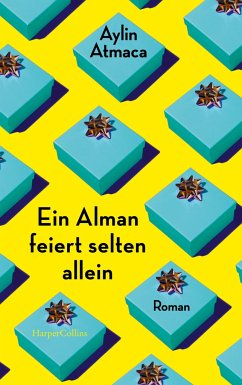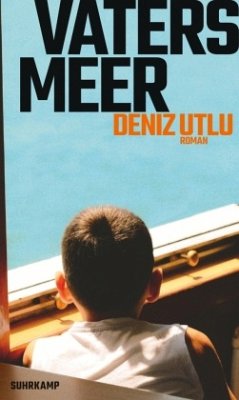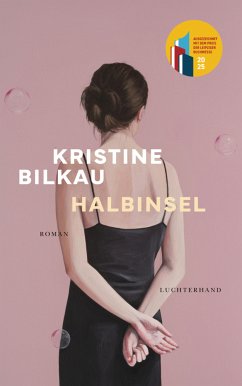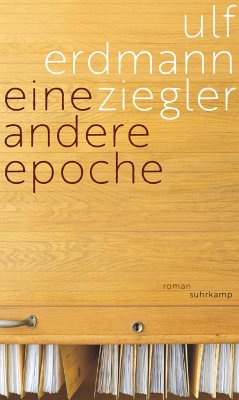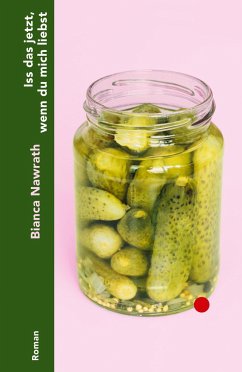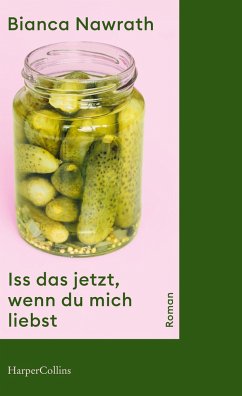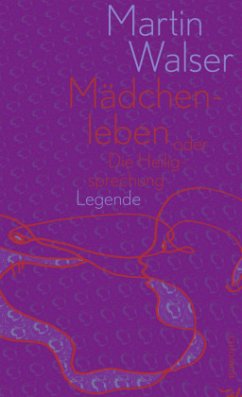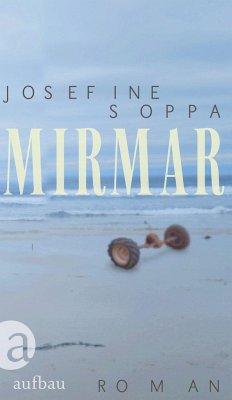PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Als Ipek für ein verlängertes Wochenende ihren Vater besucht, weiß sie, dass er auf dem Bahnhofsplatz im Auto auf sie warten und sie nicht am Zug empfangen wird. Im Elternhaus angekommen sitzt sie in ihrem früheren Kinderzimmer, hört ihn im Garten, im Haus, beim Teekochen. Die Nähe, die Kind und Vater verbunden hat, ist ihnen mit jedem Jahr ein wenig mehr abhandengekommen, und mit der Nähe die gemeinsame Sprache. Ipek ist Journalistin, sie hat das Fragenstellen gelernt, aber gegenüberdem Schweigen zwischen ihr und dem Vater ist sie ohnmächtig.Dilek Güngör beschreibt die Annäherung ...
Als Ipek für ein verlängertes Wochenende ihren Vater besucht, weiß sie, dass er auf dem Bahnhofsplatz im Auto auf sie warten und sie nicht am Zug empfangen wird. Im Elternhaus angekommen sitzt sie in ihrem früheren Kinderzimmer, hört ihn im Garten, im Haus, beim Teekochen. Die Nähe, die Kind und Vater verbunden hat, ist ihnen mit jedem Jahr ein wenig mehr abhandengekommen, und mit der Nähe die gemeinsame Sprache. Ipek ist Journalistin, sie hat das Fragenstellen gelernt, aber gegenüberdem Schweigen zwischen ihr und dem Vater ist sie ohnmächtig.Dilek Güngör beschreibt die Annäherung einer Tochter an ihren Vater, der als sogenannter Gastarbeiter in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam. Sie erzählt von dem Versuch, die Sprachlosigkeit mit Gesten und Handgriffen in der Küche, mit stummem Beieinandersitzen zu überwinden. Ein humorvoller wie rührender Roman über eine Vater-Tochter-Beziehung, mit der sich viele werden identifizieren können.
DILEK GÜNGÖR, geboren 1972 in Schwäbisch Gmünd, ist Journalistin und Schriftstellerin. Ihre gesammelten Zeitungskolumnen erschienen in den Bänden 'Unter uns' und 'Ganz schön deutsch'. 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Roman 'Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter'. 2019 erschien ihr zweiter Roman 'Ich bin Özlem' im Verbrecher Verlag. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Verbrecher Verlag
- Seitenzahl: 101
- Erscheinungstermin: 28. Juli 2021
- Deutsch
- Abmessung: 200mm x 138mm x 15mm
- Gewicht: 222g
- ISBN-13: 9783957324924
- ISBN-10: 3957324920
- Artikelnr.: 61845425
Herstellerkennzeichnung
Verbrecher Verlag
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
verbrecher.buha@kolibri360.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Cornelia Geißler freut sich über die stetig wachsende Anzahl deutschsprachiger Autorinnen und Autoren, die sich mit Migrationserfahrungen in Deutschland befassen. Denn Literatur, so ist sie überzeugt, kann Menschen verbinden. Und Verbindungen sind es, wonach die meisten suchen, die da erzählen. Ipek zum Beispiel, Dilek Güngörs Romanheldin, beschreibt in "Vater und ich" ihre schwerfälligen Versuche, während eines dreitägigen Besuchs im Elternhaus, die alte Verbindung zu ihrem Vater wieder aufzunehmen und daran anzuknüpfen, lesen wir. Dabei reflektiert sie auch darüber, wie die Distanz zwischen ihr und ihren Eltern überhaupt erst zustande kam. Im Zuge dessen spricht sie über Bildungsunterschiede, Sprachbarrieren und das Erwachsenwerden, erklärt Geißler. Ein Urteil über das Buch fällt Geißler leider nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Erwachsenwerden ist, wenn die Eltern beginnen, einem peinlich zu werden. Aber Ipek, der Hauptfigur in Dilek Güngörs Roman „Vater und ich“ waren ihre Eltern und ihre Herkunft schon viel früher unangenehm. Sie wuchs in den 1970er-Jahren als Kind einer Gastarbeiterfamilie in …
Mehr
Erwachsenwerden ist, wenn die Eltern beginnen, einem peinlich zu werden. Aber Ipek, der Hauptfigur in Dilek Güngörs Roman „Vater und ich“ waren ihre Eltern und ihre Herkunft schon viel früher unangenehm. Sie wuchs in den 1970er-Jahren als Kind einer Gastarbeiterfamilie in Schwaben auf. Inzwischen ist sie erwachsen, lebt als Radiojournalistin in Berlin und verbringt drei Tage mit ihrem Vater im elterlichen Haus, da ihre Mutter Wellness-Urlaub macht. So weit, so gut. Aber Vater und Tochter, die sich früher so nahegestanden hatten, haben sich seit Jahren nichts zu sagen.
Das Schweigen heißt aber nicht, dass es zwischen ihnen still ist. Manchmal wird geredet, aber nichts gesagt. Und doch viel ausgedrückt. In Rückblenden erinnert sich Ipek an ihre Kindheit und Jugend, ihre Schulzeit und an die Zeit, in der zwischen ihr und dem Vater alles anders wurde. Wurde vorher miteinander gebalgt und gekuschelt, wurde später nur noch die Hand geschüttelt und Luftküsse gegeben. Weil sie heranwuchs, eine Frau wurde und ihr Vater nicht die Liebe und Zuneigung zu ihr verlor, sondern seine Unbefangenheit.
Er liebt seine Tochter, das kann man zwischen den Zeilen herauslesen. Aber er kann es ihr aus einer gewissen väterlichen Unbeholfenheit heraus nicht sagen, nur zeigen. Kleine Gesten statt großer Worte. „Ein einziges Mal habe ich gesagt, wie sehr ich die Brezeln vom Bäcker Weidemann vermisse. Seither gibt es, wenn ich bei euch bin, Frühstücksbrezeln.“ Als er auf dem Gartenstuhl einschläft, bringt sie ihm ein Kissen, um es ihm zwischen Kopf und Schulter zu schieben („Du sollst nicht ohne Kissen schlafen“). Und wäre er vor dem Fernseher eingenickt, hätte sie ihm eine Decke gebracht.
Aber sie schreibt auch über Reibereien, Streit in der Familie übers Ausgehen und Wegbleiben. Über Rassismus, Unsicherheit, Unsichtbarkeit und Anpassung. Ipeks Eltern waren nach Deutschland gekommen, um zu bleiben. Über die Gründe weiß sie selbst wenig, das meiste musste sie sich zusammenreimen. Sie weiß von Armut, Pistazienanbau und Prügel, die ihr Vater als Kind bezogen hat. Und dass er lieber weiter zur Schule gegangen wäre, als Pistazienbauer zu werden. Im Endeffekt arbeitete er in Deutschland 20 Jahre bei derselben Firma als Polsterer. Als Kind hatte Ipek versucht, ihre Eltern zur Anpassung zu zwingen. Sich eine andere Unterschrift anzugewöhnen, zum Beispiel. Und sie selbst verleugnete zum Teil ihre Herkunft („Und in der Schule behauptete ich, ich verstünde überhaupt kein Türkisch, das machte sich besser.“)
Mit ihrem Heranwachsen wuchs auch eine Kluft zwischen ihr und dem Vater. Ein Generationenkonflikt, aber auch der Konflikt Mann/Frau, Vater/Tochter und zwischen seinem von Armut und Arbeit geprägten Leben und ihrem sorgenfreien. „Und weißt es nicht einmal, weißt es nicht zu schätzen. Das sagte er nicht, ich verstand auch so. Wie es dir als Kind im Dorf ergangen war, erzähltest du nie, aber anscheinend lebte ich im Vergleich dazu das Leben jener Prinzessin, deren Hochzeit wir uns im Fernsehen angesehen hatten.“ Und ihr Vater findet, ihr fehle die Demut. Sie sind sich fremd und fern und doch tief im Inneren nah. Eine Beziehung mit Konfliktpotential, vor allem aber mit Potential. Wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Das Buch endet nach drei Tagen und knapp 100 Seiten für mich viel zu früh mit Ipeks Heimreise nach Berlin. Sie sind sich näher gekommen, aber nicht nahe. „Wir sagen nicht du, nicht Papa, nicht Vater, nicht Baba und du nicht Ipek. Wir sprechen miteinander ohne Ansprache“ – denkt Ipek am Anfang. Gegen Ende nennt er sie „kızım“- Tochter und sie ihn baba.
Sprachlich ist das Buch unfassbar intensiv und gut geschrieben. Ich konnte mich hervorragend einfühlen, die Hauptfigur und mich verbindet offensichtlich sehr vieles, nicht nur die schwäbische Herkunft. Wie viel von der Autorin in ihrer Protagonistin steckt, vermag ich nicht zu sagen, ich kannte sie vorher nicht. Es ist ein kleines Büchlein, aber für mich ein ganz großes Buch. Daher von mir fünf St
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Dilek Güngor beschreibt in ihrem im Verbrecherverlag erschienen Roman Vater und ich detailliert das Verhältnis der Protagonistin Ipek zum türkischen Vater und damit explizit ein Aufwachsen in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Das ist sehr aufschlussreich und interessant, …
Mehr
Dilek Güngor beschreibt in ihrem im Verbrecherverlag erschienen Roman Vater und ich detailliert das Verhältnis der Protagonistin Ipek zum türkischen Vater und damit explizit ein Aufwachsen in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Das ist sehr aufschlussreich und interessant, insbesondere das glaubwürdige daran überzeugt.
Dilek Güngör ist 1972 geboren, und ihr Aufwachsen ist beispielhaft für viele Türkinnen, die als Kinder von Gastarbeitern erlebten.
Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter verändert sich. Sie waren sich einst sehr nah, machten viele Späße miteinander, aber dann wurde Ipek älter und ihr Lebensweg geht in eine Richtung, die zur Distanz zwischen ihnen beiträgt.
Das eine Annähe
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Wortlos verbunden
Die mit ihren deutsch-türkischen Glossen in der Berliner Zeitung bekannt gewordene Journalistin Dilek Güngör wurde mit ihrem dritten Roman «Vater und ich» für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert. Sie behandelt darin das Verhältnis von …
Mehr
Wortlos verbunden
Die mit ihren deutsch-türkischen Glossen in der Berliner Zeitung bekannt gewordene Journalistin Dilek Güngör wurde mit ihrem dritten Roman «Vater und ich» für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert. Sie behandelt darin das Verhältnis von Eltern und Kindern zueinander, was ja spätestens dann schwierig wird, wenn die Eltern den heranwachsenden Kindern anfangen peinlich zu werden. Eine Thematik, die eher selten zu finden ist in der Literatur. In dem vorliegenden Band wird dieses Problem noch angereichert mit generationsbedingt unterschiedlichen Migrations-Erfahrungen, die von Sprachbarrieren und ungleichem Bildungs-Niveau herrühren, was sich folglich dann auch in einem unterschiedlichen sozialen Status niederschlägt.
Die in Berlin erfolgreiche Journalistin Ipek nutzt den mehrtägigen Wellness-Urlaub ihrer Mutter, um den Vater zu besuchen. Als erwachsene Tochter hofft sie, die schon lange andauernde, bedrückende Sprachlosigkeit zwischen sich und dem Vater überwinden zu können, wenn sie mit ihm mal allein ist und ungestört, ohne Ablenkung durch die quirlige Mutter, einige Tage nur mit ihm verbringt. Schon am Bahnhof wird das gestörte Verhältnis deutlich, denn der Vater wartet auf dem Parkplatz im Auto auf sie, statt sie auf dem Bahnsteig zu empfangen, wie es üblich ist, wenn ein seltener und willkommener Gast zum Besuch eintrifft. Ist das Gedankenlosigkeit oder ein Indiz für die fehlende Beziehung zur Tochter? Dilek Güngör nähert sich dieser Frage durch Rückblenden auf die Vorgeschichte der Familie. Der Vater ist in den siebziger Jahren als Gastarbeiter nach Schwaben gekommen, die Mutter hat zunächst als Putzfrau gearbeitet. Als später bei Bekannten ein kleines Haus mit Laden zum Verkauf anstand, hat das Ehepaar ihre bescheidene Eigentums-Wohnung verkauft und sich selbständig gemacht. Vater mit einer eigenen Polster-Werkstatt, Mutter mit einer Änderungs-Schneiderei im ehemaligen Laden. Im Obergeschoss befindet sich ihre Wohnung, in der die Ich-Erzählerin Ipek groß geworden ist.
Es ist eine schwierige Annäherung der Tochter an einen Vater, dem sie früher doch so besonders nahe gestanden hat. Die Beiden haben sich heute aber nichts mehr zu sagen, sie schweigen sich gegenseitig an. «Kann nicht das Schweigen unsere Sprache sein» fragt sie sich an einer Stelle des Romans verzweifelt. Obwohl Ipek als Radio-Journalistin Reportagen mit Menschen macht und dabei die unterschiedlichsten Leute zum Sprechen bringen muss, findet sie zum eigenen Vater keinen Zugang. Sie scheitert an seiner Einsilbigkeit und am eigenen Unvermögen, locker und unbeschwert mit ihm zu reden. Trennend hat zum einen gewirkt, dass die Unbefangenheit des Vaters beim Kuscheln und Herumbalgen mit der Tochter religiös bedingt schon recht früh, während der Pubertät, verloren ging und einem förmlichen Umgang gewichen ist, man gibt sich allenfalls noch die Hand beim Begrüßen. Insbesondere aber, das wird ebenso klar, ist daran auch die Sprache schuld. Besonders der Vater ist dem Türkischen treu geblieben, während für die in Deutschland geborene Ipek die Heimatsprache Deutsch ist. Türkisch spielt nur familienintern noch eine Rolle, was beim Vater besonders erschwert wird durch seinen schwer verständlichen Dialekt. Für die in bescheidenen Verhältnissen lebenden Eltern führt Ipek in Berlin ein unbeschwertes Luxusleben, auch das bietet einiges Konfliktpotential, ihr fehle es an Demut, hat der Vater ihr mal vorgeworfen.
Der in direkter Rede, in Du-Form an den Vater gerichtete Text schildert auf beklemmende Weise eine Entfremdung, für die es scheinbar viele Ursachen gibt. Allerdings lässt es die Autorin offen, warum es denn überhaupt so weit kommen musste. Auf subtile Weise, das kann man immerhin zwischen den Zeilen lesen, verstehen sich die Beiden ja doch, viele kleine Gesten deuten darauf hin. Das gilt vor allem für die intimste Szene ganz am Schluss des Romans, als Ipek dem Vater kurz vor ihrer Abreise noch schnell die Haare schneidet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für