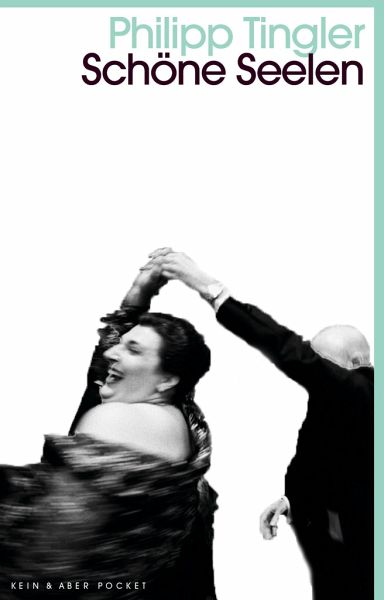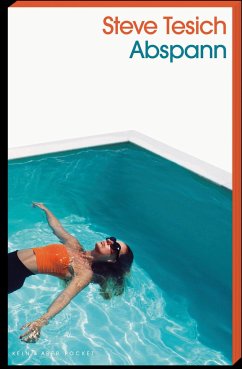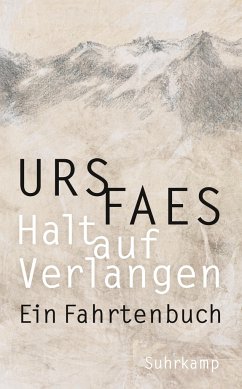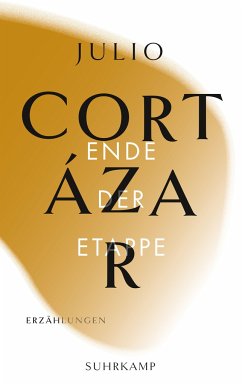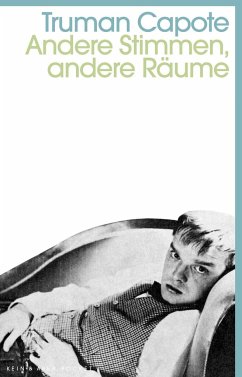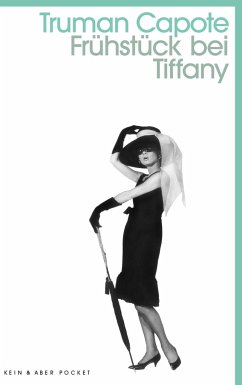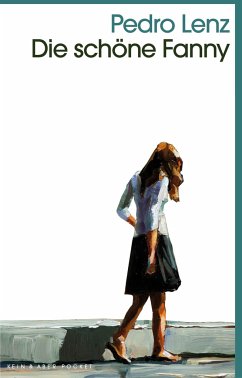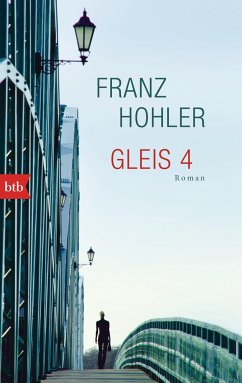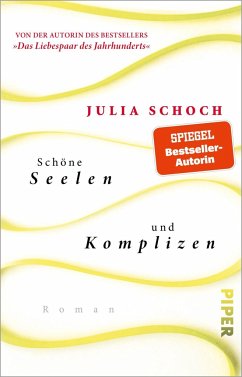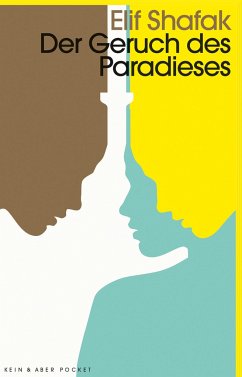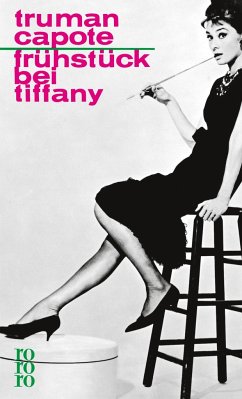Philipp Tingler
Broschiertes Buch
Schöne Seelen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Oskar Canow will eine Therapie machen. Allerdings nicht für sich selbst, sondern anstelle seines Freundes Viktor, der wiederum von seiner Ehefrau Mildred dazu genötigt wird. Ein sarkastischer Blick in jene Gesellschaftskreise, wo Schein und Einbildung so real sind wie Botox-Spritzen und Diätpillen.
Philipp Tingler studierte Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an der Hochschule St. Gallen, der London School of Economics sowie der Universität Zürich und ist mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller. Zuletzt erschien von ihm bei Kein & Aber der Roman 'Rate, wer zum Essen bleibt' (2019). Er ist Kritiker im SRF-Literaturclub und im Literarischen Quartett des ZDF sowie Juror beim ORF-Bachmannpreis und der SRF-Bestenliste. Neben Belletristik und Sachbüchern ist er ausserdem bekannt durch das SRF-Format Steiner&Tingler und seine Essays u.a. in der Neuen Zürcher Zeitung und im Autokulturmagazin ramp.
Produktdetails
- Kein & Aber Pocket
- Verlag: Kein & Aber
- Artikelnr. des Verlages: 290/05959
- 1. Auflage, neue Ausgabe
- Seitenzahl: 332
- Erscheinungstermin: 26. April 2017
- Deutsch
- Abmessung: 185mm x 113mm x 27mm
- Gewicht: 302g
- ISBN-13: 9783036959597
- ISBN-10: 3036959599
- Artikelnr.: 47056627
Herstellerkennzeichnung
Kein + Aber
Gutenbergstraße 1
82205 Gilching
vertrieb@keinundaber.ch
 buecher-magazin.deIm Grunde sind all die "schönen Seelen" dieses Romans verlorene. Philipp Tingler - bekannt für seine scharfzüngigen Texte und elaborierten Auftritte beim "Literaturclub" - stellt sie vor, die Reichen und Oberflächlichen der feinen Schweizer Gesellschaft. Die Grundidee des Romans klingt vielversprechend: Der Schriftsteller Oskar Canow beginnt eine Therapie, stellvertretend für seinen Freund Viktor. Er tut so, als wären Victors Eheprobleme seine eigenen und erstattet dem Freund nach jeder Sitzung ausführlich Bericht. Bis es zu diesem Verwirrspiel kommt, muss sich der Leser jedoch mehrere Dutzend Seiten mit der Oberflächlichkeit der Zürcher High Society beschäftigen: Namen, Szenen, Dialoge vermischen sich zu einem undurchdringbaren Wirrwarr an Wörtern. Einige Stichworte und Wendungen tauchen immer wieder auf: "dschungelrote Fingernägel", "Hyaluronsäure", oder: "Person X sagt dies und das", um auch mal "etwas Text zu bekommen". Die Geschichte wirkt wie ein bizarres Theaterstück, vollgepackt mit allem, was der Autor zu bieten hat. Der Erzähler scheint kaum hinterherzukommen, über fremdwortgespickte Theorien zu berichten; der Leser verliert immer wieder den Faden. Die Charaktere bleiben undifferenziert, und oft stellt sich die Frage: Wozu wird das gerade erzählt?
buecher-magazin.deIm Grunde sind all die "schönen Seelen" dieses Romans verlorene. Philipp Tingler - bekannt für seine scharfzüngigen Texte und elaborierten Auftritte beim "Literaturclub" - stellt sie vor, die Reichen und Oberflächlichen der feinen Schweizer Gesellschaft. Die Grundidee des Romans klingt vielversprechend: Der Schriftsteller Oskar Canow beginnt eine Therapie, stellvertretend für seinen Freund Viktor. Er tut so, als wären Victors Eheprobleme seine eigenen und erstattet dem Freund nach jeder Sitzung ausführlich Bericht. Bis es zu diesem Verwirrspiel kommt, muss sich der Leser jedoch mehrere Dutzend Seiten mit der Oberflächlichkeit der Zürcher High Society beschäftigen: Namen, Szenen, Dialoge vermischen sich zu einem undurchdringbaren Wirrwarr an Wörtern. Einige Stichworte und Wendungen tauchen immer wieder auf: "dschungelrote Fingernägel", "Hyaluronsäure", oder: "Person X sagt dies und das", um auch mal "etwas Text zu bekommen". Die Geschichte wirkt wie ein bizarres Theaterstück, vollgepackt mit allem, was der Autor zu bieten hat. Der Erzähler scheint kaum hinterherzukommen, über fremdwortgespickte Theorien zu berichten; der Leser verliert immer wieder den Faden. Die Charaktere bleiben undifferenziert, und oft stellt sich die Frage: Wozu wird das gerade erzählt?© BÜCHERmagazin, Jeanne Wellnitz (jw)
Gebundenes Buch
Aufgrund dieses Klappentextes habe ich mich auf eine interessante und humorvolle Geschichte gefreut. Doch leider wurde ich herb enttäuscht. Der Anfang dieses Buches war ganz amüsant, die Sterbeszene einer alten Diva aus den „besseren Kreisen“. Doch dann wurde es für mich …
Mehr
Aufgrund dieses Klappentextes habe ich mich auf eine interessante und humorvolle Geschichte gefreut. Doch leider wurde ich herb enttäuscht. Der Anfang dieses Buches war ganz amüsant, die Sterbeszene einer alten Diva aus den „besseren Kreisen“. Doch dann wurde es für mich immer schwieriger, weiterzulesen. Die Sätze wurden immer komplizierter und länger, mit englischen Phrasen unterlegt, es war einfach nicht mehr zu verstehen, was man da eigentlich gerade gelesen hatte. Einige Passagen waren amüsant, doch trösteten sie nicht über den Rest des Buches hinweg. Es wurde viel zu viel Unwichtiges und Unsinniges geschrieben, „viel gesprochen und nichts gesagt“, das wäre für mich die richtige Beschreibung.
Auch die Therapie, die Oskar für seinen Freund Viktor macht, konnte mich nicht mehr positiv stimmen oder begeistern.
Ich habe noch nie ein Buch mit nur einem oder zwei Sternen bewertet, da es mir für den Autor, der natürlich viel Arbeit, Zeit und Liebe in sein Buch steckt, ebenso für den Verlag leid tut, keine gute Bewertung zu erhalten.
Aber dieses Buch konnte mich leider überhaupt nicht überzeugen oder erreichen. Ein wirklich schwieriger Schreibstil mit unendlich langen, verzwickten, komplizierten Sätzen, eine Geschichte mit zu vielen Abzweigungen, übertriebener Sarkasmus, der „alle“ oberen Zehntausend lächerlich machte und ein Zuviel der Worte, die mich erschlugen und mir trotzdem nichts sagten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die grande dame der Gesellschaft tritt ab, Millvina Van Runkle liegt im Sterben, doch auch dies will inszeniert sein. Und sie geht nicht ohne ihren Lieben noch ein paar Geheimnisse anzuvertrauen: ihre Tochter Mildred ist adoptiert, das soll diese aber nicht erfahren. Mildred hat ohnehin andere …
Mehr
Die grande dame der Gesellschaft tritt ab, Millvina Van Runkle liegt im Sterben, doch auch dies will inszeniert sein. Und sie geht nicht ohne ihren Lieben noch ein paar Geheimnisse anzuvertrauen: ihre Tochter Mildred ist adoptiert, das soll diese aber nicht erfahren. Mildred hat ohnehin andere Sorgen. Der Tod ihrer Mutter lässt sie relativ kalt, herzlich war das Verhältnis nicht gerade – aber das ist es in der Züricher Welt der Schönen und Reichen eh nie, Hauptsache der Schein ist gewahrt und die Anzeige auf der Waage stimmt. Mehr belastet sie ihre Ehe und nun drängt sie ihren Mann Viktor endlich zu einer Therapie, worauf dieser so gar keine Lust hat. So vereinbar er mit seinem Freund Oskar, dass dieser für ihn die Therapie macht und ihm berichtet. Doch bald schon verfängt sich Oskar zwischen seinem eigenen und Viktors Leben und setzt so gleich beide Ehen aufs Spiel.
Ein kurioser Roman. Die ersten beiden Kapitel sind geprägt von Millvinas Ableben und der Beerdigung und zeichnen ein bissig-ironisches Bild der besseren Gesellschaft, die gerne betrogen werden möchte und bei der hinter der geschönten Fassade wenig bleibt. Oskars Therapie bildet das Herzstück des Romans und sprüht nur so vor herrlichen Dialogen zwischen Therapeut und Klient, der gar nicht therapiert werden möchte und doch durch all seine Ablenkungsmanöver immer tiefer in die eigene Seele blickt. Die Therapie, die in diesen Kreisen ebenso Accessoire ist wie die Frisur oder die aufgehübschten Augenlider, erhält plötzlich doch wieder eine Funktion.
Die Figuren sind selbstverständlich überzeichnet, gewinnen aber dadurch ihren Charme; die Gefahr einer Identifizierung mit ihnen besteht nicht, die notwendige Distanz, um diese Gesellschaftsschicht mit gebührendem Abstand zu belächeln, bleibt gewahrt. Interessant wird Tinglers Roman durch seine sprachliche Gestaltung. Er findet die passenden Formulierungen, die einem immer wieder schmunzeln lassen, da sie treffsicher auf den Punkt bringen, wie absurd sich die Figuren verhalten und wie verschoben ihr Weltbild ist. Keinesfalls bleibt der Roman aber an der Oberfläche, die Therapiesitzungen sind durchaus von einer gewissen psychologischen Tiefe geprägt, die Oskar aber an seine Grenzen bringen, denn Tiefgang gehört eigentlich nicht zu seiner Welt.
Fazit: humorvoll-ironischer Blick in die Welt der Schönen und Reichen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nachdem ich das Cover gesehen und den Klappentext gelesen hatte, dachte ich, das ist bestimmt ein humorvolles, interessantes Buch. Und das war es am Anfang auch.
Milvina Van Runkle, eine Grande Dame der besseren Kreise ist gestorben und auf ihrer Beerdigung läuft alles auf was Rang und Namen …
Mehr
Nachdem ich das Cover gesehen und den Klappentext gelesen hatte, dachte ich, das ist bestimmt ein humorvolles, interessantes Buch. Und das war es am Anfang auch.
Milvina Van Runkle, eine Grande Dame der besseren Kreise ist gestorben und auf ihrer Beerdigung läuft alles auf was Rang und Namen hat. Doch nicht die Trauer ist das beherrschende Thema, sondern wer trägt was, sowie der neueste Klatsch der Society.
Doch nach diesen Kapiteln wird das Buch dann sehr zäh und langatmig. Der Schriftsteller Oskar Canow will für seinen Freund eine Therapie machen, damit dieser in der Zeit Theater spielen kann und seine Frau nichts davon bemerkt.
Die Gespräche die Oskar dann mit dem Psychologen führt konnten mich leider nicht fesseln und für die Geschichte begeistern, ich hab das Buch deshalb abgebrochen.
Die Protagonisten sind alle sehr farblos, flach und oberflächlich, so dass ich für keinen von ihnen Sympathie aufbringen konnte.
Es war einfach nicht meine Leserichtung, aber es gibt bestimmt auch Leser die von diesem Buch begeistert sind.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
INHALT
Der Züricher Bohemien und Gelegenheitsschriftsteller Oskar Canow verkehrt in den besten Kreisen der Schweizerischen Gesellschaft. Er sieht das ganze Bohei um die oberen Zehntausend sehr kritisch und kann sich manch sarkastische Bemerkung über Schönheits-OPs, falsche Zähne …
Mehr
INHALT
Der Züricher Bohemien und Gelegenheitsschriftsteller Oskar Canow verkehrt in den besten Kreisen der Schweizerischen Gesellschaft. Er sieht das ganze Bohei um die oberen Zehntausend sehr kritisch und kann sich manch sarkastische Bemerkung über Schönheits-OPs, falsche Zähne und weiße Hollywoodzähne bei passender Gelegenheit nicht verkneifen. Als ihm sein alter Jugendfreund Viktor bittet, anstatt seiner eine Therapie zu machen, willigt er nach anfänglichen Bedenken ein, weil ihm gerade eine Schreibblockade plagt. Mit Dr. Hockstädter wälzt er nun Viktors Eheprobleme und liefert sich dabei das ein oder andere Philosophieduell.
MEINUNG
Ich kannte den Berliner Autor Philipp Tingler vor der Lektüre des Romans nicht und habe mich durch die vielversprechende, beißend ironische Leseprobe ködern lassen. Wenn man auf sprachliche Brillanz steht und dafür beim Plot Abstriche in Kauf nimmt, dann kann dieses Buch durchaus unterhaltsam sein, aber nur dann...
Ich mag es, wie Tingler in jeder Zeile die oberflächliche, von Statussymbolen bestimmte Highsociety auseinander nimmt. Er scheut sich nicht Dinge beim Namen zu nennen und lebensphilosophische Fragen zu stellen. Besonders Tinglers exzellenter Sprachstil hat mir gefallen, wohingegen ich mit der lahmen, vor sich hin wabernden Handlung meine Probleme hatte. Oskars Therapie nimmt fast das gesamte Buch ein und langweilt mit jeder neuen Sitzung mehr. Irgendwie kommt er nicht voran bzw. Viktor scheint sich durch Oskars Tipps nicht zu bessern. Als Leser fragt man sich: Ist es das inhaltlich schon gewesen? Hierbei muss ich Tingler zugute halten, dass er sein Ding durchzieht und bis zum Schluss an der unaufgeregten Story festhält; was vielleicht zeigen soll, wie leer und gesichtslos sich diese nur auf Äußerlichkeiten und Erfolg getrimmte Gesellschaftsgruppe darstellt. Es geht um den schönen Schein und das nichtssagende Geschwätz und natürlich um emotionale Kälte, weil Besitz und Reichtum abstumpfen lässt. Dahingehend wirkt der ambivalente Buchtitel "Schöne Seelen" sehr passend. Wäre der Plot nicht so redundant und damit einschläfernd gewesen, hätte ich vielleicht nicht so viele Anläufe gebraucht dieses Buch bis zum Schluss zu lesen. Einige Stellen konnte ich nur überfliegen bzw. ich musste einfach weiterblättern, sonst säße ich heute noch an der Lektüre - schade.
FAZIT
Nach 20 Seiten kennt man bereits alles und will gar nicht weiterlesen. Ermüdende Lektüre, die einzig mit ihrem Sprachwitz und den z.T. bitterbösen Demaskierungen der ach so feinen Gesellschaft punkten kann. Leider nur bedingt empfehlbar.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Kein schönes Buch
Oskar Canow wird von einem Freund gebeten, an seiner Stelle die Therapie zu besuchen, die dessen Frau ihm zur Eherettung verordnet hat. Oskar ist Schriftsteller und Teil der oberen "Zehntausend" Zürichs. Einen Großteil seiner Zeit verbringt er scheinbar …
Mehr
Kein schönes Buch
Oskar Canow wird von einem Freund gebeten, an seiner Stelle die Therapie zu besuchen, die dessen Frau ihm zur Eherettung verordnet hat. Oskar ist Schriftsteller und Teil der oberen "Zehntausend" Zürichs. Einen Großteil seiner Zeit verbringt er scheinbar mit der zynischen Analyse seines schwerreichen Milieus.
Als ich dieses Buch beendet hatte, habe ich erleichtert durchgeatmet. Es war ein hartes Stück Lesearbeit. Gespickt ist das Buch sicherlich mit vielen literarischen Perlen, Gedanken und Erkenntnissen, aber in der hier dargebotenen geballten Ladung sowie dem wirklich sehr zynischen und affektierten Schreibstil war es über mehr als 300 Seiten doch immer wieder anstrengend. Dann gab es immer wieder aber auch Lichtblicke und kleine amüsante Momente, leider gibt es aber kaum eine übergeordnete stringente Handlung, die sich weiterentwickelt, fortbewegt und Spannung aufbaut. Im einzigen, potentiell spannenden Moment wird genau diese Spannung wieder durch langatmige Betrachtungen zunichte gemacht. Ich weiß nicht, ob es Selbstironie sein sollte oder einfach nur bezeichnend für den Roman ist, aber nicht einmal die Figuren verstanden sich gegenseitig.
Dieses Buch ist definitiv nicht für die breite Masse ausgelegt, sondern sucht seine Leser wohl eher in verschiedenen Nischen, was ich nicht abwertend meine, sondern was für mich erklärt, warum das Buch so viele negative Bewertungen erhält (leider auch von mir), wenn man es mittels Leseexemplaren unter die breite Lesermasse streut. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Leser_innen gibt, die dieses Buch und seinen Stil genießen können. Für mich bleibt aber festzuhalten, dass ich vielleicht nicht der Typ für derartige schöngeistige Literatur bin, wobei ich bei dem "geistig" noch zustimmen würde, bei "schön" allerdings eher weniger.
Ich fragte mich die meiste Zeit: Ist das wirklich die Realität oder ist der Zynismus maßlos übertrieben? Blicken "die oberen Zehntausend" wirklich so auf die Welt oder soll das lediglich ein Stilmittel sein? Jedenfalls wirken viele zwischenmenschliche Betrachtungen maßlos herablassend, wenn nicht teilweise sogar menschenverachtend. Ich habe noch nie ein derart zynisches und snobistisches Buch gelesen und konnte ihm auch nur selten einen gewissen Unterhaltungswert oder eine Botschaft abgewinnen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für