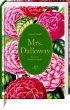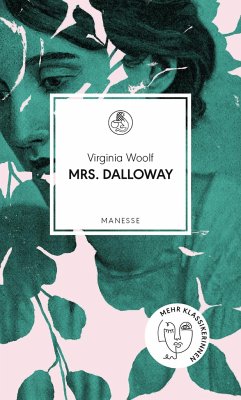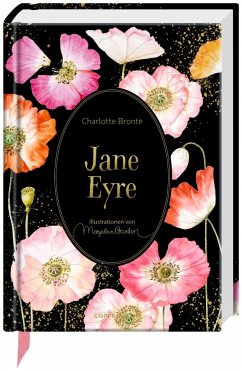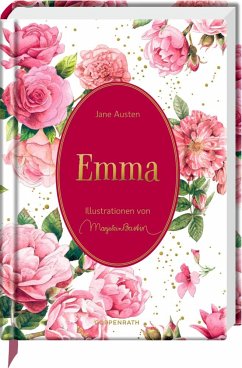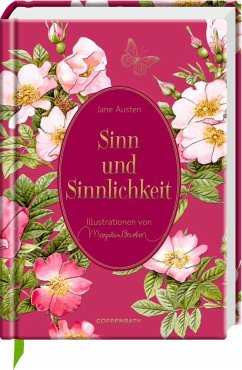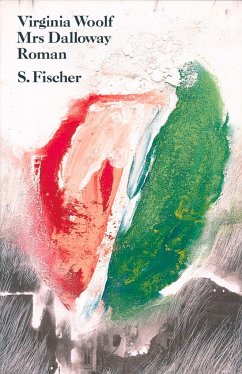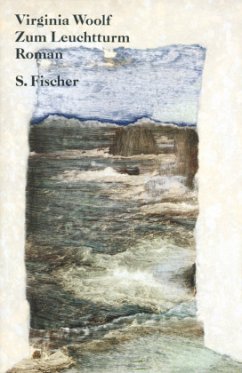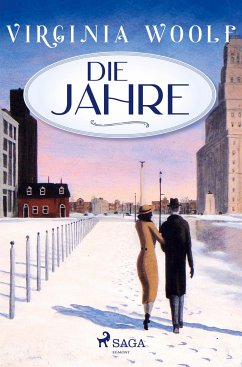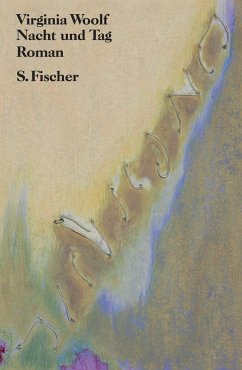Nicht lieferbar
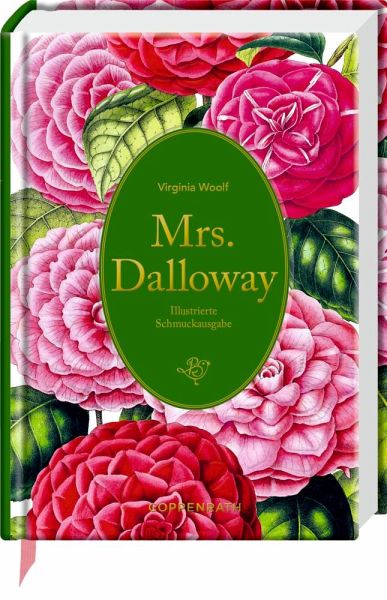
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:




Ein Tag wie ein ganzes LebenLondon im Juni 1923: Ein Mittwoch im Leben der vornehmen Clarissa Dalloway, die für diesen Abend eine große Gesellschaft vorbereitet. Als sie unerwartet Besuch von ihrer Jugendliebe bekommt, verliert sie sich in Erinnerungen und zweifelt an vergangenen Entscheidungen. Meisterhaft zieht Virginia Woolf die Leser immer tiefer in die Gedanken ihrer Figuren hinein und stellt damit zugleich deren Leben in Frage.
Produktdetails
- Kleine Schmuckausgabe
- Verlag: Coppenrath, Münster
- Artikelnr. des Verlages: 63622
- Illustrierte Schmuckausgabe
- Seitenzahl: 264
- Erscheinungstermin: 3. August 2020
- Deutsch
- Abmessung: 198mm x 134mm x 32mm
- Gewicht: 588g
- ISBN-13: 9783649636229
- ISBN-10: 3649636220
- Artikelnr.: 59137637
Herstellerkennzeichnung
Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG
Hafenweg 30
48155 Münster, Westf
conny.lammers@coppenrath.de
www.coppenrath-service.de
+49 (0251) 41411-0
»Untiefen umschifft Melanie Walz souverän. Ihre Übersetzung von 'Mrs. Dalloway' komprimiert komplexe Formulierungen zu einer schlanken Silhouette, die Übersicht im Semikolongestrüpp Woolfs schafft und Originaltreue ermöglicht. Damit liefert Walz einen besseren Grund als Statistiken und Quoten, Virginia Woolf zu lesen: eine der ganz großen Autorinnen des 20. Jahrhunderts zu entdecken.« DIE ZEIT, Florian Eichel
Kapptext:
Ein Tag wie ein ganzes Leben London im Juni 1923: Ein Mittwoch im Leben der vornehmen Clarissa Dalloway, die für diesen Abend eine große Gesellschaft vorbereitet. Als sie unerwartet Besuch von ihrer Jugendliebe bekommt, verliert sie sich in Erinnerungen und zweifelt an …
Mehr
Kapptext:
Ein Tag wie ein ganzes Leben London im Juni 1923: Ein Mittwoch im Leben der vornehmen Clarissa Dalloway, die für diesen Abend eine große Gesellschaft vorbereitet. Als sie unerwartet Besuch von ihrer Jugendliebe bekommt, verliert sie sich in Erinnerungen und zweifelt an vergangenen Entscheidungen. Meisterhaft zieht Virginia Woolf die Leser immer tiefer in die Gedanken ihrer Figuren hinein und stellt damit zugleich deren Leben in Frage.
Meine Meinung:
Vorab möchte ich sagen dass diese Rezension etwas anders sein wird als meine sonstigen Rezensionen. Es werden auch einige Spoiler dabei sein, die aber leider nicht zu vermeiden sind. Der Text verdient es dass wir darüber reden.
Kommen wir erstmal zum Cover und zur Gestaltung des Buches, da möchte ich den Verlag wirklich sehr Loben! Ohne dieses wundervolle Cover wäre ich gar nicht erst auf dieses Buch aufmerksamen geworden. Klassiker werden oft mit sagen wir es mal recht seltsamen Covern vermarktet. Daher großes Lob an den Verlag, der mir dieses Buch schmackhaft gemacht hat. Auch die vielen süßen Extras die uns während des Lesens begleiten sind einfach zauberhaft. Die wunderschönen Illustrationen auf jeder Seite werten das Buch noch mal richtig auf.
Die Geschichte war wirklich anders als erwartet. Der Klapptext verrät recht wenig vom Inhalt des Buches und erwartet habe ich eine Prunkvolle Liebesgeschichte mit heißen Partys so wie man es von Gatsby kennt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich vorher nicht mit der Autorin beschäftigt habe oder von dieser Geschichte je mal etwas gehört habe. Daher ging ich völlig ohne Vorurteile und ohne jegliches wissen an dieses Buch und das war auch gut so. Denn der Inhalt hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Wir begleiten Mrs. Dalloway beim Einkaufen und den Vorbereitungen einer Party, dabei gehen ihre Gedanken nach ob sie denn die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen hat und nebenbei passieren immer mal wieder kleine Dinge die sie zu weiteren Gedankenzügen bringen… Wäre sie z. B. glücklicher gewesen mit jemand anderen? Im Buch passiert eigentlich recht wenig, dennoch konnten mich die Gedanken von Mrs. Dalloway sehr fesseln. Neben Clarissa Dalloway gibt es auch noch eine andere interessante Nebenfigur, einen alten Kriegsveteranen der Selbstmord begeht und quasi Clarissa als Spiegel diente, er wählte den Tod und auch dies brachte Clarissa wieder sehr zum nachdenken. Nach dem ich das Buch beendet habe, las ich viel über die Autorin die wohl ebenfalls unter starken Depressionen litt und ihren Romanfiguren aus diesem Buch wohl sehr ähnlich war. Wir blicken in dieser Geschichte wirklich sehr tief in die Seele der Autorin, die sich dann mit 59 Jahren in einem Fluss selbst ertränkte. Neben den Gedanken über falsche Entscheidungen und das alt werden im Leben, behandelt die Geschichte auch sexuelle Unterdrückung. Der Schreibstil des Buches ist sehr poetisches und daher echt ein Meisterwerk der Zeit. Ich bin froh dass ich dieses Buch gelesen habe und möchte mir bald die Verfilmung dazu ansehen.
Fazit:
Ganz anders als erwartet aber ich bin sehr positiv überrascht über diese Geschichte. Ich denke dieses Buch ist einfach schwer in Worte zu fassen und man muss es einfach mal selbst erlebt haben es gelesen zu haben. Neben dem lesen haben mir die schönen beigaben des Verlags viel Freude bereitet und es war ein kleines Erlebnis im Alttag.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Keine Angst
Selbst notorischen Büchermuffeln dürfte der Name dieser englischen Autorin geläufig sein, von dem Bühnenstück «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» nämlich, 1966 kongenial verfilmt mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Die Idee zu diesem …
Mehr
Keine Angst
Selbst notorischen Büchermuffeln dürfte der Name dieser englischen Autorin geläufig sein, von dem Bühnenstück «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» nämlich, 1966 kongenial verfilmt mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Die Idee zu diesem Titel kam Edward Albee im Waschraum einer Bar, er hielt den graffitiartig auf einen Spiegel geschmierten Satz für einen Ulk, bei dem der gefürchtete Wolf aus dem Spottlied des englischen Märchens als Wortspiel durch den Namen der Schriftstellerin ersetzt wurde, - oder etwa, weil sie als schwieriges Studienobjekt bei den Literaturstudenten gefürchtet war? Anspruchsvoll jedenfalls ist auch ihr vierter Roman «Mrs Dalloway», der einen künstlerischen Höhepunkt im Œuvre dieser bedeutenden Autorin darstellt. Vor dem kontemplativ veranlagte, aufnahmefähige Leser aber keinesfalls Angst haben müssen, soviel vorab!
Virginia Woolf wird neben Gertrude Stein als berühmteste Autorin der klassischen Moderne angesehen. Sie hat in ihren Werken unermüdlich gegen das englische Spießertum angeschrieben, gegen den elitären Snobismus gehobener Kreise und die als zunehmend unerträglich empfundene gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen. Zeitlich im Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg angesiedelt, stimmungsmäßig der «Lost Generation» Pariser Prägung vergleichbar, diente beim vorliegenden Roman die literarisch interessierte Mäzenatin Lady Ottoline Morrell als Vorlage für die titelgebende Protagonistin Clarissa Dalloway. Mit der in diesem Roman von 1925 avantgardistisch benutzten, damals neuartigen Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms gewährt Virginia Woolf einen tiefen Einblick in das Innerste ihrer Figuren, hier nun sehr konsequent großräumig eingesetzt als sprachliche Form, erlebte Rede und inneren Monolog einschließend. Aus dieser multiperspektivischen, vom Blickpunkt her willkürlich erscheinenden Erzählweise generiert sich letztendlich der eigentliche Plot, der auktoriale Erzähler selbst ist damit über weite Textabschnitte hinweg nicht mehr vernehmbar. Die stilistischen Parallelen zu dem drei Jahre vorher erschienenen «Ulysses» von James Joyce sind überdeutlich, und auch hier ereignet sich das gesamte Geschehen an einem einzigen Tage im Juni 1923. Als Tempus fugit- Symbol wird dabei leitmotivisch sehr wirkungsvoll immer wieder der Glockenschlag von Big Ben eingesetzt.
«Die Psyche des Menschen zu ergründen» sah Virginia Woolf als Aufgabe des Schriftstellers an, und so kreist ihr Roman, in dem sie sich Freuds neuartige Erkenntnisse der Psychoanalyse zunutze macht, um einige wenige Personen: Die 52jährige Clarissa Dalloway, eine Salondame der Oberschicht, Septimus Warren Smith, Kriegsveteran mit massiven posttraumatischen Störungen, der umtriebige Peter Walsh, nach fünf Jahren aus dem Kolonialdienst zurückgekehrter, ehemaliger Verehrer von Clarissa, sowie ein völlig unfähiger Psychiater. Mit Letzterem laufen die Fäden der beiden losen Handlungsstränge am Ende zusammen, auf jener Abendgesellschaft, deren Gastgeberin Clarissa ist und um deren Gelingen sich letztendlich alles dreht für sie. Was geschieht in diesem Roman, das erfahren wir zu großen Teilen nur durch den Gedankenfluss des jeweils im Fokus stehenden Protagonisten, entsprechend sprunghaft ist das Erzählte denn auch, ohne allerdings jemals unverständlich zu bleiben, wenn man denn den Text aufmerksam liest.
So ereignisarm dieser Plot um die beginnende Vereinsamung des Menschen in der modernen Massengesellschaft auch erscheint, so reich ist die Gedankenfülle, die da vor dem Leser ausgebreitet wird in Tausenden von Bildern, die breitgefächert Assoziationen auslösen, Gefühle wachrufen, Einblicke gewähren, Reflexionen anregen. Virginia Woolfs Sprache scheint anspruchsvoll, ist aber keineswegs artifiziell, mit zum Teil ausgedehnten Satzkonstruktionen, denen zu folgen dank gut durchdachtem, klarem Aufbau jedoch stets gelingt. Trotz seiner Kürze ein großer, ein grandioser Roman der Weltliteratur, den zu lesen man nicht versäumen sollte.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Roman „Mrs Dalloway“ der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) ist eines der wichtigsten Werke der literarischen Moderne. Das ganze Buch spielt sich an einem einzigen Tag im Juni des Jahres 1923 ab. Die 52-jährige Clarissa Dalloway, eine feine Dame der Londoner …
Mehr
Der Roman „Mrs Dalloway“ der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) ist eines der wichtigsten Werke der literarischen Moderne. Das ganze Buch spielt sich an einem einzigen Tag im Juni des Jahres 1923 ab. Die 52-jährige Clarissa Dalloway, eine feine Dame der Londoner Gesellschaft, bereitet eine ihrer berühmten Partys vor. Die Vorbereitungen werden nur unterbrochen von dem unerwarteten Besuch von Peter Walsh, einem alten Verehrer, der gerade aus Indien zurückgekehrt war. Seit der Ablehnung seines Heiratsantrags vor mehr als 30 Jahren hatte Clarissa ihn nicht mehr gesehen. Die neuerliche Begegnung bringt Mrs Dalloway an diesem Tag dazu, ihr Leben zu reflektieren; selbst über das Altern und den Tod denkt sie nach.
Ein besonderer Tag wird es auch für den Kriegsheimkehrer Septimus Warren Smith, der von Wahnvorstellungen geplagt wird. Er ist mit seiner Ehefrau Lucrezia auf dem Weg zu dem Psychiater Sir William Bradshaw. Als Smith von seinem alten Arzt aufgesucht wird, stürzt er sich aus dem Fenster. Nachdem Mrs. Dalloway davon erfährt, missfällt es ihr, dass in ihrer Party über den Tod geredet wird, obwohl sie sich selbst mit Selbstmordgedanken trägt.
Meisterhaft und mit inneren Monologen zieht Virginia Woolf die Leser immer tiefer in die Gedanken ihrer Figuren hinein und stellt damit zugleich deren Leben in Frage. Der Manesse-Band präsentiert den Roman in einer modernen Neuübersetzung von Melanie Walz, ergänzt durch ein Nachwort von Vea Kaiser.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Tausend Sterne für Virginia Woolf - - einen für diese Übersetzung
Ich finde die Übersetzung von Melanie Walz wirklich schlecht und möchte an einer kurzen Passage zeigen und erläutern, warum.
Doch vorab noch ein paar sehr subjektiv gefärbte Worte zum Werk …
Mehr
Tausend Sterne für Virginia Woolf - - einen für diese Übersetzung
Ich finde die Übersetzung von Melanie Walz wirklich schlecht und möchte an einer kurzen Passage zeigen und erläutern, warum.
Doch vorab noch ein paar sehr subjektiv gefärbte Worte zum Werk selber:
Es das schönste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Nach Monaten noch hallt es in mir nach und am Ende hatte ich tatsächlich richtig weinen müssen. So richtig existenzielles Geheul aus Leid und Freude am Dasein meine ich. (wahrscheinlich komme ich in die Wechseljahre (O: )
Genug also, um das Buch nach der Übersetzung von Hans-Christian Oeser im Original kennenlernen zu wollen.
Weil mein Englisch nicht so dolle ist, habe ich mich mit Wörterbuch und Reclambüchlein an die Arbeit gemacht und kam dann auf die Idee, Melanie Walz' Übersetzung mit der von Oeser zu vergleichen.
Gleich auf der ersten Seite fehlten mir die Krähen, die sowohl im Original als auch in anderen Übersetzungen steigen und fallen, und auch im Folgenden begegneten mir immer wieder Ungenauigkeiten.
Ich habe diese Übersetzung endgültig beiseite gelegt, nachdem ich folgende Passage gelesen hatte, in der Mrs. Dalloway die Einkaufsstraße entlanggeht, an einem Geschäft für Lederwaren vorbeikommt und an ihre Tochter zu denken beginnt:
“Gloves and shoes; she had a passion for gloves; but her own daughter, her Elizabeth, cared not a straw for either of them.
Not a straw, she thought, going up on Bond Street to a shop where they kept flowers for her when she gave a party. Elizabeth really cared for her dog most of all. The whole house this morning smelt of tar. Still, better poor Grizzle than Miss Kilman; better distemper and tar and all the rest of it than sitting mewed in a stuffy bedroom with a prayer book.“
Walz macht daraus:
“Handschuhe und Schuhe; sie liebte Handschuhe; aber ihre Tochter Elizabeth konnte mit beidem nichts anfangen.
Bloß kein Stroh, dachte sie, als sie die Bond Street entlang zu einem Geschäft ging, in dem die Blumen für sie zurechtgemacht wurden wenn sie eine Party gab. Was Elizabeth wirklich am Herzen lag, war ihr Hund. Das ganze Haus roch an diesem Morgen nach Teer. Immer noch lieber der arme Grizzle als Miss Kilman; lieber Übellaunigkeit und Teer und alles Übrige, als mit einem Gebetbuch in ein stickiges Schlafzimmer eingesperrt zu werden.“
Dazu:
- Elizabeths pietistische Abneigung gegen Putz wird nicht so deutlich, wenn man sagt, jemand könne “damit nichts anfangen“. “Sie gibt keinen Pfifferling darauf“ ist deutlich stärker und zudem die deutsche Entsprechung der Redewendung “to care not a straw“
- “Not a straw“ dann beim zweiten Mal wortwörtlich zu übersetzen, ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn
- “distemper“, hier - im Grunde nicht falsch - mit “Übellaunigkeit“ übersetzt, ist auch die englische Bezeichnung für die Krankheit Staupe, die früher mit Teer behandelt wurde.
- zuletzt “werden“ weder Elizabeth noch Miss Kilman in ein Schlafzimmer eingesperrt, sondern ziehen sich höchst freiwillig dorthin zurück. Mrs. Dalloways zusätzlich abwertendes “mewed“, lässt Walz gleich ganz unter den Tisch fallen.
Bei Oeser klingt das so:
“Handschuhe und Schuhe; für Handschuhe hatte sie eine wahre Leidenschaft; doch ihre eigene Tochter, ihre Elizabeth, gab auf beides keinen Pfifferling.
Keinen Pfifferling, dachte sie, als sie die Bond Street hinaufging zu einem Geschäft, wo man, wenn sie eine Gesellschaft gab, Blumen für sie zurücklegte. Eigentlich machte Elizabeth sich am meisten aus ihrem Hund. Heute morgen hatte das ganze Haus nach Teer gerochen. Immerhin, lieber der arme Grizzle als Miss Kilman. Lieber Staupe und Teer und alles andere, als sich murrend mit einem Gebetbuch in ein stickigen Schlafzimmer einzuschließen.“
Von der wahren Leidenschaft über die Gesellschaft und die zurückgelegten Blumen bis hin zur Staupe ist dies eine inhaltlich korrekte Übersetzung und im Wortlaut so dicht am Original wie es m. E. wünschenswert ist. UND es ist schönes, keinesfalls angestaubt wirkendes Deutsch, sondern sowohl dem 100 Jahre alten Roman angemessen als auch für die heutige Leserin sehr gut verständlich, finde ich.
Für meinen Geschmack nimmt Walz sich mit Weglassungen, Verkürzungen, eigenwilligen Interpretationen und Ungenauigkeiten allzu viele Freiheiten gegenüber dem Werk heraus. Das ist oft sinnentstellend und mitunter sogar sinnentleerend.
Wer also Lust auf etwas hat, das dem Original gerecht wird, greife zu einer der Ausgaben aus dem Reclam-Verlag mit der Übersetzung von Hans-Christian Oeser.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Für den modernen Leser liest sich das Buch ungewohnt, denn es hat keinen wirklichen Handlungsbogen. Was tatsächlich passiert, ist zweitrangig - wichtig ist, was in den Köpfen der Charaktere vor sich geht, die über die verschiedensten Themen nachdenken: Vergänglichkeit und …
Mehr
Für den modernen Leser liest sich das Buch ungewohnt, denn es hat keinen wirklichen Handlungsbogen. Was tatsächlich passiert, ist zweitrangig - wichtig ist, was in den Köpfen der Charaktere vor sich geht, die über die verschiedensten Themen nachdenken: Vergänglichkeit und das unaufhaltsame Verstreichen der Zeit, die Auswirkungen des Krieges auf die Psyche eines Menschen (und da finden sich Parallelen zur psychischen Erkrankung der Autorin), Liebe und Sexualität, gescheiterte Hoffnungen... Fast alle denken darüber nach, was hätte sein können, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätten und ihr Leben dadurch nur ein klein wenig anders gelaufen wäre. Tatsächlich scheinen die meisten das Gefühl zu haben, dass sie etwas verpasst haben und etwas Wichtiges in ihrem Leben vermissen, und die Vergangenheit nimmt in ihren Gedanken mehr Raum ein als die Gegenwart.
Was dieses Buch so originell macht, ist daher auch nicht die Handlung, sondern die Erzählweise: "Stream of Consciousness", Strom des Bewusstseins - eine Technik, die zum Beispiel auch James Joyce in seinem epischen Werk "Ulysses" einsetzte. Die Prosa bleibt immer ganz nahe dran an den Gedanken des Charakters, aus dessen Sicht wir die Geschehnisse gerade sehen, so gut wie ungefiltert. Das ist nicht immer einfach zu lesen, denn da springen die Gedanken schon mal unvermittelt von einem Thema zum nächsten, Worte und Satzfetzen wiederholen sich... Aber für mich hatte das etwas unwiderstehlich Hypnotisches, eine echte Sogwirkung. Ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, für einen Moment durch fremde Augen zu sehen. Ich fand den Schreibstil großartig und einzigartig - er spricht oft über Banalitäten, aber darin verbirgt sich so viel.
Deswegen war das Buch für mich auch nicht spannend, wie ein Krimi spannend ist, aber ich konnte es dennoch kaum weglegen, weil ich wissen wollte, ob die Charaktere im Laufe des Tages zu Schlüssen über sich selbst und ihr Leben kommen und vielleicht sogar etwas ändern würden. Tatsächlich hat der innere Tumult, der sich in den Köpfen abspielt, dann erstaunlich wenig greifbare Auswirkungen - wobei einer der Charaktere letztendlich doch eine drastische und tragische Entscheidung trifft.
Die Charaktere kamen mir alle sehr echt und glaubhaft vor. Virginia Woolf lässt den Strom ihrer Gedanken, die sich im immer gleichen Kreise um Liebe und Verlust, Wünsche und Bedauern, Wahrheit und Wahnsinn drehen, ganz natürlich fließen. Besonders Septimus hat mich sehr berührt, denn aus seinen Gedanken spricht unendlicher Schmerz, was aber niemand zu verstehen scheint. Tragischerweise kam er mir vor wie derjenige, der von allen Charakteren noch am nächsten daran herankam, sein Leben in die Hand zu nehmen und es zu verändern.
Interessant fand ich, dass die Autorin auch das Thema Homosexualität ganz nebenher anschneidet: Clarissa Dalloway fühlte sich in ihrer Jugend zu einer anderen Frau hingezogen, und ihre Tochter ist mit einer Frau befreundet, die ebenfalls in sie verliebt zu sein scheint.
Auch der Krieg ist unterschwellig allgegenwärtig in diesem Buch - er ist zwar vorbei, aber die Menschen haben sich noch lange nicht davon erholt. Ich fand sehr bestürzend, wie wenig Verständnis man zu der Zeit anscheinend noch den Veteranen entgegen brachte, die von ihren Erlebnissen völlig traumatisiert waren. Die Autorin zeigt das sehr eindringlich am Beispiel von Septimus, von dem scheinbar erwartet wird, dass er sich einfach zusammenreißt und wieder zu einem produktiven Mitglied der Gesellschaft wird, obwohl er kurz vor dem Zusammenbruch steht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
!ein Lesehighlight 2022!
Klappentext:
„Es ist ein besonderer Tag im Leben der zweiundfünfzigjährigen Clarissa Dalloway: Die Gattin eines Parlamentsabgeordneten will am Abend eine ihrer berühmten Upper-class-Partys geben. Der Tag vergeht mit Vorbereitungen, …
Mehr
!ein Lesehighlight 2022!
Klappentext:
„Es ist ein besonderer Tag im Leben der zweiundfünfzigjährigen Clarissa Dalloway: Die Gattin eines Parlamentsabgeordneten will am Abend eine ihrer berühmten Upper-class-Partys geben. Der Tag vergeht mit Vorbereitungen, zufälligen Begegnungen mit Jugendfreunden, Konversation, nostalgischen Betrachtungen, Sinneseindrücken beim Flanieren ... Ein besonderer Tag soll es – aus ganz anderen Gründen freilich – auch für Septimus Smith werden. Auch ihn, den Kriegsheimkehrer, beschäftigt die Gegenwärtigkeit des Vergangenen in jedem einzelnen Augenblick. In permanent sich wandelnden Empfindungen, Visionen und Assoziationen der Figuren entsteht ein faszinierendes Zeit- und Gesellschaftsbild Englands, rhythmisiert vom Stundenschlag des Big Ben. Romantische, nüchterne und satirische Stimmungslagen fließen ineinander, Melancholie und Contenance, tiefgründiger Witz und leise Wehmut durchziehen Virginia Woolfs Meisterwerk moderner Erzählkunst. Im Dezember 1924 notierte sie in ihr Tagebuch: «Ich glaube ganz ehrlich, dass dies der gelungenste meiner Romane ist.»“
Ein Klassiker im neuen Gewand ist immer so eine Sache. Gerade wenn es auch um eine Neuübersetzung geht. Diese Neuübersetzung hier wurde von Melanie Walz verfasst. Und was soll ich sagen? Sie ist ihr mehr als gelungen und trifft einfach jeden wichtigen Punkt um diese Geschichte so zu halten wie notwendig! Es ist eine Kunst einen Klassiker in seiner Atmosphäre nicht zu verschandeln aber dennoch in der heutigen Sprache und des Sprachgebrauchs verständlich zu erzählen ohne das man zu viele Fragezeichen beim lesen erfährt. Walz hat hier wirklich diese Aufgabe bravurös gemeistert (durch Fußnoten gibt es immer wieder Aufklärung)! Virgina Woolfs Geschichte „Mrs. Dalloway“ ist ein Klassiker, ein Zeitzeugnis und in gewisser Weise ein Erbe an die Leserschaft Woolfs. Die Geschichte rund um Clarissa zeigt nicht nur das Privatleben der damaligen Zeit auf mit all ihren Höhen, Tiefen und Gepflogenheiten (da staunt man heute mehr als genug) was damals so „normal“ war) sondern auch die Gesellschaft an sich. Woolf zeigte immer Biss und Humor in ihren Geschichten, so auch hier. Als Leser eröffnet sich hier regelrecht ein Feuerwerk der Wortspielereien, der versteckten Witze und Pointen, ein Feingefühl für die Darstellung der Damenwelt aber auch der Welt der Herren. Woolf zeigt dem Leser hier so viel auf, das man wahrlich erstaunt ist, welches Miniformat der Verlag für diese Neuübersetzung gewählt hat. Gerade mal 9.8 x 2.3 x 15.5 cm misst dieser Winzling und bombardiert den Leser dennoch mit allem was geht. Woolf hätte sicherlich herzhaft über dieses Buchformat gelacht und wäre entzückt gewesen wie klein und doch so gewaltig ein Werk von ihr wirken kann. Für dieses Meisterwerk gibt es 5 von 5 Sterne und ein Hoch auf die Übersetzerin!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Als Virginia Woolf 1925 im eigenen Verlag ihren vierten Roman "Mrs. Dalloway" veröffentlichte, galt dieser als stilistisch und sprachlich revolutionär, weil er mit den gewohnten erzählerischen Konventionen brach. Mehr als jeder andere Roman zuvor. Und auch sie selbst …
Mehr
Als Virginia Woolf 1925 im eigenen Verlag ihren vierten Roman "Mrs. Dalloway" veröffentlichte, galt dieser als stilistisch und sprachlich revolutionär, weil er mit den gewohnten erzählerischen Konventionen brach. Mehr als jeder andere Roman zuvor. Und auch sie selbst notierte in ihrem Tagebuch: "Ich glaube ganz ehrlich, dass dies der gelungenste meiner Romane ist." So erfahren wir es im Klappentext der jüngsten Ausgabe, die kürzlich in der Manesse Bibliothek erschienen ist. Es handelt sich dabei um eine deutsche Neuübersetzung von Melanie Walz, ergänzt und aufgewertet durch ein Nachwort der österreichischen Schriftstellerin Vea Kaiser.
Und tatsächlich kann man Woolfs Stil als unkonventionell und modern bezeichnen, ihr in "Mrs. Dalloway" als Erzählform verwendeter Bewusstseinsstrom findet sich auch heute noch in der zeitgenössischen Literatur: meisterlich und aufregend beispielsweise in Damon Galguts mit dem Booker Prize ausgezeichneten "Das Versprechen", etwas weniger spannend in Tanguy Viels Me-Too-Krimi "Das Mädchen, das man ruft". Was die beiden letztgenannten Romane aber von "Mrs. Dalloway" grundlegend unterscheidet, ist die Handlungsebene. Denn Virginia Woolf verzichtet fast vollständig auf diese und setzt komplett auf das Innenleben ihrer Figuren.
So lässt sich die Handlung auch knapp zusammenfassen: An einem Londoner Junitag des Jahres 1923 macht sich die 51-jährige Clarissa Dalloway auf, um Blumen für ihre am Abend stattfindende Party der sogenannten Upper Class zu besorgen. Die gesamte - überschaubare - Handlung konzentriert sich auf diesen einzigen Tag, den Rhythmus gibt dabei Big Ben mit seinem Glockenschlag als wiederkehrendes Motiv vor. Neben Mrs. Dalloway rückt als ihr Gegenpart der kriegstraumatisierte Septimus Warren Smith als nahezu gleichberechtigter zweiter Protagonist in den Mittelpunkt des Interesses.
Dieser Septimus ist in meinen Augen dann auch die mit Abstand interessanteste Figur des Romans. Eindringlich nähert sich Woolf diesem zerbrechlichen Mann, der stets auf der schmalen Linie zwischen Leben und Tod zu balancieren scheint. Eine besondere Note erhält Septimus' Charakterisierung, wenn man im Hinterkopf behält, dass Virginia Woolf selbst im Jahre 1941 den Freitod wählte.
Die anderen Figuren habe ich inklusive Mrs. Dalloway hingegen als recht beliebig und banal wahrgenommen. Die gesellschaftlichen Themen, die die feinen Damen und Herren beschäftigen, wirken austauschbar und bisweilen sogar platt. Wobei zu betonen ist, dass man Woolfs Absicht im Hinblick auf diesen Aspekt berücksichtigen muss: die Darstellung der britischen Nachkriegsgeneration in all ihren Aspekten. Leider konzentriert sie sich dabei jedoch auf zwei Extreme: die Upper Class und den traumatisierten Soldaten. Figuren aus der Mitte der Gesellschaft tauchen mit Ausnahme des ehemaligen Dalloway-Geliebten Peter Walsh kaum auf.
Hinzu kommt, dass es die Sprache ebenso wenig schaffte, mich mitzureißen, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Denn grundsätzlich bin ich ein Freund des erzählerischen Bewusstseinsstroms und schätze gute und ausgiebige Beschreibungen ebenso wie eine starke Atmosphäre. Zwar ist der Stil modern, aber nicht die Sprache selbst, die bisweilen arg repetitiv wirkt. Wenn beispielsweise innerhalb dreier Seiten ganze neun Mal wiederholt wird, dass Peter Walsh aktuell verliebt sei, dann hatte selbst ich es wohl nach der fünften Wiederholung begriffen.
Hervorzuheben ist dennoch der Mut der Autorin, die nicht nur die literarischen Konventionen außer Acht lässt, sondern durchaus auch gesellschaftlich heikle Themen anspricht: Kriegsfolgen, Umgang mit psychischen Erkrankungen, Auseinanderdriften der Gesellschaft, Homosexualität, Suizid.
Um auf den berühmten Film- und Theaterstücktitel von Edward Albee "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" zurückzugreifen, sollten sich potenzielle Leser:innen vor der Lektüre also fragen: "Wer hat Angst vor dem Bewusstseinsstrom?" und lieber einmal zu einer Leseprobe greifen, bev
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für