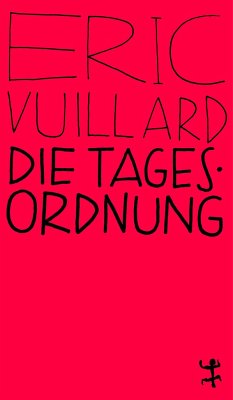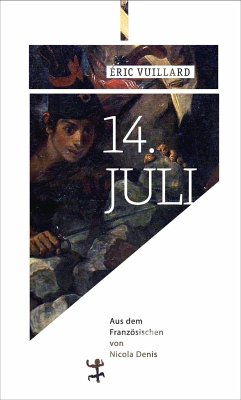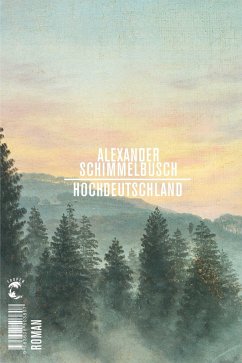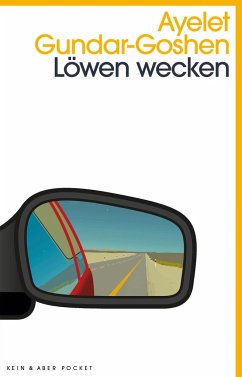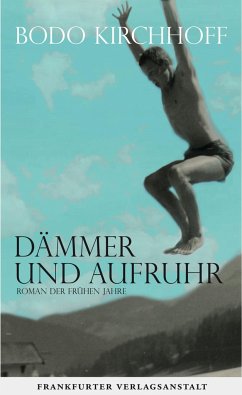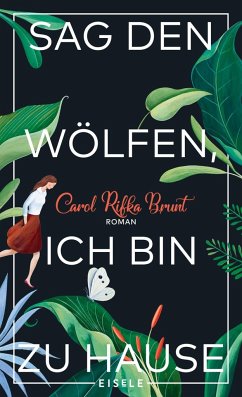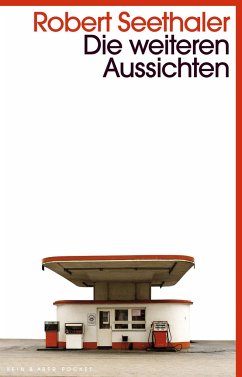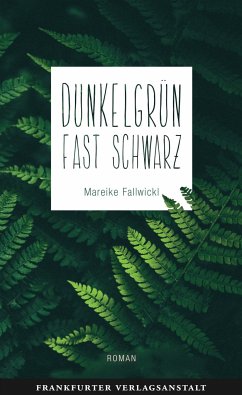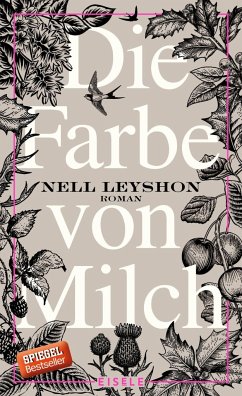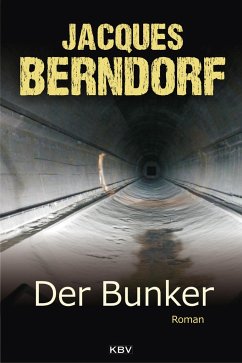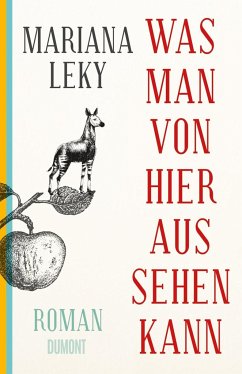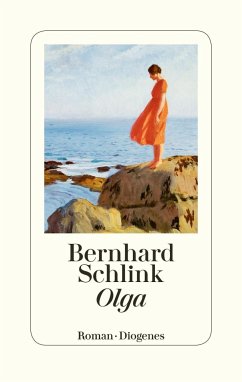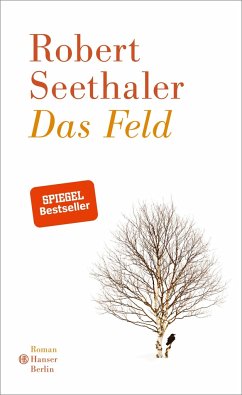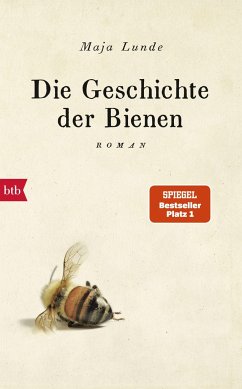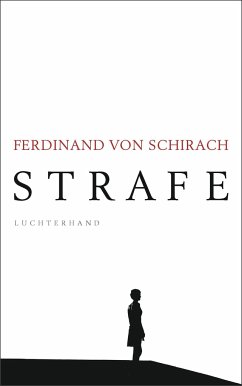Nicht lieferbar
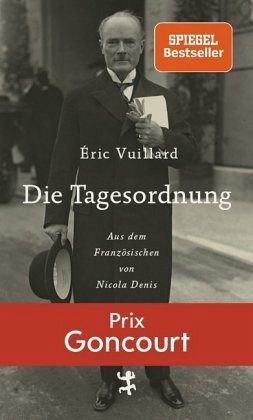
Die Tagesordnung
Ausgezeichnet 2017 mit dem Prix Goncourt
Übersetzung: Denis, Nicola
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Prix Goncourt 201720. Februar 1933: Auf Einladung des Reichstagspräsidenten Hermann Göring finden sich 24 hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen mit Adolf Hitler ein, um über mögliche Unterstützungen für die nationalsozialistische Politik zu beraten: Krupp, Opel, BASF, Bayer, Siemens, Allianz - kaum ein Name von Rang und Würden fehlt an den glamourösen runden Tischen der Vermählung von Geld und Politik. So beginnt der Lauf einer Geschichte, die Vuillard fünf Jahre später in die Annexion Österreichs münden lässt. Bild- und wortgewaltig führt er den Leser in die Hint...
Prix Goncourt 201720. Februar 1933: Auf Einladung des Reichstagspräsidenten Hermann Göring finden sich 24 hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen mit Adolf Hitler ein, um über mögliche Unterstützungen für die nationalsozialistische Politik zu beraten: Krupp, Opel, BASF, Bayer, Siemens, Allianz - kaum ein Name von Rang und Würden fehlt an den glamourösen runden Tischen der Vermählung von Geld und Politik. So beginnt der Lauf einer Geschichte, die Vuillard fünf Jahre später in die Annexion Österreichs münden lässt. Bild- und wortgewaltig führt er den Leser in die Hinterzimmer der Macht, wo in erschreckender Beiläufigkeit Geschichte geschrieben wird. Dabei erzählt er eine andere Geschichte als die uns bekannte, er zeigt den Panzerstau an der deutschen Grenze zu Österreich, er entlarvt Schuschniggs kleinliches Festhalten an der Macht, Hitlers abgründige Unberechenbarkeit und Chamberlains gleichgültige Schwäche. Mit der ihm eigenen virtuosen Eindringlichkeit und satirischem Biss seziert Vuillard die Mechanismen des Aufstiegs der Nationalsozialisten und macht deutlich: Die Deals, die an den runden Tischen der Welt geschlossen werden, sind faul, unser Verständnis von Geschichte beruht auf Propagandabildern. In »Die Tagesordnung« zerlegt Éric Vuillard diese Bilder und fügt sie virtuos neu zusammen: Ein notwendiges Buch, das eine überfällige Geschichte erzählt und damit den wichtigsten französischen Literaturpreis erhielt.