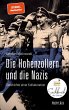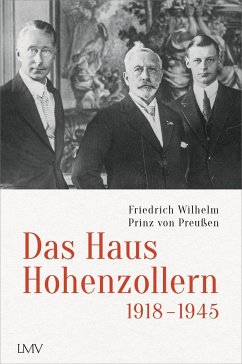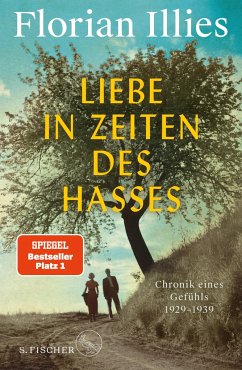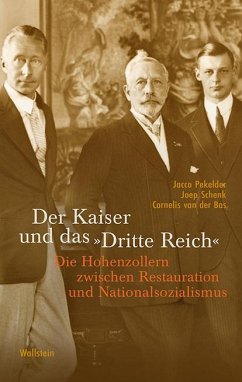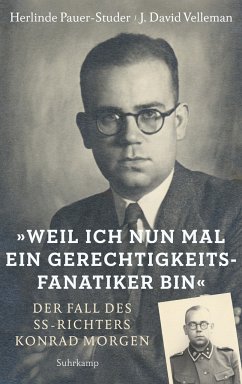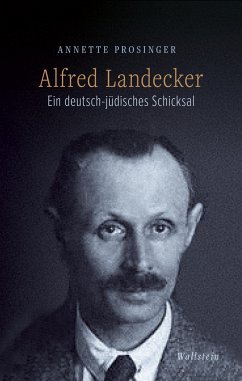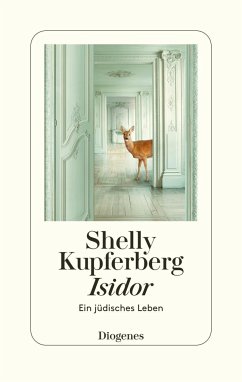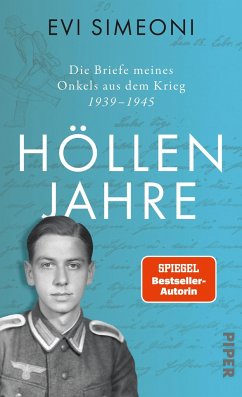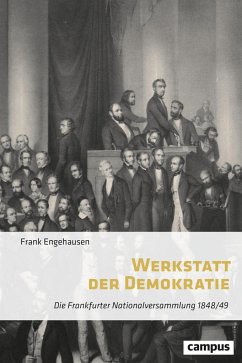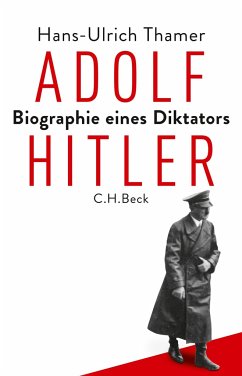Nicht lieferbar
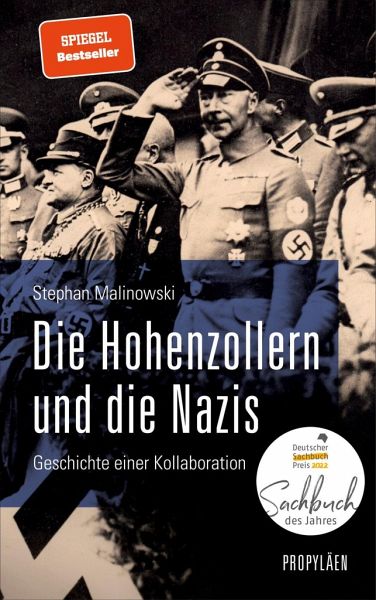
Stephan Malinowski
Gebundenes Buch
Die Hohenzollern und die Nazis
Geschichte einer Kollaboration Ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2022
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





"Stephan Malinowski [erzählt] für das große Publikum, wie Mitglieder der Monarchenfamilie zu Steigbügelhaltern Hitlers wurden." Lothar Müller, Süddeutsche ZeitungSeit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erz...
"Stephan Malinowski [erzählt] für das große Publikum, wie Mitglieder der Monarchenfamilie zu Steigbügelhaltern Hitlers wurden." Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung
Seit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erzählung zieht Stephan Malinowski den Bogen über drei Generationen von 1918 bis in die Gegenwart und beschreibt das politische Milieu, in dem sich ihre Akteure bewegten.
Seit über 100 Jahren haben die »Oberhäupter« der Hohenzollern immer wieder mit Juristen, Historikern, Journalisten, Ghostwritern und PR-Beratern zusammengearbeitet, mit deren Hilfe sie das Bild der Familie in der Öffentlichkeit aufpolierten. Nun werden Rollen und Selbstdarstellung der wichtigsten Familienmitglieder von einem der besten Kenner der Materie erstmals analysiert und dargestellt: In einer großen historischen Erzählung zieht Stephan Malinowski den Bogen über drei Generationen von 1918 bis in die Gegenwart und beschreibt das politische Milieu, in dem sich ihre Akteure bewegten.
STEPHAN MALINOWSKI, geboren 1966 in Berlin, studierte und lehrte Geschichte in Berlin, Frankreich, Italien, den USA und Irland. Seit 2012 lehrt er Europäische Geschichte an der University of Edinburgh. Sein Buch Vom König zum Führer über den deutschen Adel und die NS-Bewegung wurde mit dem Hans-Rosenberg-Preis ausgezeichnet. Das Gutachten, das er im Auftrag des Landes Brandenburg 2014 erstellte, spielt in der Diskussion um die vom 'Chef des Hauses' Hohenzollern geltend gemachten Restitutionsansprüche eine wichtige Rolle.
Produktdetails
- Verlag: Propyläen
- 6. Aufl.
- Seitenzahl: 752
- Erscheinungstermin: 27. September 2021
- Deutsch
- Abmessung: 225mm x 151mm x 49mm
- Gewicht: 836g
- ISBN-13: 9783549100295
- ISBN-10: 3549100299
- Artikelnr.: 62053327
Herstellerkennzeichnung
Propyläen Verlag
Friedrichstraße 126
10117 Berlin
Info@Ullstein-Buchverlage.de
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensent Hans von Trotha empfiehlt das Buch des Historikers Stephan Malinowski über die Rolle der Hohenzollern beim Aufstieg der Nationalsozialisten. Umfassend, grundlegend zeigt ihm der Autor wie die Familie ihren Einfluss nicht für den Widerstand gegen Hitler einsetzte, sondern für sein Fortkommen. Malinowski zeigt die "tiefe (rechte) Überzeugung" des ehemaligen Kronprinzen und anderer Akteure. Trotha taucht ein in die rechten Milieus der Weimarer Republik und erkennt, wie sich im Buch der juristische (um die Restitutionsfrage) und der historische Diskurs begegnen. Anschaulich, eindringlich und spannend zu lesen, verspricht er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.10.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.10.2021Im Spiegelsaal der Projektionen
Frontbegradigung 1933: Stephan Malinowski erklärt mit der Krise des Charismas, dass die Hohenzollern sich mit den Nationalsozialisten gemeinmachten.
Wie stand Wilhelm von Preußen, der ehemalige deutsche Kronprinz, zum Regierungs- und Systemwechsel des Jahres 1933? Über diese Frage wird in Gerichtsgutachten und Zeitungsartikeln heftig gestritten. Dabei hatte sich der hohe Herr gnädigerweise zeitig herabgelassen, durch schriftliche Mitteilung "etwaige Zweifel in der Frage meiner Einstellung zur jetzigen innenpolitischen Lage zu beseitigen". In einem auf den 17. März 1933 datierten Schreiben an die Verwalter seiner schlesischen Güter, dessen Abdruck in Stephan Malinowskis Buch über die
Frontbegradigung 1933: Stephan Malinowski erklärt mit der Krise des Charismas, dass die Hohenzollern sich mit den Nationalsozialisten gemeinmachten.
Wie stand Wilhelm von Preußen, der ehemalige deutsche Kronprinz, zum Regierungs- und Systemwechsel des Jahres 1933? Über diese Frage wird in Gerichtsgutachten und Zeitungsartikeln heftig gestritten. Dabei hatte sich der hohe Herr gnädigerweise zeitig herabgelassen, durch schriftliche Mitteilung "etwaige Zweifel in der Frage meiner Einstellung zur jetzigen innenpolitischen Lage zu beseitigen". In einem auf den 17. März 1933 datierten Schreiben an die Verwalter seiner schlesischen Güter, dessen Abdruck in Stephan Malinowskis Buch über die
Mehr anzeigen
Hohenzollern und die Nationalsozialisten fast eine ganze Seite füllt, heißt es, Wilhelm begrüße "den Zusammenschluß aller nationalen Kräfte, die sich in der schwarz-weiß-roten Front und der nationalsozialistischen Bewegung als Einheitsfront verkörpern".
Von "allen in meinem Dienst stehenden Beamten, Angestellten und Arbeitern" verlangte der Verfasser totalen Einsatz "im Sinne der nationalen Idee". Diese Anweisung eines Großgrundbesitzers ist im Gestus einer Proklamation abgefasst, als spräche er zum ganzen Volk. Im Habitus einer fürstlichen Persönlichkeit war es dasselbe, eine Haltung auszudrücken und Gefolgschaft zu erwarten. "Ich wünsche, daß diese meine Auffassung zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, wobei zu bemerken ist, daß ich abweichendes Verhalten nicht dulden kann und werde." Ganz der Papa, wird man sagen, wenn man in der großen Biographie Wilhelms II. von John Röhl gelesen hat, wie der Kaiser und Ex-Kaiser aller Welt, auch Standesgenossen ("Na warte, Wittelsbach") und den eigenen Kindern, allerhöchste Intoleranz androhte.
Dieses Schriftstück, möchte man glauben, braucht dem Verwaltungsgericht Potsdam nur vorgelegt zu werden, um die Frage zu erledigen, ob Wilhelm dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub leistete und seine Erben deshalb von Zahlungen nach dem Ausgleichsleistungsgesetz auszuschließen sind. Leider ist der Brief im Original verschollen. Malinowski zitiert ihn nach zwei Veröffentlichungen von Willibald Gutsche, einem 1992 verstorbenen Professor am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, dessen Forschungen auch im Westen Anerkennung fanden. In der von Gutsche genannten Akte der Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz fehlt der Brief; er soll das erste Blatt der Akte gewesen sein. Malinowski vermerkt: "Der Verbleib des Schreibens ließ sich nicht klären."
An dieser Stelle hätte man sich eine quellenkritische Überlegung mit Angaben zum Zustand der Akte vorstellen können. Wollte man in einem Gedankenspiel die Möglichkeit einer Fälschung zulasten der Familie von Preußen in Erwägung ziehen, könnte man es für auffällig halten, dass Wilhelm im zeithistorischen Rückblick die Konvergenz von persönlichem Handeln und nationaler Entwicklung betont, als hätte er seine Sätze fürs Geschichtsbuch diktiert: Er empfinde es "persönlich als eine besondere Genugtuung, daß das Ziel, wofür ich mich seit Jahr und Tag mit ganzem Herzen eingesetzt habe, endlich erreicht ist". Aber solche Selbsthistorisierung mit Unterstellung teleologischer Stringenz ist typisch für die Denkungsart im Adel, ganz besonders bei den sprunghaften Hohenzollern. Und zum Anspruch Wilhelms, sich einen Anteil an der Wende des 30. Januars zuzurechnen, findet man bei Malinowski eine Parallelüberlieferung aus dem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang des Ereignisses. Am Tag der Berufung des Kabinetts Hitler bekundete Wilhelm gegenüber Sigurd von Ilsemann, dem Adjutanten seines Vaters in Doorn, "wie glücklich er sei, daß in Deutschland jetzt eine nationale Regierung gebildet sei, für die er seit einem Jahr gearbeitet habe".
Doch selbst wenn - um in der Manier der apologetischen Haushistoriografie jede noch so fernliegende Denkmöglichkeit durchzuspielen - unser hypothetischer Erfinder des Briefs vom 17. März 1933 diese Stelle aus Ilsemanns 1968 veröffentlichtem Tagebuch paraphrasiert hätte: Die Argumentation Malinowskis, dessen Forschungen aus einem im Auftrag des Landes Brandenburg erstatteten Gutachten hervorgegangen sind, ist auf das Vorzeigen einer schmauchenden Tatwaffe weder angelegt noch angewiesen. Zu dicht belegt sind die Unterstützungshandlungen des Thronanwärters bei der Beseitigung der Republik und der Errichtung der Diktatur, als dass es auf eine einzelne Quelle ankommen könnte.
Umfassend unterrichtet Malinowski über die viel diskutierten Stationen der Verschmelzung von schwarz-weiß-roter, also kaiserlicher, und nationalsozialistischer, unter der Hakenkreuzflagge in denselben Farben marschierender Front, von Wilhelms Projekt einer Kandidatur bei der Reichspräsidentenwahl 1932 über seine Eingaben gegen das Verbot von SA und SS bis zu den Massenaufmärschen mit dekorativer Prinzenpräsenz im ersten Jahr des neuen Staates. Geduldig zerlegt Malinowski die entlastenden Konstruktionen, mit denen sich ein bedeutender Historiker wie Wolfram Pyta, Biograph Hindenburgs und Hitlers mit besonderem Interesse an einem operablen Begriff des Charismas, den Blick auf einfache Sachverhalte verbaut hat. Aber das eigentlich Neue und Weiterführende in Malinowskis Buch sind seine Überlegungen darüber, wie man sich die Wirkung der Unterstützungshandlungen vorzustellen und zu erklären hat.
Bündig schreibt er im Schlusskapitel: Die Unterstützung war "nicht 'nur' symbolisch, sondern sie leistete eben darin, dass sie vor allem symbolisch war, präzise das, was der Beitrag des Hochadels nach 1918 noch sein konnte: die Darstellung von Machtkonstellationen". Reichsaußenminister Gustav Stresemann hatte die Kaisersöhne wegen ihrer eifrigen Mitwirkung an Kundgebungen des "Stahlhelms", des republikfeindlichen "Bundes der Frontsoldaten", als "Reklameprinzen" verspottet. Kurioserweise sind es heute die letzten Fans der Hohenzollern in der deutschen Historikerzunft, die als wissenschaftliche Advokaten von Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem aktuellen "Chef" des "Hauses", die Devise ausgeben, dass es mit der Reklamewirkung der Preußenprinzen nicht mehr so weit her gewesen sei.
Malinowski kann demgegenüber nicht nur auf die gewaltigen Menschenmengen verweisen, die 1921 der Kaiserin Auguste Victoria und 1940 dem in Frankreich gefallenen Prinzen Wilhelm, dem ältesten Sohn des Kronprinzen, die letzte Ehre erwiesen; diese Demonstrationen volkstümlicher Loyalität wurden politisch verstanden. Denn auf Sichtbarkeit kam es an in den feudalen Treuebeziehungen, die da unter den Bedingungen der Massenkommunikation noch einmal reproduziert wurden. Durch bloße Akte der Präsenz beschäftigten die Prinzen die politische Fantasie, wie Malinowski an der Weltpresse zeigt, besonders gerne mit Provinzzeitungen aus den Vereinigten Staaten. Den Söhnen des Weltkriegstreibers im Exil wurden die abenteuerlichsten Restaurationspläne zugeschrieben. Nach 1933 galten sie mancherorts als geborene Widerständler, sodass sich nach dem Attentat Georg Elsers das Gerücht verbreitete, der Kronprinz sei verhaftet und enthauptet worden. Wer das Image der Hohenzollern untersucht, spaziert durch einen Spiegelsaal der Projektionen. Aber dass ein Mann wie Wilhelm, berühmt dafür, berühmt zu sein, etwas bewirkte, wenn er vor der Potsdamer Garnisonkirche oder auf der Diplomatentribüne des Reichstags erschien, ist keine Einbildung.
Nun bleibt Charisma per definitionem etwas Ungreifbares. Es ist der Clou von Malinowskis Argumentation, dass er die von den Apologeten der Hohenzollern beschworene Krise des dynastischen Charismas zu einem Beweisstück der Anklage umfunktioniert: Sie lieferte ein starkes Motiv für Anpassung und Kollaboration.
Ratlos und verbittert standen die Entthronten in der neuen, republikanischen Welt herum, wo sie sich nicht nur mit ihren alten Feinden konfrontiert sahen, den Demokraten und Sozialisten, sondern auch mit unbehaglich modernen Varianten der Werte der eigenen Lebensform. In ihren antidemokratischen und antisozialistischen Kreisen kamen Ideen einer meritokratischen Aristokratie in Mode, wie sie Alexandra Gerstners Monographie "Neuer Adel" dargestellt hat. Und noch gefährlicher für ihre Stellung war das Konzept, Alleinherrschaft nicht mehr auf Erbfolge, sondern auf Führertum zu gründen.
Malinowski betont sehr stark, dass Kaiser und Kronprinz durch die Flucht im November 1918 ihrem Ansehen in den Augen der Adligen und Adelssympathisanten geschadet hatten, für die ritterliche Tugenden noch kein leerer Wahn waren. In dieser Lage konnten die Hohenzollern versuchen, sich selbst zu Vertretern des zeitgemäßen Leistungsethos zu stilisieren oder ein Bündnis mit den neuen Führungskräften einzugehen. Beides probierten sie aus. In der Bundesrepublik zogen Vertreter der Familie später bis vor das Bundesverfassungsgericht, um sich das Recht bestätigen zu lassen, ihren "Chef" gemäß dem "Hausgesetz" auszuwählen, das hieß auf die Befolgung der Regeln für "ebenbürtige" Heiraten zu verpflichten. Die Söhne Wilhelms II. hatten dieses Prinzip der Magie des Blutes im Zweiten Weltkrieg zur Disposition gestellt: Künftige Prinzen sollten Frauen freien dürfen, mit denen sie "tüchtige, im Leben ihren Mann stehende, zu Führern sich eignende Nachkommen" zeugen würden. Der Ex-Kronprinz gab zu Protokoll, dass auch die "Tochter eines westfälischen Bauern" in Betracht komme, sofern sie "arisch" sei.
Anfang 1933 hatte er seiner Schwester Viktoria Luise berichtet, er habe 1923 mit Oswald Spengler über den kommenden Mann gesprochen, der weder Fürst noch General sein werde. In Gestalt Hitlers sei er nun erschienen. Nach dem Krieg redete Wilhelm sogleich wieder mit ausländischen Journalisten, um zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, dass er in Hitler von Anfang an den Schwätzer erkannt habe.
Der von Spengler zur Nachahmung empfohlene italienische Faschismus bot das Modell eines Bundes von Thron und Führerbalkon, das hinter den Planspielen von 1932/33 unschwer zu erkennen ist. Dass im Adel der Weimarer Republik "sozialer Niedergang und politische Radikalisierung" Hand in Hand gingen, wies Malinowskis preisgekrönte Doktorarbeit nach. So gesehen sind die Hohenzollern eine ganz normale Adelsfamilie. Egalisierung der Schicksale ist die demokratische Pointe der Sozialgeschichte. Die Kaisersöhne, die Stammtafeln gegen Ariernachweise tauschen, um den welthistorischen Anschluss nicht zu verpassen, benehmen sich wie Parvenus. Malinowskis Verfallsstudie belehrt und amüsiert als Gesellschaftsroman einer durch und durch verkehrten Welt. PATRICK BAHNERS
Stephan Malinowski: "Die Hohenzollern und die Nazis". Geschichte einer Kollaboration.
Propyläen Verlag, Berlin 2021. 752 S., Abb., geb., 35,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Von "allen in meinem Dienst stehenden Beamten, Angestellten und Arbeitern" verlangte der Verfasser totalen Einsatz "im Sinne der nationalen Idee". Diese Anweisung eines Großgrundbesitzers ist im Gestus einer Proklamation abgefasst, als spräche er zum ganzen Volk. Im Habitus einer fürstlichen Persönlichkeit war es dasselbe, eine Haltung auszudrücken und Gefolgschaft zu erwarten. "Ich wünsche, daß diese meine Auffassung zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, wobei zu bemerken ist, daß ich abweichendes Verhalten nicht dulden kann und werde." Ganz der Papa, wird man sagen, wenn man in der großen Biographie Wilhelms II. von John Röhl gelesen hat, wie der Kaiser und Ex-Kaiser aller Welt, auch Standesgenossen ("Na warte, Wittelsbach") und den eigenen Kindern, allerhöchste Intoleranz androhte.
Dieses Schriftstück, möchte man glauben, braucht dem Verwaltungsgericht Potsdam nur vorgelegt zu werden, um die Frage zu erledigen, ob Wilhelm dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub leistete und seine Erben deshalb von Zahlungen nach dem Ausgleichsleistungsgesetz auszuschließen sind. Leider ist der Brief im Original verschollen. Malinowski zitiert ihn nach zwei Veröffentlichungen von Willibald Gutsche, einem 1992 verstorbenen Professor am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, dessen Forschungen auch im Westen Anerkennung fanden. In der von Gutsche genannten Akte der Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz fehlt der Brief; er soll das erste Blatt der Akte gewesen sein. Malinowski vermerkt: "Der Verbleib des Schreibens ließ sich nicht klären."
An dieser Stelle hätte man sich eine quellenkritische Überlegung mit Angaben zum Zustand der Akte vorstellen können. Wollte man in einem Gedankenspiel die Möglichkeit einer Fälschung zulasten der Familie von Preußen in Erwägung ziehen, könnte man es für auffällig halten, dass Wilhelm im zeithistorischen Rückblick die Konvergenz von persönlichem Handeln und nationaler Entwicklung betont, als hätte er seine Sätze fürs Geschichtsbuch diktiert: Er empfinde es "persönlich als eine besondere Genugtuung, daß das Ziel, wofür ich mich seit Jahr und Tag mit ganzem Herzen eingesetzt habe, endlich erreicht ist". Aber solche Selbsthistorisierung mit Unterstellung teleologischer Stringenz ist typisch für die Denkungsart im Adel, ganz besonders bei den sprunghaften Hohenzollern. Und zum Anspruch Wilhelms, sich einen Anteil an der Wende des 30. Januars zuzurechnen, findet man bei Malinowski eine Parallelüberlieferung aus dem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang des Ereignisses. Am Tag der Berufung des Kabinetts Hitler bekundete Wilhelm gegenüber Sigurd von Ilsemann, dem Adjutanten seines Vaters in Doorn, "wie glücklich er sei, daß in Deutschland jetzt eine nationale Regierung gebildet sei, für die er seit einem Jahr gearbeitet habe".
Doch selbst wenn - um in der Manier der apologetischen Haushistoriografie jede noch so fernliegende Denkmöglichkeit durchzuspielen - unser hypothetischer Erfinder des Briefs vom 17. März 1933 diese Stelle aus Ilsemanns 1968 veröffentlichtem Tagebuch paraphrasiert hätte: Die Argumentation Malinowskis, dessen Forschungen aus einem im Auftrag des Landes Brandenburg erstatteten Gutachten hervorgegangen sind, ist auf das Vorzeigen einer schmauchenden Tatwaffe weder angelegt noch angewiesen. Zu dicht belegt sind die Unterstützungshandlungen des Thronanwärters bei der Beseitigung der Republik und der Errichtung der Diktatur, als dass es auf eine einzelne Quelle ankommen könnte.
Umfassend unterrichtet Malinowski über die viel diskutierten Stationen der Verschmelzung von schwarz-weiß-roter, also kaiserlicher, und nationalsozialistischer, unter der Hakenkreuzflagge in denselben Farben marschierender Front, von Wilhelms Projekt einer Kandidatur bei der Reichspräsidentenwahl 1932 über seine Eingaben gegen das Verbot von SA und SS bis zu den Massenaufmärschen mit dekorativer Prinzenpräsenz im ersten Jahr des neuen Staates. Geduldig zerlegt Malinowski die entlastenden Konstruktionen, mit denen sich ein bedeutender Historiker wie Wolfram Pyta, Biograph Hindenburgs und Hitlers mit besonderem Interesse an einem operablen Begriff des Charismas, den Blick auf einfache Sachverhalte verbaut hat. Aber das eigentlich Neue und Weiterführende in Malinowskis Buch sind seine Überlegungen darüber, wie man sich die Wirkung der Unterstützungshandlungen vorzustellen und zu erklären hat.
Bündig schreibt er im Schlusskapitel: Die Unterstützung war "nicht 'nur' symbolisch, sondern sie leistete eben darin, dass sie vor allem symbolisch war, präzise das, was der Beitrag des Hochadels nach 1918 noch sein konnte: die Darstellung von Machtkonstellationen". Reichsaußenminister Gustav Stresemann hatte die Kaisersöhne wegen ihrer eifrigen Mitwirkung an Kundgebungen des "Stahlhelms", des republikfeindlichen "Bundes der Frontsoldaten", als "Reklameprinzen" verspottet. Kurioserweise sind es heute die letzten Fans der Hohenzollern in der deutschen Historikerzunft, die als wissenschaftliche Advokaten von Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem aktuellen "Chef" des "Hauses", die Devise ausgeben, dass es mit der Reklamewirkung der Preußenprinzen nicht mehr so weit her gewesen sei.
Malinowski kann demgegenüber nicht nur auf die gewaltigen Menschenmengen verweisen, die 1921 der Kaiserin Auguste Victoria und 1940 dem in Frankreich gefallenen Prinzen Wilhelm, dem ältesten Sohn des Kronprinzen, die letzte Ehre erwiesen; diese Demonstrationen volkstümlicher Loyalität wurden politisch verstanden. Denn auf Sichtbarkeit kam es an in den feudalen Treuebeziehungen, die da unter den Bedingungen der Massenkommunikation noch einmal reproduziert wurden. Durch bloße Akte der Präsenz beschäftigten die Prinzen die politische Fantasie, wie Malinowski an der Weltpresse zeigt, besonders gerne mit Provinzzeitungen aus den Vereinigten Staaten. Den Söhnen des Weltkriegstreibers im Exil wurden die abenteuerlichsten Restaurationspläne zugeschrieben. Nach 1933 galten sie mancherorts als geborene Widerständler, sodass sich nach dem Attentat Georg Elsers das Gerücht verbreitete, der Kronprinz sei verhaftet und enthauptet worden. Wer das Image der Hohenzollern untersucht, spaziert durch einen Spiegelsaal der Projektionen. Aber dass ein Mann wie Wilhelm, berühmt dafür, berühmt zu sein, etwas bewirkte, wenn er vor der Potsdamer Garnisonkirche oder auf der Diplomatentribüne des Reichstags erschien, ist keine Einbildung.
Nun bleibt Charisma per definitionem etwas Ungreifbares. Es ist der Clou von Malinowskis Argumentation, dass er die von den Apologeten der Hohenzollern beschworene Krise des dynastischen Charismas zu einem Beweisstück der Anklage umfunktioniert: Sie lieferte ein starkes Motiv für Anpassung und Kollaboration.
Ratlos und verbittert standen die Entthronten in der neuen, republikanischen Welt herum, wo sie sich nicht nur mit ihren alten Feinden konfrontiert sahen, den Demokraten und Sozialisten, sondern auch mit unbehaglich modernen Varianten der Werte der eigenen Lebensform. In ihren antidemokratischen und antisozialistischen Kreisen kamen Ideen einer meritokratischen Aristokratie in Mode, wie sie Alexandra Gerstners Monographie "Neuer Adel" dargestellt hat. Und noch gefährlicher für ihre Stellung war das Konzept, Alleinherrschaft nicht mehr auf Erbfolge, sondern auf Führertum zu gründen.
Malinowski betont sehr stark, dass Kaiser und Kronprinz durch die Flucht im November 1918 ihrem Ansehen in den Augen der Adligen und Adelssympathisanten geschadet hatten, für die ritterliche Tugenden noch kein leerer Wahn waren. In dieser Lage konnten die Hohenzollern versuchen, sich selbst zu Vertretern des zeitgemäßen Leistungsethos zu stilisieren oder ein Bündnis mit den neuen Führungskräften einzugehen. Beides probierten sie aus. In der Bundesrepublik zogen Vertreter der Familie später bis vor das Bundesverfassungsgericht, um sich das Recht bestätigen zu lassen, ihren "Chef" gemäß dem "Hausgesetz" auszuwählen, das hieß auf die Befolgung der Regeln für "ebenbürtige" Heiraten zu verpflichten. Die Söhne Wilhelms II. hatten dieses Prinzip der Magie des Blutes im Zweiten Weltkrieg zur Disposition gestellt: Künftige Prinzen sollten Frauen freien dürfen, mit denen sie "tüchtige, im Leben ihren Mann stehende, zu Führern sich eignende Nachkommen" zeugen würden. Der Ex-Kronprinz gab zu Protokoll, dass auch die "Tochter eines westfälischen Bauern" in Betracht komme, sofern sie "arisch" sei.
Anfang 1933 hatte er seiner Schwester Viktoria Luise berichtet, er habe 1923 mit Oswald Spengler über den kommenden Mann gesprochen, der weder Fürst noch General sein werde. In Gestalt Hitlers sei er nun erschienen. Nach dem Krieg redete Wilhelm sogleich wieder mit ausländischen Journalisten, um zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, dass er in Hitler von Anfang an den Schwätzer erkannt habe.
Der von Spengler zur Nachahmung empfohlene italienische Faschismus bot das Modell eines Bundes von Thron und Führerbalkon, das hinter den Planspielen von 1932/33 unschwer zu erkennen ist. Dass im Adel der Weimarer Republik "sozialer Niedergang und politische Radikalisierung" Hand in Hand gingen, wies Malinowskis preisgekrönte Doktorarbeit nach. So gesehen sind die Hohenzollern eine ganz normale Adelsfamilie. Egalisierung der Schicksale ist die demokratische Pointe der Sozialgeschichte. Die Kaisersöhne, die Stammtafeln gegen Ariernachweise tauschen, um den welthistorischen Anschluss nicht zu verpassen, benehmen sich wie Parvenus. Malinowskis Verfallsstudie belehrt und amüsiert als Gesellschaftsroman einer durch und durch verkehrten Welt. PATRICK BAHNERS
Stephan Malinowski: "Die Hohenzollern und die Nazis". Geschichte einer Kollaboration.
Propyläen Verlag, Berlin 2021. 752 S., Abb., geb., 35,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Stephan Malinowskis brillantem Buch gelingt ein Gleichgewicht zwischen der forensischen Analyse individuellen Verhaltens und einem neuen Verständnis dafür, wie die giftige politische Kultur einer besiegten Monarchie dazu beitrug, die Demokratie in Deutschland zu zerstören.« Christopher Clark Die Zeit 20211007
Rezensent Hans von Trotha empfiehlt das Buch des Historikers Stephan Malinowski über die Rolle der Hohenzollern beim Aufstieg der Nationalsozialisten. Umfassend, grundlegend zeigt ihm der Autor wie die Familie ihren Einfluss nicht für den Widerstand gegen Hitler einsetzte, sondern für sein Fortkommen. Malinowski zeigt die "tiefe (rechte) Überzeugung" des ehemaligen Kronprinzen und anderer Akteure. Trotha taucht ein in die rechten Milieus der Weimarer Republik und erkennt, wie sich im Buch der juristische (um die Restitutionsfrage) und der historische Diskurs begegnen. Anschaulich, eindringlich und spannend zu lesen, verspricht er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Der Unterkiefer reagiert beim Lesen wie der Klappentext: er klappt nach unten...
Der am Ende des Ersten Weltkrieges nach der vollständigen Kapitulation des Deutschen (Kaiser-) Reiches ins Exil nach Holland geflüchtete Kaiser von Deutschland und König von Preußen Wilhelm II …
Mehr
Der Unterkiefer reagiert beim Lesen wie der Klappentext: er klappt nach unten...
Der am Ende des Ersten Weltkrieges nach der vollständigen Kapitulation des Deutschen (Kaiser-) Reiches ins Exil nach Holland geflüchtete Kaiser von Deutschland und König von Preußen Wilhelm II lebte bis zu seinem Tod 1941 nicht nur in Doorn (NL), sondern auch in einer gewissen Wahnwelt. In der er ausser einer seiner Hauptbeschäftigungen des Holzhackens noch immer davon überzeugt war (oder zumindest davon träumte), nach seiner Rückkehr nach Deutschland wieder Kaiser werden zu können.
Am Ausbruch von WK I hatten alle anderen Schuld - er nicht im Geringsten. Die Weimarer Republik, an deren Untergang, besser an deren Vernichtung er nach Kräften mitwirkte, musste in seinen Augen beseitigt werden. Wobei er, Wilhelm II samt seinen Familienmitgliedern, sich den Nationalsozialisten und Adolf Hitler durchaus andiente. Mitgliedschaft im 'Stahlhelm'? Kein Problem, Hauptsache die Weimarer Republik wird beseitigt. Mitgliedschaft in der SA, Fotos des Ex-Kronprinzen auf Nazi-Großveranstaltungen, in Nazi-Uniform mit Hakenkreuzbinde am linken Oberarm, der Ex-Kronprinz im Gespräch mit Goehring, der Ex-Kronprinz neben Goebbels, der Ex-Kronprinz neben Ernst Röhm marschierend und so weiter.
Noch weiter klappt der Unterkiefer runter, wenn man die weiteren Verhaltensweisen und vor allem auch die Reaktionen in der jungen Bundesrepublik liest. Zum Beispiel Teiler der 1986er Politprominenz auf Schloss Hechingen bei der Trauerfeier zum 100sten Geburtstag Wilhelm II...
Wem dann nach einem noch weiter herunter klappenden Unterkiefer zumute ist, der suche im Netz einfach mal in Kombination nach den Stichworten 'Böhmermann Hohenzollern'.
In seinem sehenswerten 28 Minuten dauernden Beitrag setzt sich der Satiriker Jan Böhmermann mit den Entschädigungsforderungen des Hauses Hohenzollern für die in der SBZ, späteren DDR enteigneten Besitztümer des edlen Hauses auseinander. Einschliesslich des kaiserlichen Befehls zum ersten Genozid Deutschlands. An den Herero.
Fazit:
Erstens laufen jetzt alle Verfasser positiver Rezensionen an diesem Buch Gefahr, vom 'Chef des Hauses' beziehungsweise den beauftragten Anwälten juristisch belangt zu werden.
Zweitens ist es nicht nachvollziehbar, mit welcher bodenlosen Frechheit an den indirekten Nachfolger der Weimarer Republik, also an die Bundesrepublik Deutschland Entschädigungsforderungen in sagenhafter Höhe gestellt werden. Gestellt werden können und sich Gerichte mit diesen Forderungen auseinandersetzen müssen. Wobei zu beachten ist, dass das Haus Hohenzollern aktiv an der Beseitigung der Weimarer Republik mitgewirkt hat, die Nazis protegiert hat, somit auch am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wahrlich nicht unschuldig ist - jetzt aber Forderungen zur Entschädigung stellt... Verstehe das, wer wolle!
Drittens: das Hohenzollernschloß in Sigmaringen, die Burg Hohenzollern bei Hechingen sieht man plötzlich doch mit ganz anderen Augen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Als jemand, der am Fuß von Burg Hohenzollern in Hechingen aufgewachsen ist, hat mich „Die Hohenzollern und die Nazis“ von Stephan Malinowski natürlich sehr interessiert. Und, obwohl es ein Sachbuch ist, hat mich das Buch von der ersten Seite in seinen Bann gezogen. Viel wusste …
Mehr
Als jemand, der am Fuß von Burg Hohenzollern in Hechingen aufgewachsen ist, hat mich „Die Hohenzollern und die Nazis“ von Stephan Malinowski natürlich sehr interessiert. Und, obwohl es ein Sachbuch ist, hat mich das Buch von der ersten Seite in seinen Bann gezogen. Viel wusste ich über den örtlichen Adel abgesehen von den Besuchen ihrer Burgen in Hechingen und Sigmaringen nicht. Und da ich nicht dabei war und kein Historiker bin, muss ich mich drauf verlassen, dass es stimmt, was Stephan Malinowski schreibt, schließlich hat er jahrelang recherchiert. Daher kann und möchte ich auf den Wahrheitsgehalt seines Buchs nicht eingehen. Fakt ist aber, dass er seine Thesen mit zahlreichen Quellen untermauert. Herausgekommen ist ein lesenswertes Buch über Adel, antidemokratische, antisemitische, reaktionäre und national(sozial)istische Gesinnungen, Geltungssucht und rücksichtsloses Machtstreben.
Aber von vorn.
Der Streit des Hauses Hohenzollern um Entschädigungen für die Besitztümer, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland, also der Sowjetisch Besetzten Zone, enteignet worden sind, zieht sich nun schon seit 2014 und die Debatte zieht weite Kreise, auch in den Medien. Einer der Gutachter in der Sache ist der Historiker Stephan Malinowski, der im Auftrag des Landes Brandenburg beleuchten sollte, ob und inwiefern Wilhelm Kronprinz von Preußen seinerzeit dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat (Titel: „Gutachten zum politischen Verhalten des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm Prinz von Preußen (1882-1951)“). Das Gutachten wurde vom Haus Hohenzollern angefochten, das Malinowski (und in anderen Zusammenhängen einige seiner Kollegen) anzeigte. Seine Ergebnisse konnten dem Adelsgeschlecht natürlich nicht gefallen, denn der Historiker kam zum eindeutigen Schluss, dass die Hohenzollern nicht nur nichts gegen den Vormarsch der Nationalsozialisten tat, sondern sogar vielmehr ein „Werbeträger“ für die Nazis war. Schließlich hatte man eines ganz sicher gemeinsam: die Ablehnung der Republik, wobei das Haus Hohenzollern natürlich auf eine Wiederkehr der Monarchie hoffte.
Auch wenn das Haus Hohenzollern mit autorisierten Texten in der Zeit nach 1945 immer wieder versucht hat, die Weste weiß zu waschen und das öffentliche Image aufzupolieren, so zeichnet Stephan Malinowski ein anderes Bild der drei Generationen von 1918 bis heute. Pointiert, brillant und manchmal fast süffisant schreibt er in seinen sechs Kapiteln erst über sehr viel Privatleben, dann aber über „Paktieren“, ja sogar von „Anbiederung bei den Nazis“. Später wurde die Rolle relativiert und als „unbedeutend“ („Der Einfluss des insgesamt unbedeutenden Kronprinzen habe nur einen kurzen Zeitraum umfasst“) dargestellt, in den 1950er Jahren entstand sogar das Narrativ, die Hohenzollern seien ein Teil des Widerstandes gewesen. In seinem Buch stützt sich Malinowski aber überwiegend auf historische Quellen, die die Außenwirkung der Hohenzollern zeigen. Er zitiert Zeitungsartikel und Veröffentlichungen aus dem In- und Ausland, die ihre Nähe zu den Nazis nach 1933 aufzeigen. Bei der Lektüre stellt man fest, dass die Beziehung eine symbiotische war, denn beide Seiten hatten mehr gemeinsam, als die Hohenzollern heute sehen wollen und beide wollten von ihrer Kollaboration auf ihre Weise profitieren.
Wohlformuliert und für ein Sachbuch sehr verständlich geschrieben, zerlegt der Autor die Geschichte der Hohenzollern in ihre (nachweis- und nachvollziehbaren) Einzelteile und zerlegt damit größtenteils ihr Narrativ. Das Hühnchen, das er selbst wegen der Strafanzeige mit den Adligen zu rupfen hat, und das seine Ausführungen vorurteilsbelastet machen könnten, erwähnt er erst gegen Schluss, wo er auf seinen eigenen juristischen Streit mit der Familie eingeht. Sonst bleibt er ausschließlich auf dem Boden der Fakten. Für mich war das Buch eine lohnende und aufschlussreiche Lektüre, die ich für Geschichtsinteressierte gerne weiterempfehle. Von mir fünf Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Zum Hintergrund: Seit 2014 laufen Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Familie Hohenzollern, die sich auf das sog. Ausgleichsleistungsgesetz beruft und Ansprüche auf Schlösser, Liegenschaften, Tausende von Kunstschätzen und andere Vermögenswerte erhebt, die nach dem …
Mehr
Zum Hintergrund: Seit 2014 laufen Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Familie Hohenzollern, die sich auf das sog. Ausgleichsleistungsgesetz beruft und Ansprüche auf Schlösser, Liegenschaften, Tausende von Kunstschätzen und andere Vermögenswerte erhebt, die nach dem II. Weltkrieg von der Sowjetischen Militäradministration enteignet wurden. Malinowski wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt zur Frage, ob der Ex-Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet habe. Wenn ja, wären Leistungen nach diesem Gesetz ausgeschlossen. Diese sog. Hohenzollerndebatte entwickelte sich in den Folgejahren zum „bedeutendsten geschichtspolitischen Konflikt des Landes“ (SPIEGEL). Malinowski und Journalisten wurden von den Hohenzollern mehrfach verklagt.
Das vorliegende Buch basiert auf den Ergebnissen des Gutachtens.
Gleich zu Beginn stellt der Autor klar, dass er sein Buch nicht auf die Frage der Vorschubleistung reduziert sehen will. Er betrachtet sein Buch eher als Fallstudie, in der er die Handlungen einer hochadligen Familie mit der historischen Methode untersucht. Der Autor legt seine Darstellung daher breit an und beginnt mit dem Exil des Kaisers Wilhelm II. und des Kronprinzen Wilhelm in den Niederlanden und beobachtet ebenfalls das Agieren der Familie und der Vertrauten. Ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand ist dabei die Kommunikation zwischen den Hohenzollern und der Öffentlichkeit. Der Autor betont die Bedeutung der Selbstdarstellung bzw. Performance für das Bild, das die Hohenzollern der Öffentlichkeit bieten wollten. Die war nicht immer leicht zu meistern; so ließ sich z. B. die Fahnenflucht des Kaisers und des Thronfolgers in den folgenden Jahren nur schwer vermitteln. Ein breit aufgestellter Stab an PR-Beratern, Ghostwritern, Journalisten, Juristen etc. sorgte für das gewünschte Außenbild der Figur.
Malinowski legt akribisch dar, wie die Hohenzollern die Hoffnung auf eine Restitution der Monarchie nicht aufgaben und wie sie sich zum Steigbügelhalter der Nationalsozialisten machten. Dazu nutzen sie ihren charismatischen Namen, der Sehnsüchte und Volk hervorruft, die den Kyffhäuser-Mythos assoziieren lassen, wobei die Namensträger allerdings von Charakter und Leistung her diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Zusätzlich nutzen sie die informellen Kommunikationsmöglichkeiten des Adels bzw. Hochadels, wie sich bei Jagdgesellschaften, Bällen, in den Clubs, den Offizierkasinos etc. ergaben. Die Verbindung des nationalen mit dem konservativen Lager glückt, und der Tag von Potsdam, an dessen Inszenierung auch die Hohenzollern beteiligt sind, zeigt eindrucksvoll den Schulterschluss von Alt und Neu. Die nächsten Jahre sind gekennzeichnet von Anbiederungsversuchen, Anpassungen und Arrangements. Nach wie vor stellen die Hohenzollern dem Regime ihre jahrhundertealte Geschichte, ihr Charisma und den Glanz ihres Namens zur Verfügung. Trotzdem reicht der Einfluss nicht so weit, um im arrivierten NS-System eine bedeutende Rolle zu spielen.
Liest man die Quellen, die Malinowski anführt, fällt es schwer, an die imaginierte Opferrolle der Hohenzollern zu glauben. Da werden die Verhaftungen von Kommunisten, Sozialisten, Juden und anderen „Volksfeinden“ als „Aufräumarbeiten“ abgetan, Mussolini wird wegen seiner „genialen Brutalität“ bewundert, schon in den 20er Jahren sind Hitler, Röhm und Göring Gast im Cecilienhof, Wahlaufrufe für Hitler, Sätze wie „Jetzt heißt es, jedem in die Fresse zu hauen“, der die Regierung Hitler angreife, Geldzuwendungen, Assistenz im SA-Folterkeller, eine Fülle an Bildmaterial etc. – Malinowski stützt seine Darlegungen auf eine breite Quellenlage, die er genau auswertet und zugleich die apologetischen Ausführungen anderer Historiker widerlegt. Sein Urteil: Es dürfte "auch im Adel aller Sparten nur wenige Familien gegeben haben, die so geschlossen, so stetig, so radikal und so wirkungsvoll gegen die Republik und ihre Prinzipien aufgetreten sind wie die polit
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Nie und nimmer
Wenn die Rückgabe des Grundbesitzes der Hohenzollern diskutiert wird, kommt die Frage auf, ob die ehemalige Kaiserfamilie der Nazi- Herrschaft Vorschub geleistet habe. Und wer dieses Buch gelesen hat, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Bundesrepublik nie und nimmer den …
Mehr
Nie und nimmer
Wenn die Rückgabe des Grundbesitzes der Hohenzollern diskutiert wird, kommt die Frage auf, ob die ehemalige Kaiserfamilie der Nazi- Herrschaft Vorschub geleistet habe. Und wer dieses Buch gelesen hat, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Bundesrepublik nie und nimmer den Hohenzollern ihren Besitz zurückgeben darf.
Das Verhalten von Kaiser und Kronprinz im Ersten Weltkrieg nicht an der Front zu fallen, sondern in den Niederlanden Asyl zu suchen kann ich nachvollziehen. Nachvollziehen kann ich auch, dass der Ex-Kronprinz nach seiner Rückkehr von er Wiederherstellung der Monarchie träumte. Doch der Autor legt plausibel dar, dass trotz Monarchiewillen in weiten Teilen der Bevölkerung weder der wankelmütige, frauenumwerbende Kronprinz noch sein Vater noch ein anderes Familienmitglied als Monarch in Frage kam.
Weit schlimmer ist aber, dass der Ex-Kronprinz als Mitglied der Stahlhelm-Bewegung sich um die Einheit der konservativen Bewegung bemühte und schon vor der Machtübernahme der Nazis sich mit Hakenkreuzen zeigte. Nie hatte die Hohenzollern-Familie eine Beziehung zur Weimarer Republik gefunden.
Als die Nazis während ihrer Regierung schnell dafür sorgten, dass ohne öffentliche Berichterstattung das Interesse am Ex-Königshaus sank, setzte auch kein Widerstand ein. Ebenso wenig schadete der Gewaltherrschaft, dass ein Enkel des letzten Kaisers an der Front fiel und auch die Beteiligung der Hohenzollern am Attentat des 20. Julis gehört in das Reich der Fabel.
Nach dem Krieg inszenierte sich die Familie weiter als zum Widerstand gehörig oder wie Historiker Clark als unbedeutend. Doch auch unzählige Gerichtsverfahren können den Autor Malinkowski nicht widerlegen.
Dieses Buch erhielt den Deutschen Sachbuchpreis 2022 und das völlig zu Recht. Da mich dieses Thema nur am Rande interessiert, fand ich es manchmal etwas zu ausführlich, aber das kann ich keinem Sachbuch vorwerfen, nein von Herzen 5 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Die große „Familie“ der Hohenzollern war und ist stets bemüht, sich im rechten Licht darzustellen. Sie engagieren Journalisten, Reporter und PR-Berater. Jedoch müssen sie sich gefallen lassen, dass auch ihre polierte Seite einige Macken hat. Wie war denn der Kaiser …
Mehr
Die große „Familie“ der Hohenzollern war und ist stets bemüht, sich im rechten Licht darzustellen. Sie engagieren Journalisten, Reporter und PR-Berater. Jedoch müssen sie sich gefallen lassen, dass auch ihre polierte Seite einige Macken hat. Wie war denn der Kaiser tatsächlich? Also, wie stand er zu den Nationalsozialisten und wie verbrachte er seine Zeit im „Exil“? Welche Fotografien von ihm und seinen Söhnen wurden nur für´s Volk gemacht und veröffentlicht. Eine spannende Reise in die Vergangenheit und Antworten auf viele Fragen bietet das Buch „Die Hohenzollern und die Nazis“. Der Autor Stephan Malinowski schaffte es damit auf den ersten Platz beim #DSP22. Herzlichen Glückwunsch.
Dass Kaiser Wilhelm abdanken musste und in die Niederlande floh, lernten wir in der Schule. Wie er dort seine Zeit verbrachte und was derweil die Söhne umtrieb, das kommt erst nach und nach ans Licht. Bis heute gibt es immer wieder Schriften, die auch für dieses Buch als Grundlage dienten. Es gilt als erwiesen, dass die Hohenzollern aktiv tätig waren, die Nationalsozialisten bei ihrem Streben nach Macht zu unterstützen. Der Autor nennt es gar eine „symbolisch – politische Allianz“. In dem Sachbuch werden Republikfeinde beim Namen genannt und der Aufstieg Hitlers konkretisiert.
Noch ein Zitat, welches die Verbundenheit des Kaiserhauses zu Hitler zeigt:
„Lieber Herr Hitler! ….führen Sie diese herrliche nationale Bewegung hinein in die fruchtbringende Arbeit.“ Das schrieb der Kronprinz Wilhelm an sein Vorbild.
Viele Quellen berichten davon und sie wurden von Herrn Malinowski gefunden und zur Unterstreichung der Wahrheit herangezogen. Zudem konnte er auch etliche Fotos nutzen und damit das Buch noch abwechslungsreicher gestalten.
Es gibt ja Sachbücher, die lassen sich nur mühsam lesen. Ihre Schöpfer zeigen dabei häufig, dass sie Latein lernten oder wissenschaftliche Zusammenhänge in der Quantenchemie kennen. Also, nichts für Menschen, die kein Studium abschlossen oder sich auf ein Thema fixierten.
„Die Hohenzollern und die Nazis“ hebt sich wohltuend davon ab. Die Sprache ist gehoben aber niemals abgehoben. Neben trockenen Passagen gibt es immer wieder humorvolle Abschnitte, die das Lesen zu einem Vergnügen machten. Meine Empfehlung für dieses Werk gilt ohne Abstriche. Für alle, die sich für die Historie Deutschlands ab 1918 interessieren eigentlich ein Muss.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für