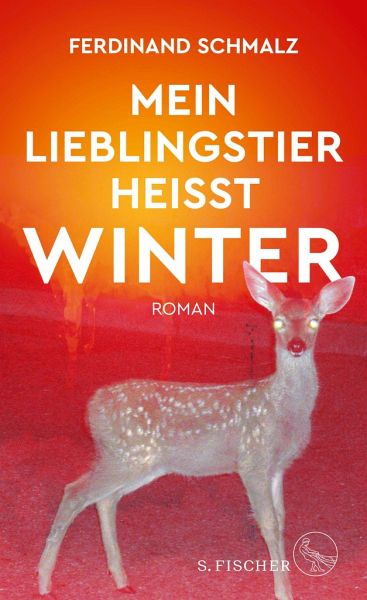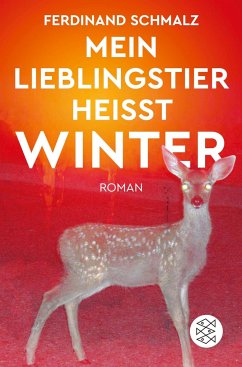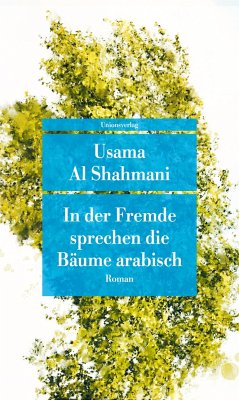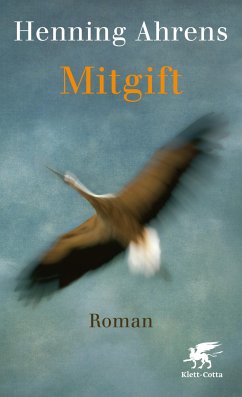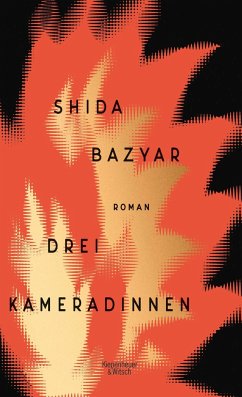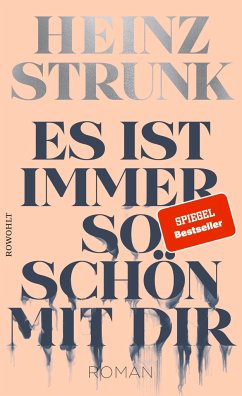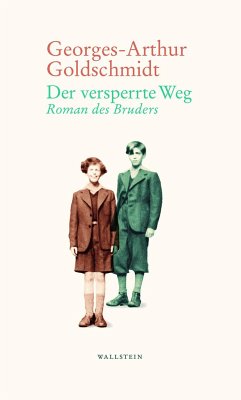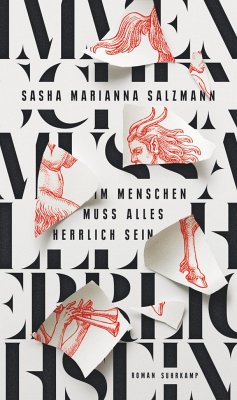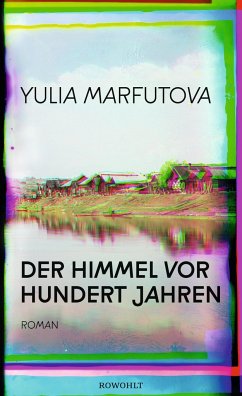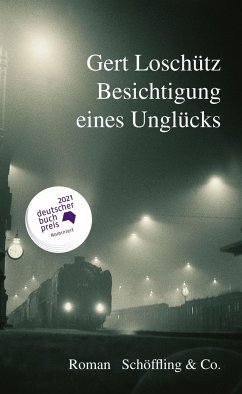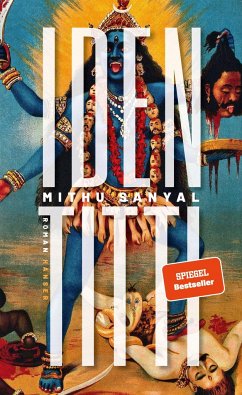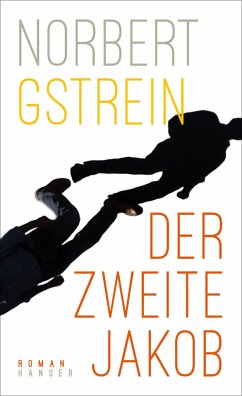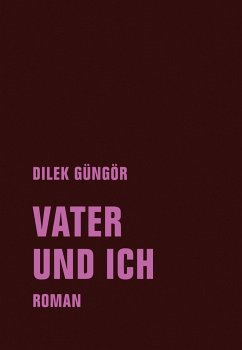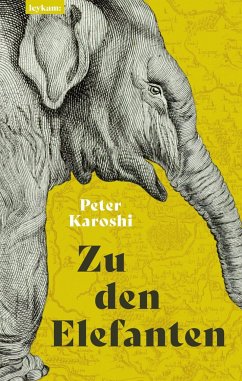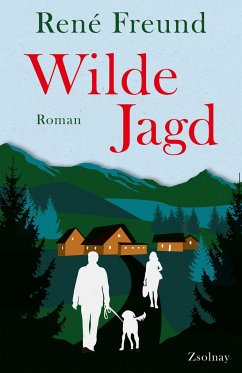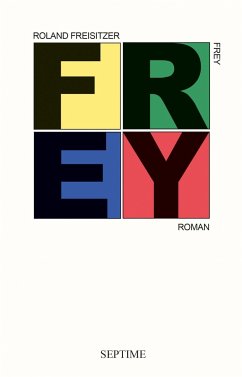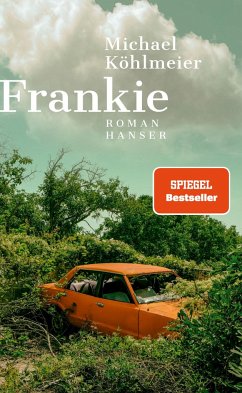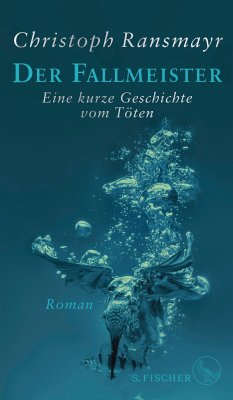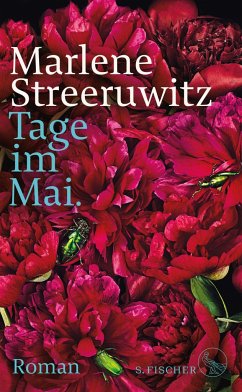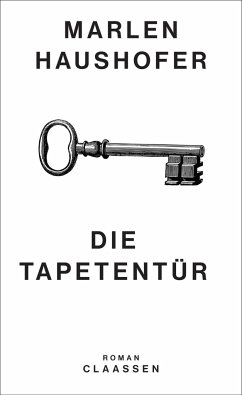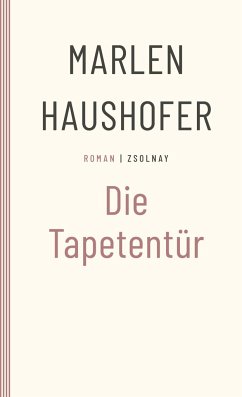Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Der Debütroman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 und den Österreichischen Buchpreis 2021Der Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tat...
Der Debütroman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 und den Österreichischen Buchpreis 2021
Der Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt. Ferdinand Schmalz nimmt uns in »Mein Lieblingstier heißt Winter« mit auf eine abgründige Tour quer durch die österreichische Gesellschaft, skurril, intelligent und mit großem Sprachwitz.
Der Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt. Ferdinand Schmalz nimmt uns in »Mein Lieblingstier heißt Winter« mit auf eine abgründige Tour quer durch die österreichische Gesellschaft, skurril, intelligent und mit großem Sprachwitz.
Ferdinand Schmalz, geboren 1985 in Graz, aufgewachsen in Admont in der Obersteiermark, erhielt gleich mit seinem ersten Theaterstück »am beispiel der butter« 2013 den Retzhofer Dramapreis und wurde zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gewählt. Sein Stück »jedermann (stirbt)« wurde am Burgtheater uraufgeführt und mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet. 2017 nahm er an den Tagen der deutschsprachigen Literatur teil und gewann mit einem Auszug aus »Mein Lieblingstier heißt Winter« den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2021 erschien sein gleichnamiger Debütroman, der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises sowie auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises 2021 stand. Ferdinand Schmalz lebt in Wien. Auszeichnungen: 2020 Peter-Rosegger-Literaturpreis 2018 Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie Bestes Stück für jedermann (stirbt) 2018 Ludwig-Mülheims-Theaterpreis 2017 Ingeborg-Bachmann-Preisträger mit dem Text MEIN LIEBLINGSTIER HEISST WINTER 2017 Kasseler Förderpreis Komische Literatur 2014/2016/2017 Nominiert für den Mülheimer Dramatikpreis 2015 Eröffnung der Autorentheatertage am Deutschen Theater in Berlin in einer Inszenierung des Wiener Burgtheaters mit DOSENFLEISCH 2014 Dramatik Stipendium der Stadt Wien 2014 Nachwuchsdramatiker in der Kritikerumfrage des Jahrbuchs von "Theater heute" 2013 2. Platz beim MDR-Literaturpreis für die Kurzprosa SCHLAMMLAND.GEWALT 2013 Retzhofer Dramapreis für AM BEISPIEL DER BUTTER
Produktdetails
- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH
- Originaltitel: Mein Lieblingstier heißt Winter
- Artikelnr. des Verlages: 1023324
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 189
- Erscheinungstermin: 21. Juli 2021
- Deutsch
- Abmessung: 204mm x 127mm x 23mm
- Gewicht: 295g
- ISBN-13: 9783103974003
- ISBN-10: 3103974000
- Artikelnr.: 61534198
Herstellerkennzeichnung
S. FISCHER Verlag GmbH
Hedderichstr. 114
60596 Frankfurt am Main
www.fischerverlage.de
+49 (069) 6062-0
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Jan Wiele entdeckt Momente eigenartiger Schönheit in diesem Roman von Ferdinand Schmalz. Davon abgesehen berückt ihn der Text mit einer Sprachsensibilität, die Wiele in der Gegenwartsliteratur sonst schmerzlich vermisst. Dass Schmalz syntaktisch nie den geraden Weg geht und realistisches Erzählen eher zu seinen Pflichten gehört, während die Kür "Fiktion unter der Hand" hervorbringt beziehungsweise experimentelle Prosa, findet Wiele eigentlich ganz wunderbar. Es geht übrigens um einen Wiener Tiefkühllieferanten während der Hundstage in diesem Buch, um seine merkwürdige Kundschaft und sogar um ein krimitaugliches Verschwinden, erklärt Wiele, aber im Grunde geht es einmal um die Form.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2021Da fuhr er ab, der Charakterzug
Schockfrostung in der Hitze der Hundstage: Das Romandebüt des Dramatikers Ferdinand Schmalz
Es ist erfreulich, wenn Gegenwartsliteratur überhaupt noch einen Formwillen offenbart - also zeigt, dass sie mehr will als dürftige Dialoge, bräsigen Biographismus oder, noch schlimmer, die flache Fiktionalisierung von Debattenthemen. Und es mag spätestens seit der durchstilisierten Prosa Thomas Bernhards ein Klischee sein, dass österreichische Gegenwartsliteratur noch am ehesten solchen Formwillen offenbart, aber vielleicht stimmt es einfach.
Ein gutes Beispiel dafür wäre jedenfalls der 1985 in Graz geborene Ferdinand Schmalz, der unter diesem Künstlernamen Theaterstücke schreibt
Schockfrostung in der Hitze der Hundstage: Das Romandebüt des Dramatikers Ferdinand Schmalz
Es ist erfreulich, wenn Gegenwartsliteratur überhaupt noch einen Formwillen offenbart - also zeigt, dass sie mehr will als dürftige Dialoge, bräsigen Biographismus oder, noch schlimmer, die flache Fiktionalisierung von Debattenthemen. Und es mag spätestens seit der durchstilisierten Prosa Thomas Bernhards ein Klischee sein, dass österreichische Gegenwartsliteratur noch am ehesten solchen Formwillen offenbart, aber vielleicht stimmt es einfach.
Ein gutes Beispiel dafür wäre jedenfalls der 1985 in Graz geborene Ferdinand Schmalz, der unter diesem Künstlernamen Theaterstücke schreibt
Mehr anzeigen
und 2018 mit einem Prosatext den Bachmannpreis gewann. Dass aus diesem recht absurden Text über einen Tiefkühllieferanten ein Roman werden könnte, hätte man damals allerdings kaum für möglich gehalten. Ging es nicht gerade um das novellistisch Unabgeschlossene, das keinen Ausschnitt aus einer größeren Fabel oder gar aus einer gesellschaftlichen Wirklichkeit darstellte? Ob das überhaupt "realistisch" erzählt sei, diskutierte jedenfalls damals schon die Jury in Klagenfurt, und zu Recht: Einen Eismann namens Franz Schlicht, der die geheimen Wünsche seiner Kunden kennt, und einen schwerkranken Mann namens Doktor Schauer, der exzessiv Rehragout hortet - ja, wo gibt's denn des?
Nun zeigt sich: Das gibt es innerhalb einer weiter ausgesponnenen, aber nicht weniger absurden Fabel, die man, ohne den Begriff allzu sehr zu strapazieren, durchaus auch Roman nennen kann. Er beginnt in einem Setting, das ebenfalls schon fast klassisch österreichisch anmutet: nämlich zur Zeit der brütend heißen Hundstage im August, die in Ulrich Seidls gleichnamigem Spielfilm von 2001 die Abgründe nicht nur der Wiener Vorstadt gräßlich zum Ausdruck gebracht hat.
Von einer "Hitzequalle", die sich über Wien gelegt habe, ist nun bei Schmalz die Rede. Gelähmt davon werden neben den Tiefkühlexperten auch die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma, die in einem Freizeitpark Dinosaurierfiguren von Schimmelflecken befreien oder, wie es im Roman heißt, "den Mikroorganismen auf den Makroechsen nun zu Leibe rücken wollen". Der Erzählton ist oft von einer künstlichen Umständlichkeit, die am Mündlichen, nicht an der Schriftsprache orientiert ist und also häufig verdrehte oder unvollständige Sätze hervorbringt. So heißt es etwa über die Chefin dieser beiden Reinigungsfachkräfte: "Und Schmerz und Denken hochfrequenzt da jetzt in ihr. Der ganze Körper durchquert von Wellen, die sich an ihren Innenwänden brechen. Und drückt sie nun das runde Ende der Stimmgabel hinein sich (. . .)."
Mit Darstellungstechniken, die an solche der (Wiener) Moderne erinnern, kommt Schmalz dem Denken und Fühlen aller Figuren sehr nah und kehrt es bisweilen expressionistisch nach außen. In banalen Situationen wird plötzlich Existenzielles offenbart, etwa wenn Eismann Schlicht sich darüber klar wird, sein Lebenslauf habe sich in einem Sekundenbruchteil entschieden: "Da fuhr er ab, dieser Charakterzug, mit ihm." Schmalz hat offensichtlich eine fabulierende Lust daran, seine Fiktion unter der Hand zu entwickeln und amüsiert zuzuschauen, wohin sie ihn treibt. Das ist das Gegenteil solcher Romane, die ihr Baukasten-Setting oft schon im Klappentext offenbaren. Hier dagegen handelt es sich um experimentelle Prosa, in der die Figuren ihre eigene Erfundenheit offenbar spüren können: "Er wolle sich in keine Rolle reintheatern und in keine größere Erzählung betten lassen. Erzählungen, ob große, ob kleine, seien ihm suspekt", heißt es ferner über Herrn Schlicht.
Trotz solcher Selbstreflexivität erschöpft sich das Buch aber nicht im bloß Spielerischen. Der Schmerz ist ein Leitthema, das die Figuren und Episoden verbindet. Ohne Weiteres könnte man einige von ihnen als traumatisiert beschreiben, allen voran den Doktor Schauer, der nach seinem geplanten Suizid zu einer makabren Kunstinstallation werden möchte und auf eigenen Wunsch schockgefrostet wird - ebenso aber den Pathologen Tulp, in dessen "Pathologenseele" wie in einem Lichtspielsaal die Bilder aller schon gesehenen Leichen wieder aufscheinen und der sich fühlt wie ein Filmcutter, der sie wieder neu zusammensetzen muss.
Weil Doktor Schauer aber nicht stirbt, sondern mysteriös verschwindet, nimmt die Erzählung sogar streckenweise Züge eines Krimis an, auch wenn es einer mit einigen losen Enden ist. Darin weitere Rollen spielen ein Ministerialrat mit "obszöner Sammelleidenschaft" für Weihnachtskugeln mit Swastikas darauf und ein "Feuerwerker", der mit diesen Kugeln am Ende Golf spielt. Aber immer wenn man gerade denkt, es werde jetzt doch eine Spur zu abgedreht, überrascht Schmalz mit wirklichkeitsgesättigten Passagen wie jener über die Wiener Pathologie, die Eigenschaften von Donauwasserleichen und den Friedhof der Namenlosen. Wie es ihm gelingt, ausgerechnet in dieser Umgebung eine nahezu romantische Begegnung zu schildern, die in einen Kuss mündet, ist von eigenartiger Schönheit. JAN WIELE
Ferdinand Schmalz:
"Mein Lieblingstier heißt Winter". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2021. 192 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Nun zeigt sich: Das gibt es innerhalb einer weiter ausgesponnenen, aber nicht weniger absurden Fabel, die man, ohne den Begriff allzu sehr zu strapazieren, durchaus auch Roman nennen kann. Er beginnt in einem Setting, das ebenfalls schon fast klassisch österreichisch anmutet: nämlich zur Zeit der brütend heißen Hundstage im August, die in Ulrich Seidls gleichnamigem Spielfilm von 2001 die Abgründe nicht nur der Wiener Vorstadt gräßlich zum Ausdruck gebracht hat.
Von einer "Hitzequalle", die sich über Wien gelegt habe, ist nun bei Schmalz die Rede. Gelähmt davon werden neben den Tiefkühlexperten auch die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma, die in einem Freizeitpark Dinosaurierfiguren von Schimmelflecken befreien oder, wie es im Roman heißt, "den Mikroorganismen auf den Makroechsen nun zu Leibe rücken wollen". Der Erzählton ist oft von einer künstlichen Umständlichkeit, die am Mündlichen, nicht an der Schriftsprache orientiert ist und also häufig verdrehte oder unvollständige Sätze hervorbringt. So heißt es etwa über die Chefin dieser beiden Reinigungsfachkräfte: "Und Schmerz und Denken hochfrequenzt da jetzt in ihr. Der ganze Körper durchquert von Wellen, die sich an ihren Innenwänden brechen. Und drückt sie nun das runde Ende der Stimmgabel hinein sich (. . .)."
Mit Darstellungstechniken, die an solche der (Wiener) Moderne erinnern, kommt Schmalz dem Denken und Fühlen aller Figuren sehr nah und kehrt es bisweilen expressionistisch nach außen. In banalen Situationen wird plötzlich Existenzielles offenbart, etwa wenn Eismann Schlicht sich darüber klar wird, sein Lebenslauf habe sich in einem Sekundenbruchteil entschieden: "Da fuhr er ab, dieser Charakterzug, mit ihm." Schmalz hat offensichtlich eine fabulierende Lust daran, seine Fiktion unter der Hand zu entwickeln und amüsiert zuzuschauen, wohin sie ihn treibt. Das ist das Gegenteil solcher Romane, die ihr Baukasten-Setting oft schon im Klappentext offenbaren. Hier dagegen handelt es sich um experimentelle Prosa, in der die Figuren ihre eigene Erfundenheit offenbar spüren können: "Er wolle sich in keine Rolle reintheatern und in keine größere Erzählung betten lassen. Erzählungen, ob große, ob kleine, seien ihm suspekt", heißt es ferner über Herrn Schlicht.
Trotz solcher Selbstreflexivität erschöpft sich das Buch aber nicht im bloß Spielerischen. Der Schmerz ist ein Leitthema, das die Figuren und Episoden verbindet. Ohne Weiteres könnte man einige von ihnen als traumatisiert beschreiben, allen voran den Doktor Schauer, der nach seinem geplanten Suizid zu einer makabren Kunstinstallation werden möchte und auf eigenen Wunsch schockgefrostet wird - ebenso aber den Pathologen Tulp, in dessen "Pathologenseele" wie in einem Lichtspielsaal die Bilder aller schon gesehenen Leichen wieder aufscheinen und der sich fühlt wie ein Filmcutter, der sie wieder neu zusammensetzen muss.
Weil Doktor Schauer aber nicht stirbt, sondern mysteriös verschwindet, nimmt die Erzählung sogar streckenweise Züge eines Krimis an, auch wenn es einer mit einigen losen Enden ist. Darin weitere Rollen spielen ein Ministerialrat mit "obszöner Sammelleidenschaft" für Weihnachtskugeln mit Swastikas darauf und ein "Feuerwerker", der mit diesen Kugeln am Ende Golf spielt. Aber immer wenn man gerade denkt, es werde jetzt doch eine Spur zu abgedreht, überrascht Schmalz mit wirklichkeitsgesättigten Passagen wie jener über die Wiener Pathologie, die Eigenschaften von Donauwasserleichen und den Friedhof der Namenlosen. Wie es ihm gelingt, ausgerechnet in dieser Umgebung eine nahezu romantische Begegnung zu schildern, die in einen Kuss mündet, ist von eigenartiger Schönheit. JAN WIELE
Ferdinand Schmalz:
"Mein Lieblingstier heißt Winter". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2021. 192 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Mit Darstellungstechniken, die an solche der (Wiener) Moderne erinnern, kommt Schmalz dem Denken und Fühlen aller Figuren sehr nah Jan Wiele Frankfurter Allgemeine Zeitung 20211028
Morbide Philosophie-Groteske
Es ist sein erster, dieser Roman, «Mein Lieblingstier heißt Winter». Schreibt sonst Theaterstücke, der Ferdinand Schmalz da, Dramatiker aus Österreich. Hat den Bachmannpreis gewonnen 2017, mit dem Kern seiner Geschichte, in Kleinschrift …
Mehr
Morbide Philosophie-Groteske
Es ist sein erster, dieser Roman, «Mein Lieblingstier heißt Winter». Schreibt sonst Theaterstücke, der Ferdinand Schmalz da, Dramatiker aus Österreich. Hat den Bachmannpreis gewonnen 2017, mit dem Kern seiner Geschichte, in Kleinschrift natürlich. Das bleibt ihm erspart, dem Leser heute, immerhin! Ist ein ziemlich schräger Roman draus geworden inzwischen, nominiert für den Frankfurter Buchpreis. Ob preisverdächtig, kann man schwer nur voraussagen, massentauglich wohl kaum, der Sprache wegen. Obwohl, nicht schwer zu lesen, gewöhnt man dran ziemlich schnell sich. Kann man ja gleich ausprobieren hier!
Ein Triceratops wird am Anfang da, im verlassenen Saurierpark, sauber geschrubbt. Soll wieder eröffnet werden, der Park. Die Firma Schimmelteufel hat den Auftrag, reinigt alles, Saurier und Tatorte. Der Schlicht wiederum, Verkaufsfahrer für Tiefkühlkost, bekommt ein makabres Angebot. Von dem Schauer, krebskranker Stammkunde, immer Rehragout 14tägig. Will sich in die Tiefkühltruhe legen, Suizid begehen drinnen. Er, Schlicht, soll die Leiche in den Wald verbringen dann, die Nachkommen zu schonen, absolut diskret, wird auch gut bezahlt dafür. Ist aber leer, die Truhe dann, nicht wie vereinbart, muss also die Leiche er suchen, der Schlicht. Und trifft dabei auf allerlei komische Leute. Auf den Ingenieur zuerst. Der hat sich, verbarrikadiert hat der sich regelrecht, Selbstschuss-Anlage, die Fenster zugemauert. Trifft auch auf die Tatortreinigerin Schimmelteufel. Und auf den Ministerialrat, hohes Tier, einflussreich, nur dass er Weihnachts-Schmuck sammelt, von den Nazis allerdings. Sehr merkwürdig das, ist doch erpressbar geworden dadurch. Und sie schließt sich an, dem Schlicht, bei der Suche, Schauers Tochter, die Astrid, muss doch Gewissheit haben.
Allesamt eine eng ineinander verstrickte Gesellschaft das, sumpfig, in Schmutz und Blut sich suhlend. Ein kleines Ensemble morbider Figuren, Sinnbild für ein vor sich hingammelndes Österreich, die Todessehnsucht zuhause dort. Also Nestbeschmutzung, literarisch ja typisch dorten, häufig zumindest. Es ist das alles, diese Geschichte vom Tod, ziemlicher Nonsens, aber lustig. Alle stecken unter einer Decke, wie er bald merkt, der mit dem treffenden Namen, der Schlicht, der Eismann also. Und halten zusammen da in ihrem Selbstmordclub, selbstbestimmtes Sterben als Zweck. Macht dann aber doch nicht jeder mit, hält sich einfach nicht dran, kommen nämlich schon mal Frauen dazwischen. Wie die Astrid, als Sadomaso-Gespielin von dem Ministerialrat, mit dem Codewort «Rehragout» für den Not-Ausstieg. Hat sich’s halt anders überlegt deshalb, der Suizit-Kandidat, macht ja doch richtig Spaß, so was. Trifft die Putzteufel auch, der Schlicht, dieses skrupellose Weib, Erpressung war bei der im Spiel sogar. Und der Tiefkühl-Fahrer dann landet im Sarg, zuletzt, lebendig begraben. Nicht ein Nervenkitzel nur, sondern eine verhängnisvolle Verwechslung, beinahe tot schon. Und der Anatom kommt auch noch ins Spiel jetzt, da im Seziersaal drinnen, mit dem scheintoten Schlicht obendrauf auf dem metallenen Arbeitstisch.
Trotz aller Theatralik darin, bei dem Autor kaum verwunderlich, ist dieser aberwitzige Plot vom Leben und Sterben, ist er tatsächlich doch ziemlich dialogarm geraten. Stilistisch wird eine eigentümliche Kunstsprache benutzt dabei, die zunächst abschreckend wirkt auf nichtsahnende Leser dann. Hat man ja so nicht so oft. Erzählt wird äußerst metaphernreich, allerdings auch recht eintönig mit der Zeit, ermüdend, ohne sprachliche Variationen darin. Eine dem Dialekt nahe Kunstsprache ist das, eine verquere Syntax nutzend, invertierte Satzstellungen vor allem. Häufige Wort-Wiederholungen und dem Subjekt vorangestellte Pronomen benutzt der Schmalz hier. Einem dem Mündlichen nahe kommenden Rhythmus folgend, verwendet er seine ureigene Diktion. Und die wirkt doch arg holzschnitt-artig, mit einer morbiden Komik obendrein, als Philosophie-Groteske unterhaltsam, mehr aber nicht
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz gewann 2017 mit einem Prosatext den Ingeborg Bachmann-Preis, der jetzt auch den Titel für den Roman liefert.
Vom Theater kommend hat auch dieses episodenhaft aufgebautes Buch bemerkenswerte Settings und einen Detailreichtum.
Altmodisch …
Mehr
Der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz gewann 2017 mit einem Prosatext den Ingeborg Bachmann-Preis, der jetzt auch den Titel für den Roman liefert.
Vom Theater kommend hat auch dieses episodenhaft aufgebautes Buch bemerkenswerte Settings und einen Detailreichtum.
Altmodisch wirken die Namen der Figuren an, Franz, Harald, Heinz, Norbert etc.
Sprechende Nachnamen wie Schlicht, Schauer oder Schimmelteufel machen dann endgültig Typen aus ihnen.
Es gibt eine Rahmenhandlung, die die Szenen miteinander verbindet.
Ansonsten dominiert aber die Sprache, die natürlich auch für eben diese starken Sprachbilder verantwortlich ist.
Ferdinand Schmalz fügt eine gehörige Portion Ironie hinzu und prägt damit die Figuren.
Manchmal kann einem die Handlung etwas viel werden. Ob einem dieser Roman gefällt hängt davon ab, ob man sich über diese teilweise absurden Sprachszenarien und dem Sarkasmus amüsieren und erfreuen kann. Ich finde, es ragt dadurch aus der Masse an konventionell erzählten Neuerscheinungen heraus.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Der Klappentext von "Mein Lieblingstier heißt Winter" hat mich neugierig gemacht. Leider wurde mir dann bereits auf den ersten Seiten klar, dass ich mit diesem Buch nicht warm werde, und das liegt vornehmlich am Schreibstil. Ferdinand Schmalz bedient sich einer Kunstsprache, die …
Mehr
Der Klappentext von "Mein Lieblingstier heißt Winter" hat mich neugierig gemacht. Leider wurde mir dann bereits auf den ersten Seiten klar, dass ich mit diesem Buch nicht warm werde, und das liegt vornehmlich am Schreibstil. Ferdinand Schmalz bedient sich einer Kunstsprache, die entfernt an eine süddeutsche Umgangssprache erinnern soll, und durch beabsichtigte Grammatikfehler und ungewöhnlichen Satzbau äußerst sperrig anmutet. Ich hatte zunächst gehofft, mich mit der Zeit daran zu gewöhnen, doch je weiter ich las, desto mehr nervte es mich.
Hätte mir die merkwürdige Sprache nicht die Freude am Buch genommen, hätte mich die morbid-groteske Geschichte um den Tiefkühlwarenhändler Franz Schlicht durchaus in ihren Bann ziehen können. Unwillkürlich musste ich während der Lektüre an David Schalkos Serien "Der Aufschneider" und "Braunschlag" denken.
Wer David Schalko und Josef Hader mag und sich für dieses Buch interessiert, sollte unbedingt vorab die Leseprobe lesen. Meinen Geschmack hat es leider nicht getroffen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Franz Schlicht ist Tiefkühlkostvertreter in Wien. Er ist gut in seinem Job, weiß, was seine Kunden wünschen und womit er sie locken kann. Worauf er jedoch nicht vorbereitet ist, ist ein Wunsch von Doktor Schauer, der ahnt, dass seine letzten Tage gekommen sind und sich ein Ableben in …
Mehr
Franz Schlicht ist Tiefkühlkostvertreter in Wien. Er ist gut in seinem Job, weiß, was seine Kunden wünschen und womit er sie locken kann. Worauf er jedoch nicht vorbereitet ist, ist ein Wunsch von Doktor Schauer, der ahnt, dass seine letzten Tage gekommen sind und sich ein Ableben in einer Tiefkühltruhe wünscht, um anschließend auf einer Lichtung aufgebahrt zu werden. Zum verabredeten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, nur Schauers Tochter ist anwesend und verpflichtet Schlicht kurzerhand dazu, ihren Vater wieder aufzutreiben. Es beginnt eine aberwitzige Suche nach dem älteren Herrn, die Schlicht nicht nur an den Rand des Wahnsinns, sondern auch in Todesnähe bringt und so manche Machenschaft der besseren Wieder Gesellschaft zutage befördert.
Ferdinand Schmalz‘ Debütroman hat es direkt auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 geschafft. Diese Ehrung ist nicht schwer nachzuvollziehen, sprüht der Text nur so vor herrlich pointierten Formulierungen, die die Absurdität der Handlung virtuos unterstreichen. Hinzu kommen die Figuren, die einerseits mitten aus dem Leben zu stammen scheinen, zugleich aber auch ein kurioses Gruselkabinett darstellen.
Schlicht ist – wie sein Name unverblümt andeutet – ein eher schlichtes Gemüt. Er macht seine Arbeit ordentlich, erwartet nicht viel mehr vom Leben und ist daher auch bereit, einem Kunden einen Wunsch zu erfüllen, auch wenn dieser eher makabrer und zweifelhafter Natur ist. Dass er damit in ein Netz ungeheuerlicher Machenschaften gerät und zum Ziel der Putzfirmenchefin Schimmelteufel wird, kann er nicht ahnen, und so trifft ihn die Heftigkeit, mit der die Reinigungskönigin ihn in seinen Recherchen versucht zu stoppen mit unerwarteter Wucht.
„Und ist die Welt auch voller Schmutz, gibt es doch eine Reinigung. Und gibt es Kräfte in der Welt, die immer wieder sich drum kümmern, dass alles dann ins Reine.“
Neben Putzfrauen, die Geld waschen, und Ministerialräten mit Hang zu Nazisymbolik tauchen auch einfältige Handlanger und die zahnfetischistische Tochter des vermissten Arztes auf, die alle auf ihre Weise liebevoll mit ihren Unzulänglichkeiten gezeichnet sind und zugleich die Geschichte wie eine Reise durch die Geisterbahn wirken lassen. Keine Niederung des menschlichen Seins wird ausgelassen, bisweilen mehr Fetisch als man zu ertragen können glaubt, machen den Roman zu einer Tour de Farce, die erfolgreich auf dem ganz schmalen Grat zwischen urkomisch und verschreckend balanciert.
„(…) dass es ihm vorkäme, als wäre er ein Teil von einer größeren Erzählung. Er sei da andrer Meinung. Denn alles sei zu unwahrscheinlich für so eine Erzählung. Die Wirklichkeit sei viel freier noch erfunden, als jegliche Erzählung das zustande bringen würd.“
Ein herrlicher Spaß, wenn man sich draufeinlassen kann, der vor allem sprachlich überzeugt und einlädt, mit etwas Distanz auf die Welt und unser Dasein zu blicken.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Damit kann ich getrost das Buch „Mein Lieblingstier heißt Winter“ von Ferdinand Schmalz für mich zusammenfassen. Denn ich hatte mir unter dem Buch etwas anderes vorgestellt und für die Charaktere im Buch läuft auch …
Mehr
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Damit kann ich getrost das Buch „Mein Lieblingstier heißt Winter“ von Ferdinand Schmalz für mich zusammenfassen. Denn ich hatte mir unter dem Buch etwas anderes vorgestellt und für die Charaktere im Buch läuft auch sehr viel völlig anders als geplant. Fest steht für mich aber, dass das Buch und ich nicht zusammenpassen.
Aber von vorn.
Doktor Schauer ist an Krebs erkrankt und er hat einen Plan: er möchte mit drei Schlaftabletten intus in seiner eigenen Kühltruhe erfrieren. Nach seinem Freitod in „erhabener Entschlossenheit“ statt des langsamen Siechtums an der Krankheit soll der fahrende Tiefkühlwarenverkäufer Franz Schlicht seine Leiche „aussetzen“ und den Suizid zum Happening machen. Aber als Schlicht den toten gefrorenen Schauer abholen möchte, ist die Kühltruhe leer und der Suizident weg. Eine wilde Suche beginnt.
Ich bin ein großer Freund von sprachlichen Experimenten. Ich bin auch ein großer Freund ungewöhnlich geschriebener Bücher. Aber das Buch hat meinen Toleranzrahmen gesprengt und ich konnte mit dem Stil des Autors nicht warmwerden. Manche Aspekte und Passagen haben mich wirklich begeistert, seine bildhafte Sprache und die Tatsache, dass die Namen der Charaktere pointiert und unglaublich gut gewählt sind, hat mich beeindruckt. Philosophische und morbide Fragen, schwierige Themen wie Suizid, gelungene literarische Bezüge und Querverweise – es hätte so gut sein können. Aber in der Masse hat mich das Buch eher erschlagen und ich hätte es beinahe aufgegeben, nachdem ich manche der wild zusammengeschachtelten Sätze viermal oder öfter lesen musste. So kam für mich kein Lesefluss zustande und keine Lesefreude auf. Leider, ich hätte das Buch sehr gerne gemocht.
Daher vergebe ich drei Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für