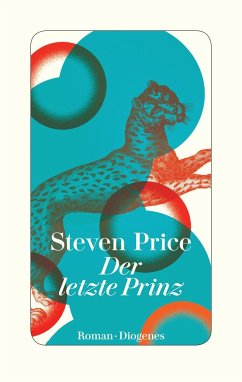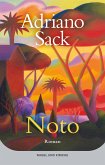Sizilien, 1955: Giuseppe Tomasi ist der Letzte im Geschlecht der Lampedusa. Melancholisch streift er durch das staubige Palermo und ignoriert seine prekäre finanzielle Situation. Als bei ihm ein Lungenemphysem diagnostiziert wird, beschließt Tomasi, etwas Bleibendes zu schaffen. Der 59-Jährige schreibt den weltberühmten Roman 'Der Leopard'.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Andreas Rossmann rät, die Finger zu lassen von Steven Prices romanhafter Annäherung an, oder besser Entfernung von, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Für Rossmann bestenfalls Kolportage. Schon die Idee, der Schriftsteller könnte seinen großen Roman "Der Leopard" erst nach der Tumordiagnose in Angriff genommen haben, stört Rossmann. Wieso die Tatsachen verdrehen? Dass der Autor gut geforscht hat und sämtliche "Lebensthemen" Tomasis ins Buch packt, ändert für Rossmann nichts daran: Der Autor trifft am Ziel vorbei. Tomasi kommt dem Leser nicht näher. Eher begräbt ihn der Autor unter Smalltalk, Schmuck, Sentimentalitäten, findet Rossmann. Leider.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Kanadier Steven Price erzählt aus der Lebensgeschichte Giuseppe Tomasi di Lampedusas,
so üppig wie dieser selbst. Damit begibt er sich in riskante Konkurrenz
VON MAIKE ALBATH
Merkwürdig, wie unbefangen dieser Mann ist. Der Kanadier Steven Price, 1976 geboren, Lyriker und Romancier, Literaturdozent an der Universität von Victoria, ein Profi im Ausdrucksgewerbe, knüpft vollkommen ungebrochen an die literarische Tradition des 19. Jahrhunderts an und räkelt sich auf seinem erzählerischen Lehnstuhl, als wäre er Charles Dickens persönlich.
Vielleicht sieht er sich durch sein Sujet dazu berechtigt? Weil auch sein Held Giuseppe Tomasi, Fürst von Lampedusa und Autor des Klassikers „Der Leopard“, durch und durch altmodisch war, dem Vorkriegsfeudalismus entsprungen? Price hat jedenfalls einen Narren gefressen am ursizilianischen Stoff dieser Biografie, der mit einer untergehenden Adelsdynastie, einem Muttersöhnchen und verhinderten Schriftsteller zu tun hat und im Italien der Fünfzigerjahre spielt.
Eine schlechte Spürnase kann man dem Kanadier nicht vorwerfen, denn in der Tat wäre Tomasi di Lampedusa einen Roman wert. Das Problem ist eher, dass das reale Leben des melancholischen Fürsten, seine Briefe, die Briefe seiner Ehefrau und seiner Mutter an und für sich romanhaft genug wären. Eine Literarisierung läuft zwangsläufig Gefahr, dahinter zurückzubleiben. Hinzu kommt noch Tomasis eigenes grandioses Epochengemälde, das – und das ist die eigentliche Tragödie – erst posthum erschien: „Der Leopard“ mit seinen schillernden Tableaus ist nicht nur ein Beispiel an stilistischer Opulenz, sondern bietet auch eine subtile Analyse der politischen Verhältnisse. Die Latte liegt also ziemlich hoch, und Luchino Viscontis berühmte Verfilmung tut ein Übriges.
Price weiß das alles, ihm scheint ein universeller Künstlerroman, ein Sizilienfresko vorgeschwebt zu haben. Er lässt sich dazu von biografischen Materialien inspirieren, verdichtet bestimmte Dinge, lässt andere weg und scheint auch Auskünfte von dem real existierenden Adoptivsohn Tomasis, dem ehemaligen Opernintendanten Gioacchino Lanza Tomasi, eingeholt zu haben, wie die Danksagung verrät. Eine Bibliografie mit Quellen gibt es nicht.
Die Handlung seines Romans „Der letzte Prinz“ setzt im Januar 1955 ein, als der kettenrauchende Fürst einen Termin bei seinem Hausarzt hat und mit der Diagnose eines Lungenemphysems konfrontiert wird. Wie Price es darstellt – Belege gibt es dafür keine – hält Tomasi den Befund vor seiner Ehefrau, der Psychoanalytikerin Licy von Wolff-Stomersee, einer baltischen Adligen, geheim. Das Wissen um seine eigene Endlichkeit verstärkt nach Prices eher banaler Interpretation Giuseppe Tomasis plötzlichen kreativen Rausch: Nach Jahrzehnten des Müßiggangs sieht er sich auf einmal befähigt, das Sizilien um 1860 aufleben zu lassen, als Garibaldi die Insel eroberte, die italienische Einigung bevorstand und ein seinem Urgroßvater nachempfundener Patriarch, ein Astronom, die alte Welt untergehen sah. Dessen Neffe Tancredi weiß die Zeichen der Zeit richtig zu interpretieren, schlägt sich auf die Seite der Freischärler und heiratet die Tochter eines Emporkömmlings, bricht also mit den adligen Traditionen.
Price legt da eine Parallele zu realen Geschehnissen an: Damals hatte Giuseppe Tomasi tatsächlich intensiven Umgang mit seinem entfernten Cousin Gioacchino Lanza, den der kinderlose Fürst sogar adoptierte, um ihm seinen Adelstitel zu vermachen. In seinem fröhlichen Draufgängertum weckte der junge Verwandte samt seiner Verlobten Mirella väterliche Gefühle bei ihm, und das schlug sich auch auf die charakterliche Gestaltung der Figur Tancredi nieder.
Schlussfolgerungen dieser Art sind weder neu noch überraschend. Zu Beginn ist „Der letzte Prinz“ zu statuarisch, weil Price eine Fülle an Informationen und kulturgeschichtlichen Details in die Erzählung packt. Der weitere Aufbau mit Rückblenden, Intermezzi über den Besuch eines Schriftstellerkongresses, einem Ausflug zu Tomasis Herzogtum und einer Landpartie zu seinen Cousins nach Capo d’Orlando, einer Coda über seinen frühen Tod in Rom und einer Schlusskadenz mit dem gealterten Gioacchino wirkt eher wie die Abwicklung eines Bauplans. Von mitreißenden künstlerischen Nöten keine Spur.
Am befremdlichsten aber ist Steven Prices Mimikry: der Versuch, genauso farbenprächtig zu erzählen wie Giuseppe Tomasi di Lampedusa selbst. Daran muss der Kanadier zwangsläufig scheitern. Sätze wie „Staub und Hitze in einem schenkelhohen Wirbelsturm in goldenem Licht“ oder „Er arbeitete mit nüchterner Klarheit und wenn die Wörter langsamer wurden, ließ er sich Zeit und wartete, bis sie wieder in Gang kamen und seine Hand sich wieder regte, bewusst und stetig, glatt auf dem glatten Papier, die Fingerspitzen entflammt in der furiosen späten Stunde“ japsen nicht nur unter der Fülle schiefer Bilder, sondern entfalten eine gewisse Kitsch-Aura. Das sizilianische Licht ist immer „golden“ und der Himmel „tiefblau“.
Besonders quälend sind Beischlafszenen, bei denen Licy ihren Mann allen Ernstes mit den Worten „Komm her, mein Leopard“ lockt. Gerade weil es über Tomasi di Lampedusa und Sizilien etliche Zeugnisse gibt, von Fotografien bis zu Liebesbriefen, wirkt Prices Unterfangen manchmal so, als habe er nachträglich einen Stummfilm vertont. Die Stimmen – es gibt seitenlange Dialoge – passen einfach nicht zu den Figuren, um die es geht.
Und schließlich setzt der kanadische Autor mehr auf spektakuläre Beziehungstaten im familiären Umfeld von Tomasi, statt auf die Konfliktlinien unter seinen Hauptfiguren. Aus dem Konkurrenzverhältnis zwischen der psychoanalytisch gestählten Licy und Tomasis eifersüchtiger Mutter Beatrice hätte er viel mehr machen können.
Nach und nach verstärkt sich beim Lesen der Eindruck des Parasitären: Steven Prices Begeisterung für die Epoche und das Personal mögen echt sein, aber er bedient sich viel zu freimütig aus der Requisitenkammer des Melodrams. Vielleicht hätte ihm eine andere Tonlage genützt, eine bewusst kühle Annäherung oder mehr Selbstironie.
Es gibt ein glänzendes Beispiel für einen Roman über einen vergleichbaren Gegenstand in der zeitgenössischen italienischen Literatur: Daniele del Giudices Roman „Das Land vom Meer aus gesehen“ (1983) über den geheimnisvollen Triestiner Intellektuellen Bobi Bazlen. Hier bezieht der Erzähler die eigene Recherche mit ein, geht mit großer Diskretion vor, befragt Zeitzeugen und arbeitet mit Brechungen.
Steven Price reflektiert seine eigene Faszination nicht. Stattdessen setzt er auf ein ungebrochenes Wiederaufleben dessen, was war. Damit verschenkt er eine großartige Möglichkeit. Eines gelingt ihm allerdings: Man bekommt Lust, den „Leoparden“ wieder zu lesen.
Steven Price: Der letzte Prinz. Aus dem Englischen von Malte Krutzsch. Diogenes, Zürich 2020. 366 Seiten, 22 Euro.
Das Licht
in Sizilien:
immer „golden“
Man bekommt Lust
auf den eigentlichen
„Leoparden“
Alain Delon und Claudia Cardinale in Luchino Viscontis Verfilmung „Il Gattopardo“ von 1963.
Foto: imago
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Falschspiel Biographie: Steven Price verfehlt mit seinem Roman "Der letzte Prinz" Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
An einem grauen Wintermorgen Ende Januar 1955 geht Giuseppe Tomasi di Lampedusa - nicht der Schriftsteller, aber der gleichnamige Protagonist des Romans "Der letzte Prinz" von Steven Price - in Palermo zum Arzt. Dr. Coniglio hat ihn zu einem Lungenfunktionstest bestellt und bringt ihm behutsam, doch ohne Umschweife bei, dass seine Befürchtung eingetreten ist: "Ein Emphysem. Es lässt sich vielleicht aufhalten, aber nicht heilen." Dann verschreibt er seinem Patienten etwas gegen die Schmerzen und drängt ihn, das Rauchen aufzugeben: "Sie müssen Ihre Lebensweise ändern. Regelmäßig Sport treiben. Spazieren gehen. Weniger essen. Sorgen und Stress vermeiden, wo Sie können."
Auf seinen Stock gestützt, macht sich Tomasi auf den Weg zur Buchhandlung Flaccovio in der Via Ruggero Settimo. Ein paar Ecken weiter steckt er sich eine Zigarette an. Die Diagnose lässt ihm keine Ruhe: "Das plötzliche, klare Bewusstsein vom eigenen Tod erfüllte ihn." Gegen seine Gewohnheit nimmt er einen Umweg und betritt, das erste Mal seit dreißig Jahren, eine Kirche: "Ihn bedrückte, wie wenig von ihm bleiben würde, wenn er erst tot war . . . Er, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hatte nichts hervorgebracht."
Im Caffè Mazzara trifft er seinen Cousin, den Lyriker Lucio Piccolo, und fragt ihn, "ob er je darüber nachgedacht hatte, was nach seinem Tod von ihm blieb". Zerstreut bekennt er: "Ich dachte immer, ich würde mal einen Roman schreiben." Seiner Frau erzählt er nichts von dem Emphysem, sondern variiert das Thema: "Ich habe über Kinder nachgedacht", sagt er leise, doch die kann darüber nicht lachen. Sie ist sechzig, er 58 Jahre alt. Am Abend schlägt er sein Notizbuch auf und beginnt zu schreiben: "Es überraschte ihn, wie leicht die Sätze kamen."
In der ersten Episode biegt sich Steven Price die Motive zurecht, mit denen er glaubt, dem "späten" Schriftsteller auf die Spur zu kommen und das Entstehen dessen Epochenromans "Il Gattopardo" zu erklären: Im Angesicht des Todes befällt Tomasi eine Art Torschlusspanik, und er rafft sich auf, etwas Bleibendes zu schaffen. Der Begründungszusammenhang klingt plausibel, schematisch, ja geradezu lehrbuchhaft. Das Problem ist nur, dass er von falschen Tatsachen ausgeht. In der neuesten Biographie des Schriftstellers ("Il principe di Lampedusa", Palermo 2018), schreibt Salvatore Savoia dass im Frühling 1957 die ersten Anzeichen eines Lungentumors auftraten, da war der Roman gerade fertig; und auch das Standardwerk "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" von Andrea Vitello (Palermo 1987), einem studierten Mediziner, datiert die ersten Symptome der Krankheit auf drei Monate vor dessen Tod am 23. Juli 1957.
Ein Emphysem und ein Arztbesuch im Januar 1955 sind nicht belegt. Das muss nicht heißen, dass es sie nicht gab. Doch den Impuls, seinen Roman zu schreiben, bekundete Tomasi bereits auf einem Schriftstellertreffen Mitte Juli 1954 in San Pellegrino Terme, wohin er den von Eugenio Montale eingeladenen Cousin begleitet hatte. Den Stoff trug er sogar schon länger mit sich herum: Die Lyrikerin Maria Luisa Spaziani erinnert sich, dass Lucio Piccolo fürchtete, seine Angehörigen würden ihn "geradeso an gebrochenem Herzen sterben lassen wie den armen Giuseppe, der uns zwanzig Jahre bevor er mit dem Schreiben begann, unter dem Gähnen aller den ,Gattopardo' erzählte".
Statt Tomasis Biographie aus den Lebensverhältnissen und -zeugnissen zu erschließen, stülpt ihm der kanadische Autor Price ein vorgefertigtes Deutungsmuster über. Der Rat des Arztes erhellt es beispielhaft: "Sorgen und Stress vermeiden" ist heute von Wien bis Vancouver die Standardformel, doch an der Lebensweise eines sizilianischen Fürsten geht sie vorbei. Tomasi di Lampedusa verbrachte seine Tage damit, seinen beiden Leidenschaften, der Literatur und den Süßspeisen, zu frönen: Am Morgen begab er sich zum Lesen in die Pasticceria del Massimo, ging am späten Vormittag in die Buchhandlung Flaccovio hinüber und setzte sich am frühen Nachmittag in die Pasticceria Caflisch. Sein Leben war nicht sorglos, er war verarmt, träge, übergewichtig, die moderne Zivilisationskrankheit Stress aber hat er nicht gekannt. Der letzte Spross einer alten Adelsfamilie fühlte sich einer Welt zugehörig, die es nicht mehr gab und deren Untergang er sehr bewusst registrierte.
Price erwähnt das, doch er weiß nichts damit anzufangen. Der Selbstverständlichkeit, mit der er das Unzeitgemäße an Tomasi unterschlägt, entspricht eine gepflegte Unterhaltungsliteratur, die dessen Leben - angelehnt an "Il Gattopardo"? - in acht Episoden nacherzählt. Price hat viel gelesen, Orte besichtigt und mit Gioacchino Lanza Tomasi, dem Adoptivsohn und Erben, gesprochen. Die symbiotische Mutterbindung Tomasis, die Kriegsgefangenschaft und die Bildungsreisen in europäische Großstädte, die komplizierte Ehe mit der deutsch-baltischen Psychoanalytikerin Alexandra von Wolff-Stomersee, die Zerstörung des Palazzo Lampedusa, dem Ort seiner glücklichen Kindheit, die Ablehnung des Romans, dessen Welterfolg er nicht mehr erlebte - alle Lebensthemen kommen vor, doch werden sie durchsetzt mit Konversation und Kolportage, Sentimentalitäten und Smalltalk. Price lässt es menscheln und knistern, gefällt sich in Anspielungen, ergeht sich in Ausschmückungen und atmosphärischen Details und zieht oberflächliche Parallelen zum großen Vorbild. Tomasis Genie, sein Weltschmerz, seine abgründige Ironie werden benannt, aber nicht ausgelotet. Die gefällige Aufbereitung neutralisiert seine Fremdheit. Der Leopard als Papiertiger.
Das Dilemma der fiktiven Biographie wird offenkundig: Ihr Protagonist ist mit der historischen Figur nicht identisch, doch wie dieser Gemeinplatz zur Lizenz für Entstellungen und Nivellierungen wird, lässt das Buch mehr über den Autor als über seinen Gegenstand mitteilen. "Der letzte Prinz" verhält sich zu "Il Gattopardo" etwa so wie eine amerikanische Fernsehadaption des Stoffs zum Film von Luchino Visconti. Die Alternative für den Leser ist greifbar: "Der Leopard", wie der Roman nun wieder heißt, ist 2019 in einer neuen Übersetzung von Burkhart Kroeber erschienen.
ANDREAS ROSSMANN
Steven Price: "Der letzte Prinz". Roman.
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch. Diogenes Verlag, Zürich 2020. 368 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Total spannend. Vor allem, wenn man den Film kennt, liebt man diese Geschichte.« Bettina Wagner / ORF ORF