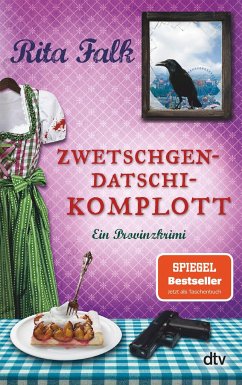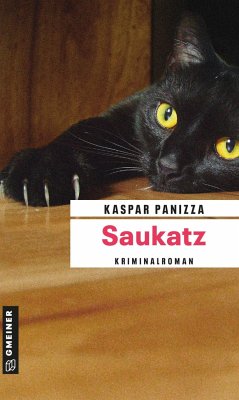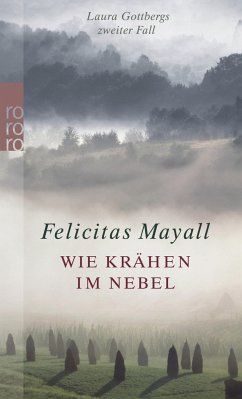Nicht lieferbar

Bettina Plecher
Broschiertes Buch
Giftgrün / Frieda & Quast Bd.1
Kriminalroman
Übersetzer: Gunsteren, Dirk van
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Gift & Gallenkolik.Friedas erste richtige Stelle als Stationsärztin an einem Münchner Klinikum beginnt mit einem Paukenschlag: Schon am zweiten Tag ist ihr Doktorvater tot. Colchizin-Vergiftung, stellt Friedas Mitbewohner, der Toxikologe Quast, schnell fest. Für die Klinikleitung ist der Fall damit geklärt - nicht das erste Mal, dass ein Hobbykoch beim Kräutersammeln im Englischen Garten Bärlauch mit der hochgiftigen Herbstzeitlose verwechselt hat. Doch Frieda und Quast hegen Zweifel. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Tote selbst einige Leichen im Keller hatte - und dass Prof...
Gift & Gallenkolik.
Friedas erste richtige Stelle als Stationsärztin an einem Münchner Klinikum beginnt mit einem Paukenschlag: Schon am zweiten Tag ist ihr Doktorvater tot. Colchizin-Vergiftung, stellt Friedas Mitbewohner, der Toxikologe Quast, schnell fest. Für die Klinikleitung ist der Fall damit geklärt - nicht das erste Mal, dass ein Hobbykoch beim Kräutersammeln im Englischen Garten Bärlauch mit der hochgiftigen Herbstzeitlose verwechselt hat. Doch Frieda und Quast hegen Zweifel. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Tote selbst einige Leichen im Keller hatte - und dass Professor Naders Ableben mehr als einem Kollegen an der Eisbachklinik durchaus gelegen kommt ...
Friedas erste richtige Stelle als Stationsärztin an einem Münchner Klinikum beginnt mit einem Paukenschlag: Schon am zweiten Tag ist ihr Doktorvater tot. Colchizin-Vergiftung, stellt Friedas Mitbewohner, der Toxikologe Quast, schnell fest. Für die Klinikleitung ist der Fall damit geklärt - nicht das erste Mal, dass ein Hobbykoch beim Kräutersammeln im Englischen Garten Bärlauch mit der hochgiftigen Herbstzeitlose verwechselt hat. Doch Frieda und Quast hegen Zweifel. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Tote selbst einige Leichen im Keller hatte - und dass Professor Naders Ableben mehr als einem Kollegen an der Eisbachklinik durchaus gelegen kommt ...
Plecher, BettinaBettina Plecher wurde 1969 in München geboren. Nach ihrem Studium der Klassischen Philologie und Germanistik arbeitete sie als Fremdsprachenassistentin, Lehrerin und Schulbuchautorin in Yorkshire, Würzburg und München. Heute lebt sie mit ihrem Mann, einem Klinikarzt, und ihren beiden Kindern in München.
Produktdetails
- rororo Taschenbücher 23562
- Verlag: Rowohlt TB.
- Originaltitel: The Human Stain
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 22. April 2013
- Deutsch
- Abmessung: 189mm x 126mm x 25mm
- Gewicht: 300g
- ISBN-13: 9783499235627
- ISBN-10: 3499235625
- Artikelnr.: 36794960
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Der Debutroman von Bettina Plecher bietet spannende Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Seite. Bereits der wirklich gelungene Prolog überzeugt und eröffnet eine spannende Reise über fast dreihundert Seiten, ohne viel Atempause. Es fällt einfach schwer das Buch aus der …
Mehr
Der Debutroman von Bettina Plecher bietet spannende Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Seite. Bereits der wirklich gelungene Prolog überzeugt und eröffnet eine spannende Reise über fast dreihundert Seiten, ohne viel Atempause. Es fällt einfach schwer das Buch aus der Hand zu legen.
Die Protagonisten sind sehr menschlich angelegt, mit ihren Stärken und Schwächen, wie aus dem wirklichen Leben und so wirken sie auch sehr authentisch. Aber auch die Nebenpersonen werden sehr gut und detailliert dargestellt, so dass man sich mit ihnen identifizieren kann.
Der bayerische Einschlag wirkt sehr sympathisch und die wenigen im Dialekt geschriebenen Passagen sind gut verständlich.
Sehr schön auch die Einbeziehung von München und bekannten Plätzen, die dem Buch einen besonderen Reiz geben. Die Mischung zwischen der Klinikszene und München wirkt durchaus stimmig.
Der rote Faden der Story bewegt sich durch das ganze Buch, mit kleineren Überraschungen und Wendungen. Getragen von einem Spannungsbogen der schnell aufgebaut wird und langsam bis zum Ende dann Stück für Stück abgebaut ist.
Fazit: Für einen Debutroman wirklich sehr gelungen, vor allem der Schreibstil ist klasse, da kann man noch viel Spannendes erwarten
Weniger
Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich
Frieda Mays erster Tag in der Münchner Eisbachklinik verläuft alles andere als angenehm: Ihr Doktorvater Georg Nader, wegen dem sie überhaupt erst nach München gekommen ist, wird mit einer Vergiftung eingeliefert. Frieda und ihr Mitbewohner und Kollege Quirin Quast glauben nicht …
Mehr
Frieda Mays erster Tag in der Münchner Eisbachklinik verläuft alles andere als angenehm: Ihr Doktorvater Georg Nader, wegen dem sie überhaupt erst nach München gekommen ist, wird mit einer Vergiftung eingeliefert. Frieda und ihr Mitbewohner und Kollege Quirin Quast glauben nicht daran, dass Nader beim Kräutersammeln im Englischen Garten Bärlauch mit Herbstzeitlosen verwechselt hat und versuchen dem auf die Spur zu kommen. Dabei wirbeln sie in der Klinik einigen Staub auf…
„Giftgrün“ von Bettina Plecher ist ein tolles Debüt und ein toller München-Krimi. Die Stärke des Buchs liegt auf jeden Fall in seinen Charakteren. Die beiden Protagonisten Frieda und Quast sind sehr sympathisch, haben aber trotzdem ihre Ecken und Kanten und handeln auch mal unlogisch. Mehr als einmal dachte ich mir: Was macht ihr denn da?? Aber man fiebert immer mit ihnen mit und sie wirken sehr lebendig.
Genauso toll sind aber auch die Nebenfiguren. Da ist zum Beispiel Karl Zitzelsperger, Computerspezialist und waschechter Bayer, der noch bei Mutti wohnt und sich dort bekochen lässt. Oder Margret Ernst, Leiterin der Intensivstation, für die das Rauchverbot in der Klinik nicht gilt und die auch gern mal Tetris spielt, wenn sie Pause hat.
Überhaupt wird in „Giftgrün“ sehr viel geraucht und getrunken (Ärzte sind ja da die Schlimmsten, obwohl sie es besser wissen müssten…) und vor allem gut und bayerisch gegessen. Das macht meiner Meinung nach mit den Charme des Krimis aus. Wenn man die Stadt kennt, findet man sich auch direkt in München wieder. Auch Dialekt und regionale Besonderheiten werden gut dosiert eingesetzt.
Einen kleinen Kritikpunkt habe ich aber doch. Insgesamt hätte ich mir von einem Krimi etwas mehr Ermittlungen erwartet. Hier ermitteln zwar keine Profis, aber manchmal haben sie mir einfach zu sehr im Dunkeln und etwas ziellos rumgestochert. Aber der sehr schöne Schreibstil und die tollen Charaktere reißen das wieder raus.
Ich kann „Giftgrün“ also auf jeden Fall weiterempfehlen! 4 von 5 Sternen.
Weniger
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Klappentext:
Gift & Gallenkolik. Friedas erste richtige Stelle als Stationsärztin an einem Münchner Klinikum beginnt mit einem Paukenschlag: Schon am zweiten Tag ist ihr Doktorvater tot. Colchizin-Vergiftung, stellt Friedas Mitbewohner, der Toxikologe Quast, schnell fest. Für …
Mehr
Klappentext:
Gift & Gallenkolik. Friedas erste richtige Stelle als Stationsärztin an einem Münchner Klinikum beginnt mit einem Paukenschlag: Schon am zweiten Tag ist ihr Doktorvater tot. Colchizin-Vergiftung, stellt Friedas Mitbewohner, der Toxikologe Quast, schnell fest. Für die Klinikleitung ist der Fall damit geklärt – nicht das erste Mal, dass ein Hobbykoch beim Kräutersammeln im Englischen Garten Bärlauch mit der hochgiftigen Herbstzeitlose verwechselt hat. Doch Frieda und Quast hegen Zweifel. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Tote selbst einige Leichen im Keller hatte - und dass Professor Naders Ableben mehr als einem Kollegen an der Eisbachklinik durchaus gelegen kommt …
Autorin:
Bettina Plecher wurde 1969 in München geboren. Nach ihrem Studium der Klassischen Philologie und Germanistik arbeitete sie als Fremdsprachenassistentin, Lehrerin und Schulbuchautorin in Yorkshire, Würzburg und München. Heute lebt sie mit ihrem Mann, einem Klinikarzt, und ihren beiden Kindern in München.
Meinung:
Das Cover ist sehr auffällig gestaltet und passt sehr gut zu der Geschichte. Das Glas Pesto, die Deck und der blaue Himmel dazu fallen doch sehr auf. Am auffälligsten ist das Glas Pesto mit der roten Aufschrift „Giftgrün“.
Der Schreibstil von Bettina Plecher gefällt mir sehr. Der Roman liest sich angenehm flüssig und ist unterhaltsam und spannend geschrieben.
Die Beschreibungen der Schauplätze in der Münchener Gegend und auch vom leckeren Essen sind sehr gelungen, so dass man sich alles wunderbar vorstellen konnte.
Die Protagonisten sind sehr gut beschrieben und Quirin Quast und Frieda May waren mir gleich sympathisch und auch der Karl Zitzelsberger, der noch bei seiner Mutter wohnt.
Die Assistenzärztin Frieda May und ihr Mitbewohner der Toxikologe Quirin Quast versuchen herauszufinden, wer den leitenden Oberarzt Gabor Nader vergiftet hat und wer dieses Glas Kräuterpesto mitgebracht hat. Ein sympathisches Ermittlerteam und eine spannende und unterhaltsame Geschichte.
Mir hat dieser Krimi sehr gut gefallen und freue mich schon auf den nächsten Band dieser Reihe.
Fazit:
Ein unterhaltsamer und spannender Münchner Giftmord-Krimi.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Die Ärztin Frieda May folgt ihrem Doktorvater Gabor Nader nach München an die Eisbachklinik um dort einen Stelle als Stationsärztin anzutreten anstatt in die Entwicklungshilfe zu gehen.
Leider hat sie nicht die Möglichkeit mit ihm zusammen zu arbeiten, da Professor Nader bereits …
Mehr
Die Ärztin Frieda May folgt ihrem Doktorvater Gabor Nader nach München an die Eisbachklinik um dort einen Stelle als Stationsärztin anzutreten anstatt in die Entwicklungshilfe zu gehen.
Leider hat sie nicht die Möglichkeit mit ihm zusammen zu arbeiten, da Professor Nader bereits am zweiten Tag an einer Vergiftung stirbt. Gemeinsam finden Frieda und ihr neuer Mitbewohner der Toxikologe Quirin Quast heraus, dass anstatt Bärlauch Herbstzeitlose im Pesto war. Handelt es sich um eine Verwechslung von Nader oder war es absichtlich vom letzten Date ins Pesto gemischt worden? Die Polizei glaubt an Selbstverschulden, aber Frieda und Quirin wollen diesem Rätsel lösen und ermitteln getrennt von einander weiter und bringen auch Licht in die Dunkelheiten anderen Geheimnisse.
Der Debütkrimi "Giftgrün" von Bettina Plecher ist sehr flüssig geschrieben und ließ mich nur so durch das Buch fliegen.
Die abwechselnde Sichtweisen, neutral, Frieda und Quast machen das Lesen echt spannend, man bekommt die einzelnen Gedankengänge der Personen mit. Die Beschreibung des Klinikalltag war informativ und interessant. Der Leser erfährt einiges über die Strukturen in einem Krankenhaus, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen.
Die Protagonisten sind mit viel Liebe dargestellt worden und haben unterschiedliche Charaktere, Frieda und Quirin sind mir sehr ans Herz gewachsen.
Diesen Krimi kann ich guten Herzens an alle Krimifans weiterempfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Frieda hat gerde erst ihren Doktortitel, als sie ihrem Doktorvater Gabor Nader an die Eisbachklinik nach München folgt. Doch schon bevor sie ihren ersten Arbeitstag antreten kann, wird dieser mit einer Vergiftung in die Klinik eingeliefert. Schon kurz darauf stirbt Nader.
Frieda und ihr …
Mehr
Frieda hat gerde erst ihren Doktortitel, als sie ihrem Doktorvater Gabor Nader an die Eisbachklinik nach München folgt. Doch schon bevor sie ihren ersten Arbeitstag antreten kann, wird dieser mit einer Vergiftung in die Klinik eingeliefert. Schon kurz darauf stirbt Nader.
Frieda und ihr Vermieter, der Toxikologe Quirin Quast ermitteln, denn die Polizei geht von einem Selbstverschulden aus. Doch Frieda und Quirin glauben an einen Mord.
In dem Debütroman von Bettina Plecher geht es kurzweilig zu. Die Protagonisten sind interessant und anders, der Schreibstil hat echten bayrischen Charme. Eingeflossen ist nicht nur ab und an die bayrische Mundart, sondern besonders Münchner Schmankerl und bayrische Lebensart finden hier ihren Platz.
Chefarzt-Allüren, Vergiftung, alte Narben, Karrierezicken und Machtlosigkeit, aber auch Rache und Sühne lassen den Roman zu einem Lesevergnügen werden. Bitte mehr davon !
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für