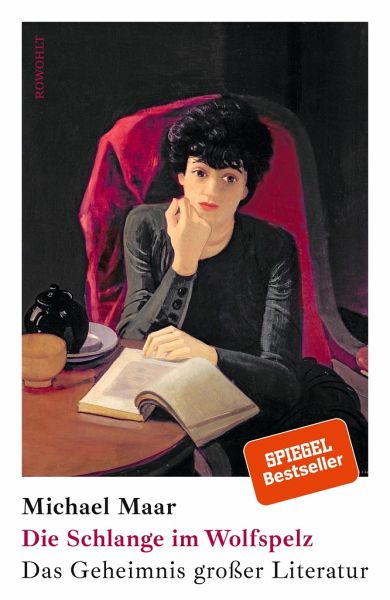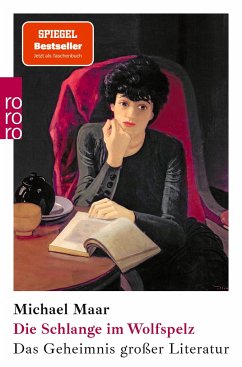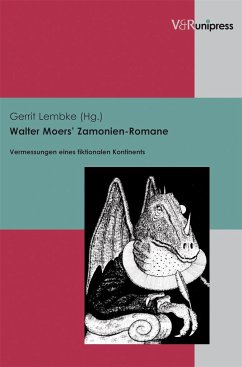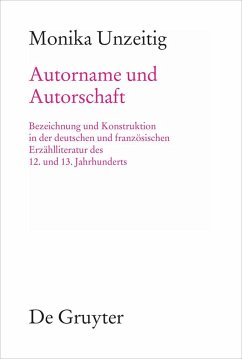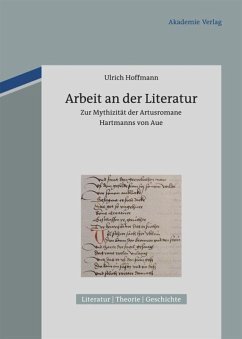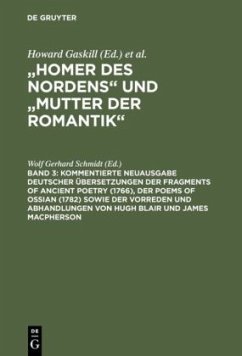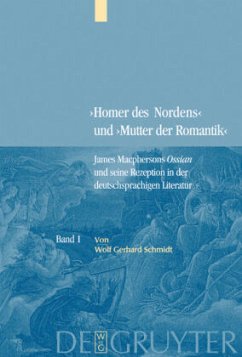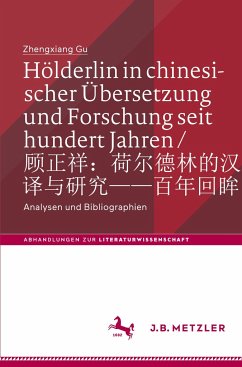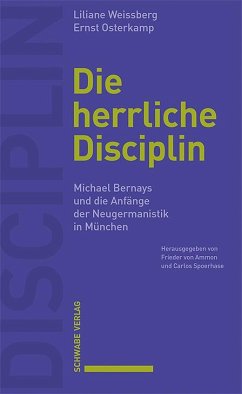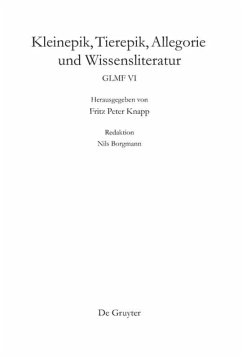Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Was ist das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael Maar in seinem Haupt- und Lebenswerk nach, für das er vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist Manier, was ist Jargon, und in welche Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müssen die Elementarteilchen zusammenspielen für den perfekten Prosasatz? Maar zeigt, wer Dialoge kann und wer nicht, warum Hölderlin über- und Rahel Varnhagen unterschätzt wird, warum ohne die österreichischen Juden ein Kontinent des Stils wegbräche, warum Kafka ein Alien ist und warum nur Heimito von Doderer an Thomas Mann h...
Was ist das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael Maar in seinem Haupt- und Lebenswerk nach, für das er vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist Manier, was ist Jargon, und in welche Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müssen die Elementarteilchen zusammenspielen für den perfekten Prosasatz? Maar zeigt, wer Dialoge kann und wer nicht, warum Hölderlin über- und Rahel Varnhagen unterschätzt wird, warum ohne die österreichischen Juden ein Kontinent des Stils wegbräche, warum Kafka ein Alien ist und warum nur Heimito von Doderer an Thomas Mann heranreicht. In fünfzig Porträts, von Goethe bis Gernhardt, von Kleist bis Kronauer, entfaltet er en passant eine Geschichte der deutschen Literatur.
Michael Maar, geboren 1960, ist Germanist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Bekannt wurde er durch 'Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem Zauberberg' (1995), für das er den Johann-Heinrich-Merck-Preis erhielt. 2002 wurde er in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen, 2008 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste, 2010 bekam er den Heinrich-Mann-Preis verliehen. Das Buch 'Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur' (2020) stand lange auf der Spiegel -Bestsellerliste. Zuletzt erschienen in Neuausgaben'Das Blaubartzimmer' und der Roman 'Die Betrogenen'. Michael Maar hat zwei Kinder und lebt in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Hamburg
- Artikelnr. des Verlages: 23154
- 8. Aufl.
- Seitenzahl: 656
- Erscheinungstermin: 13. Oktober 2020
- Deutsch
- Abmessung: 225mm x 150mm x 45mm
- Gewicht: 778g
- ISBN-13: 9783498001407
- ISBN-10: 349800140X
- Artikelnr.: 59385945
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Verlag GmbH
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Maar verführt, begeistert und belebt. Lest dieses Buch, und wär's nur dieses eine in diesem Jahr! Lest es als Erinnerung daran, worauf es wirklich ankommt. Markus Gasser Literatur ist alles 20250813
Ein souveränes Buch das alle anderen Versuche der letzten Jahre mit demselben Ansatz blass wirken lässt. Bestechend in der Formulierungskunst, überzeugend in der Argumentation, überraschend in der Auswahl.
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Was für ein kluges Buch! Michael Maar ist in "Die Schlange im Wolfspelz" dem Geheimnis großer Literatur auf der Spur und analysiert auf unnachahmliche Weise den Stil bekannter und fast vergessener Autoren. Dass er dabei manchmal mit seinem Hang für Gallizismen …
Mehr
Was für ein kluges Buch! Michael Maar ist in "Die Schlange im Wolfspelz" dem Geheimnis großer Literatur auf der Spur und analysiert auf unnachahmliche Weise den Stil bekannter und fast vergessener Autoren. Dass er dabei manchmal mit seinem Hang für Gallizismen ("voulu", "idées recues", "tordu") gegen die von ihm angeführte Regel Paul Valérys verstößt ("Zwischen zwei Wörtern wähle das geringere") sei ihm verziehen. Und gerade als man denkt, Stil ohne Inhalt ist wie ein 3-Sternelokal, in dem es nur Desserts gibt, serviert er im letzten Kapitel ("Das Pikante und der Spaß der Welt") kräftige Fleischgerichte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Dem Geheimnis auf der Spur
Die Schlange im Wolfspelz von Michael Maar ist ein grandioses Sachbuch über verschiedene Aspekte der Literatur. Betrachtet wird klassische Literatur, aber manchmal auch moderne.
Es ist ein aufregendes Werk, auch eins über das man sich manchmal aufregen kann. …
Mehr
Dem Geheimnis auf der Spur
Die Schlange im Wolfspelz von Michael Maar ist ein grandioses Sachbuch über verschiedene Aspekte der Literatur. Betrachtet wird klassische Literatur, aber manchmal auch moderne.
Es ist ein aufregendes Werk, auch eins über das man sich manchmal aufregen kann. Nicht allen provokanten Thesen von Michael Maar stimme ich ohne weiteres zu. Aber viel ist wirklich originell und Michael Maar ist alles andere als dogmatisch. Michael Maar steigert sich ganz schön rein und zieht den Leser mit in einem Taumel literarischer Fragestellungen über Stil, Metaphern, Bildsprache, Dialoge
Es werden beeindruckend viele, überwiegend deutschsprachige Autoren behandelt: Fontane, Thomas Mann, Canetti, Hemingway, Franz Werfel, Goethe, Grimm, Hebel, Hölderlin, Valery, Heidegger, Heine, Stifter, Storm, Rudolf Borchardt, Anna Seghers, Robert Walser, Kafka, Leo Perutz, Thomas Bernhard, W,G,Sebald, Brigitte Kronauer, Herta Müller, Walter Kappacher, Wolfgang Herrndorf, Botho Strauß, Martin Mosebach, Clemens J.Setz, uva.
Es gibt auch einen Ausflug in die Lyrik.
Ob Maar wirklich dem Geheimnis großer Literatur auf die Spur kommt, kann ich nicht sagen. Aber ich habe viel neues erfahren.
Ein kluges Buch mit viel Humor.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Interessant
Ich bin ohne große Erwartungen an dieses buch gegangen.
Es ist mir tatsächlich auch "nur" aufgefallen, da es für den "Deutschen Sachbuchpreis 2021" nominiert wurde.
Und es hat mich tatsächlich positiv überrascht.
Er untersucht und …
Mehr
Interessant
Ich bin ohne große Erwartungen an dieses buch gegangen.
Es ist mir tatsächlich auch "nur" aufgefallen, da es für den "Deutschen Sachbuchpreis 2021" nominiert wurde.
Und es hat mich tatsächlich positiv überrascht.
Er untersucht und beleuchtet verschiedenste Romane, Erzählungen etc und zeigt sie uns auf seine eigene Weise.
Jedes seiner Werke, dass er beleuchtet bekommt ein eigenes Kapitel. So kann man, wenn einem etwas doch gar nicht zusagt es einfach überspringen. Auch ich wollte nicht alles lesen und habe mir zu Beginn nur ein paar einzelne Kapitel rausgepickt. So kann man nach und nach lesen was einen interessiert.
Wer sich also für Literatur und deren Begleitung interessiert, dem lege ich dieses Buch ans Herz.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Von den Ursachen getrübter Lesefreude
Die Reihe nützlicher Sachbücher zum Thema Literatur ist von Michael Maar mit «Die Schlange im Wolfspelz», einem bei Eva Menasse entlehnten Titel, jüngst um ein populäres Werk ergänzt worden. Der Untertitel «Das …
Mehr
Von den Ursachen getrübter Lesefreude
Die Reihe nützlicher Sachbücher zum Thema Literatur ist von Michael Maar mit «Die Schlange im Wolfspelz», einem bei Eva Menasse entlehnten Titel, jüngst um ein populäres Werk ergänzt worden. Der Untertitel «Das Geheimnis großer Literatur» weist auf das durchaus ambitiöse Vorhaben hin, Licht ins Dunkel der Buchstaben-Kunst zu bringen. Wobei der Autor sich als Germanist, wen wundert’s, auf die deutsche Literatur beschränkt. Wer also als Leser in seiner Lektüre mehr sieht als nur einen angenehmen Zeitvertreib, wer sich über die Finessen eines gekonnten Schreibstils umfassend aufklären lassen will, der wird in diesem informativen Buch fündig. Um dann, deutlich besser gerüstet, in künftige Leseabenteuer aufzubrechen.
Diese Stilkunde beginnt denn auch gleich, die Frage «Was ist Stil?» mit vielen Textbeispielen systematisch und unterhaltsam zu klären. Was sind denn wohl die Fallstricke, die beim Schreiben auf den Autor warten? Um zu verdeutlichen, was denn Stil überhaupt ist, zitiert Maar eine kurze Passage aus Daniel Kehlmanns Roman «Die Vermessung der Welt». Darin wird Humboldt von seinen Ruderern gebeten, etwas zu erzählen. Er könne, bietet er ihnen an, das schönste deutsche Gedicht für sie ins Spanische übersetzen: «Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald wird man tot sein». Die Zuhörer sind verblüfft. Aber er hat alles richtig gemacht, er hat genau das erzählt, was Goethe, als «Wanderers Nachtlied», 1870 an die Holzwand einer Jagdhütte geschrieben hatte. Inhaltlich also gleich, nur stilistisch nicht! «Über allen Gipfeln / ist Ruh, / in allen Wipfeln / spürest du / kaum einen Hauch; / die Vöglein schweigen im Walde. / Warte nur! Balde / ruhest du auch.» Einprägsamer kann man die Funktion von Inhalt und Stil in der Literatur wohl kaum demonstrieren. Und solche anschaulichen Beispiele gibt es ungewöhnlich viele in diesem Buch! Inhalt und Stil, so lernen wir, kann man eben nicht trennen voneinander. Sie gehören zusammen, bilden eine künstlerische Einheit, die, wenn alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, zu großer Literatur werden kann.
Mit vielen Porträts ganz unterschiedlicher Schriftsteller verdeutlicht Maar in unzähligen Textauszügen sprachliche Besonderheiten. Satzbau, Wortwahl, Sprach-Rhythmus, Dialoge, gekonnt eingesetzte Metaphorik oder einprägsame Leitmotive sind Bausteine, aus denen wahre Prosa-Kathedralen entstehen können, wenn Sprachgenies die Baumeister sind. Trotz aller akademischen Bemühungen bleibt die Beurteilung von Sprachkunst aber ein eitles Unterfangen. Das weiß der Autor auch, und so finden sich bei seiner oft sehr strengen Kritik häufig Anmerkungen wie «Die Arno-Schmidt-Jünger werden laut Protest erheben». Es bleibt also auch nicht aus, dass man als Leser manchen Einwand partout nicht nachvollziehen kann. Aber das ist völlig normal und mindert den Wert dieses Literatur-Führers keineswegs. Die Auswahl der als Referenz herangezogenen Schriftsteller ist, Germanisten können wohl nicht anders, zudem derart vorvorgestrig, dass man als heutiger Leser viele nie gelesen hat, bei einigen nicht mal ihrem Namen kennt. Umso erstaunter ist man dann, wenn plötzlich Hildegard Knef auftaucht, deren Autobiografie von Michael Maar stilistisch sehr gelobt wird, - nicht zu unrecht übrigens, wie die Textzitate zeigen.
Wer einigermaßen belesen ist, wird natürlich auch manches finden, bei dem er mitreden, seine Meinung mit dem vergleichen kann, was Maar, oft durchaus scharfzüngig, darüber schreibt. En passant erfahren wir zudem, dass Goethe mit ausgezählten 90.000 Wörtern den höchsten je gemessenen deutschen Wortschatz hatte. Trotzdem sind «Die Wahlverwandtschaften» kein Roman, den heute jemand freiwillig lesen würde, Wortschatz ist eben nicht alles! Schlechten Stil aber dürften aufmerksame Leser nach der Lektüre dieses Ratgebers deutlich besser entlarven können als eine Ursache getrübter Lesefreude!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Klappentext:
„Was ist das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael Maar in seinem Haupt- und Lebenswerk nach, für das er vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist Manier, was ist Jargon, und in welche Fehlerfallen tappen fast alle? Wie …
Mehr
Klappentext:
„Was ist das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael Maar in seinem Haupt- und Lebenswerk nach, für das er vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist Manier, was ist Jargon, und in welche Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müssen die Elementarteilchen zusammenspielen für den perfekten Prosasatz? Maar zeigt, wer Dialoge kann und wer nicht, warum Hölderlin über- und Rahel Varnhagen unterschätzt wird, warum ohne die österreichischen Juden ein Kontinent des Stils wegbräche, warum Kafka ein Alien ist und warum nur Heimito von Doderer an Thomas Mann heranreicht. In fünfzig Porträts, von Goethe bis Gernhardt, von Kleist bis Kronauer, entfaltet er en passant eine Geschichte der deutschen Literatur.“
Es ist im Jahr 2021 nicht mein erstes Buch zum Thema „Lesen“ und ich muss wirklich sagen, das ich überrascht war, was mir hier begegnet ist. Michael Maar nimmt hier alles und jedes Detail aus der Welt des Lesens unter die Lupe. Seine Art dabei ist sehr ansteckend und er macht Lust sich gleich mal einen Klassiker aus dem Bücherregal zu schnappen und das nachzulesen was er dazu so „besonders“ empfindet. Maar dröselt, wenn man so will, die Schreibstile der Autoren auf und will wissen, wer hinter diesen Stilen sitzt und warum dieser Stil so ist wie er ist. Was macht einen Klassiker aus? Was wird zu einem? Was ist „gute“ und was „schlechte“ Literatur? All diese Fragen werden hier sinnvoll und geschmackvoll beantwortet. Man merkt aber auch in jeder Zeile wie besessen Maar von seiner Arbeit ist und was es mit einem macht, so hinter die Kulissen blicken zu wollen. Es gab Passagen, da teilte ich seine Meinung nicht aber das ist ja auch gut so...Geschmäcker und Auffassungsgabe sind nunmal bei jedem Leser anders.
Dies ist ein sehr außergewöhnliches Buch von einem außergewöhnlichen Autor mit einer besonderen Begabung - 4 von 5 Sterne gibt es hier von mir!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für