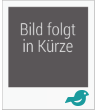Nicht lieferbar





Noch nie war die Zukunft so bedrohlich nah wie in Crichtons neuem Bestseller "Next". In dieser Welt zählt nur eines: gutes Genmaterial. Und Gentechnologie-Unternehmen setzen alles daran, sich die Rechte an profitablem Gewebe zu sichern. Genau das wird Frank Burnet zum Verhängnis. Die Rech-te an seinen Immunzellen hat BioGen Research erworben. Doch Burnet hat nicht vor, sein Gewebe zur freien Verfügung zu stellen, und so bleibt ihm nur die Flucht.
Michael Crichton wurde 1942 in Chicago geboren und studierte in Harvard Medizin. Crichton, der seit Mitte der Sechzigerjahre Romane schrieb, griff immer wieder gekonnt neueste naturwissenschaftliche und technische Forschungen auf. Für die international erfolgreiche Serie "Emergency Room" schrieb er das Drehbuch. Seine Thriller wurden auch als Filme weltweite Erfolge, über siebenundzwanzig Romane und hundert Millionen verkaufte Bücher stehen für sein Werk. Im November 2008 starb Michael Crichton im Alter von 66 Jahren.
Produktdetails
- Verlag: Random House Audio
- Erscheinungstermin: 31. März 2007
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783866046474
- Artikelnr.: 22501641
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2007Mehr geht genetisch nicht
Michael Crichtons "Next" - ein Roman, der wissenschaftlich nichts zu wünschen übriglässt
Es war vor ein paar Jahren in der Praxis eines Berliner Zahnarztes: Während man im Wartezimmer saß, wurde es im Behandlungsraum plötzlich laut. Der sonst so ruhige Arzt schien eine Patientin geradezu anzuschreien. "Lassen Sie mich mit Ihren Genen in Ruhe!", tobte der Doktor und empfahl: "Gehen Sie zu meiner Sprechstundenhilfe und lassen Sie sich zeigen, wie man sich richtig die Zähne putzt." Die Geschichte konnte so nur in Europa spielen, denn sie war ein Ausdruck des klassischen Alt-Europa vor dem Sieg des molekular-genetischen Paradigmas zumindest im medialen Spiegel der
Michael Crichtons "Next" - ein Roman, der wissenschaftlich nichts zu wünschen übriglässt
Es war vor ein paar Jahren in der Praxis eines Berliner Zahnarztes: Während man im Wartezimmer saß, wurde es im Behandlungsraum plötzlich laut. Der sonst so ruhige Arzt schien eine Patientin geradezu anzuschreien. "Lassen Sie mich mit Ihren Genen in Ruhe!", tobte der Doktor und empfahl: "Gehen Sie zu meiner Sprechstundenhilfe und lassen Sie sich zeigen, wie man sich richtig die Zähne putzt." Die Geschichte konnte so nur in Europa spielen, denn sie war ein Ausdruck des klassischen Alt-Europa vor dem Sieg des molekular-genetischen Paradigmas zumindest im medialen Spiegel der
Mehr anzeigen
Wissenschaftsberichterstattung.
Der Arzt ging davon aus, dass es einfacher sei, wenn man Krankheiten vermeiden will, ein paar Verhaltensänderungen vorzunehmen, als an den Genen herumzudoktern. Daraus spricht die alte europäische Unentschlossenheit gegenüber dem wirklich Neuen. Wahrscheinlich stand auch der Zahnarzt schon mal vor seinen Kindern und hat sich heimlich gefragt, woher die Kleinen das wohl haben, was sie gerade tun. Von ihrer Mutter? Von ihm oder dem Opa? Dann wird er den Gedanken aber wieder verworfen haben wegen ethischer Bedenken, der möglichen Funktion der Erziehung und so weiter.
Auf die Idee, dass schon sein Zaudern, sein Hin-und-Her-Schwanken zwischen genetischer und verhaltenstechnischer Diagnostik seine Ursache in einer genetischen Disposition haben könnte, wird der humanistisch-künstlerisch gebildete Arzt nicht kommen. Auf so eine Idee kommen nur Amerikaner oder Wissenschaftler, die unter dem Einfluss amerikanischer Wissenschaft tätig sind. In Europa hat es in der Nachfolge Charles Darwins alle möglichen Züchtungsphantasien gegeben, die im Rassenwahn der Nazis dann ihren grausam-tödlichen Höhepunkt fanden. Aber auch die Nazis mit ihren Gesichtsvermessungen und Nasenkatalogen blieben auf eine heute merkwürdig provinziell wirkende - das heißt: nicht universelle - Art an der Oberfläche haften. Den Kern der Vererbung haben sie nie auf eine universelle Weise extrem gedacht. Extrem wurde die tief unsichtbar verborgen, im Kern auf den Chromosomen sitzende Substanz der Substanzen, das Gen, nur in Amerika gedacht. Das ist der antirassistische neue Impuls, den die vor allem von Thomas Hunt Morgan in den zwanziger Jahren in einer fensterlosen Besenkammer voller kleiner Glasfläschchen, in denen Unsummen von Fruchtfliegenstämmen krabbelten, an der New Yorker Columbia-Universität entwickelte Genetik in die Welt senden wollte.
Morgan war damit in der Wissenschaft die Verlängerung des Traums der amerikanischen Revolution von der ursprünglichen Gleichheit aller Menschen unter Gottes Sonne. Und mit dem Gen glaubte Morgan, das Atom des Lebens gefunden zu haben, das zugleich die platonische Seele war, die alles Lebendige mit Kraft versah. Daraus entsprangen links wie rechts, unter Männern, Frauenrechtlerinnen und Arbeiterbildungsvereinen, die seltsamsten Phantasien, wenn nicht vom ewigen, so doch langen, gesunden Leben mit schönen Genen bei immer voll gedecktem Tisch durch genetisch verbesserte Nahrung.
Eugenik hieß das für die Menschen zuständige Programm, und die für die Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais und Korn zuständige Wissenschaft heißt heute grüne Gentechnologie. Dagegen kann man eigentlich nichts sagen, und doch geraten die Genetik und die aus ihr hervorgegangene Gentechnologie zunehmend in die Kritik. Zu Recht natürlich, denn auf ihre Art führen die neuesten Ergebnisse der Genetik jene am Ursprung der Wissenschaft überwunden geglaubten rassistischen, sexistischen und deterministischen Konstrukte immer unverhohlener wieder ein. Das hat natürlich Gründe. In Abwandlung eines Diktums von Adorno kann man festhalten: Biologismen, die die Wissenschaft bereits überholt hatte, kehren zurück, weil der Augenblick der gesellschaftlichen Verwirklichung der antirassistischen Disposition der Natur versäumt wurde.
Wie es dazu gekommen ist, davon erzählt Michael Crichton in seinem neuen Roman auf eine Weise, die nichts zu wünschen übriglässt, wenn man sie strukturell auf die das Gerüst der Geschichte und Gegenwart der Genetik und Biotechnologie betreffenden Passagen und Literaturhinweise verkürzt. Crichton beginnt bereits auf der ersten Seite mit einer Aufzählung der Teilnehmer eines Kongresses der Biotechnologie mit dem Titel "BioChange 2006" und dem programmatischen Slogan: "Die Zukunft beginnt jetzt". Anwesend sind: "Investoren, Human Resource Manager, die stets auf der Suche nach geeigneten Wissenschaftlern waren, Spezialisten für Technologietransfer, Vorstandsvorsitzende, Juristen mit dem Fachgebiet ,Geistiges Eigentum' und nahezu alle Biotechfirmen der USA." Es handelt sich bei der Biotechnologie also um ein Geschäft auf dem höchsten Niveau mit allen Ingredienzien, die man heute für ein Geschäft braucht. Wissenschaftler können dabei als die Produzenten der Ware sehr viel Geld verdienen. Dazu müssen sie aber Aufmerksamkeit erwecken, das Branding muss stimmen.
Wie man sich das vorstellen muss, beschreibt Crichton in einer Szene, in der ein Genetikerteam der Columbia-Universität im "verglasten Konferenzzimmer der Marketingagentur Watson & Naeme auf der Madison Avenue" nach einem Konzept für die Vermarktung ihres gerade entdeckten Gens sucht. Zuerst muss natürlich der Name des Gens stimmen. Also geht man die Möglichkeiten durch. "Wie wär's mit smartes Gen?", schlägt einer vor. Oder vielleicht: Schlichtheitsgen, Sozialisierungsgen, Klugheitsgen, Richtigdenkergen, Partygen, Spaßgen, Fotogen, Telegen, Glücksgen. Klingt alles nicht gut, meinen die Marketingspezialisten, und so einigt man sich schließlich auf "Geselligkeitsgen", da sei alles drin, was die Leute heute brauchen: nämlich einen Hinweis auf die Korrekturmöglichkeit aller Störungen ihres Sozialverhaltens.
Crichton heftet der Szene dann Ausschnitte aus den Pressereaktionen an. "Wissenschaftler entdecken Gen für Geselligkeit", liest man da. Wer sich je gefragt hat, wie die Zeitungsmeldungen zum Gen für Homosexualität, politische Haltung oder eben Geselligkeit zustande kommen, der braucht nur diese Seiten zu lesen. Es stimmt alles, nichts ist übertrieben. Nur ein paar Seiten später liefert Crichton dann den Einblick in die Laborpraxis. Eine Mathematikerin lebt da mit einem Graupapageien zusammen, dem das menschliche Gen für Rechnen eingebaut wurde, und der rechnet jetzt wie wild drauflos. Nimmt man noch die Literaturhinweise im Anhang hinzu, die mit Gilbert Keith Chestertons in den zwanziger Jahren geschriebenem Essay "Eugenics and Other Evils: An Argument against the Scientifically Organized Society" eine echte Trouvaille enthalten, dann weiß man, woran man ist im molekulargenetischen Paradigma der Gegenwart. Mehr geht zurzeit nicht.
CORD RIECHELMANN
Michael Crichton: "Next". Roman. Deutsch von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Karl-Blessing-Verlag, 544 Seiten, 22,95 Euro. Siehe auch Wissenschaft, Seiten 56 und 57.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der Arzt ging davon aus, dass es einfacher sei, wenn man Krankheiten vermeiden will, ein paar Verhaltensänderungen vorzunehmen, als an den Genen herumzudoktern. Daraus spricht die alte europäische Unentschlossenheit gegenüber dem wirklich Neuen. Wahrscheinlich stand auch der Zahnarzt schon mal vor seinen Kindern und hat sich heimlich gefragt, woher die Kleinen das wohl haben, was sie gerade tun. Von ihrer Mutter? Von ihm oder dem Opa? Dann wird er den Gedanken aber wieder verworfen haben wegen ethischer Bedenken, der möglichen Funktion der Erziehung und so weiter.
Auf die Idee, dass schon sein Zaudern, sein Hin-und-Her-Schwanken zwischen genetischer und verhaltenstechnischer Diagnostik seine Ursache in einer genetischen Disposition haben könnte, wird der humanistisch-künstlerisch gebildete Arzt nicht kommen. Auf so eine Idee kommen nur Amerikaner oder Wissenschaftler, die unter dem Einfluss amerikanischer Wissenschaft tätig sind. In Europa hat es in der Nachfolge Charles Darwins alle möglichen Züchtungsphantasien gegeben, die im Rassenwahn der Nazis dann ihren grausam-tödlichen Höhepunkt fanden. Aber auch die Nazis mit ihren Gesichtsvermessungen und Nasenkatalogen blieben auf eine heute merkwürdig provinziell wirkende - das heißt: nicht universelle - Art an der Oberfläche haften. Den Kern der Vererbung haben sie nie auf eine universelle Weise extrem gedacht. Extrem wurde die tief unsichtbar verborgen, im Kern auf den Chromosomen sitzende Substanz der Substanzen, das Gen, nur in Amerika gedacht. Das ist der antirassistische neue Impuls, den die vor allem von Thomas Hunt Morgan in den zwanziger Jahren in einer fensterlosen Besenkammer voller kleiner Glasfläschchen, in denen Unsummen von Fruchtfliegenstämmen krabbelten, an der New Yorker Columbia-Universität entwickelte Genetik in die Welt senden wollte.
Morgan war damit in der Wissenschaft die Verlängerung des Traums der amerikanischen Revolution von der ursprünglichen Gleichheit aller Menschen unter Gottes Sonne. Und mit dem Gen glaubte Morgan, das Atom des Lebens gefunden zu haben, das zugleich die platonische Seele war, die alles Lebendige mit Kraft versah. Daraus entsprangen links wie rechts, unter Männern, Frauenrechtlerinnen und Arbeiterbildungsvereinen, die seltsamsten Phantasien, wenn nicht vom ewigen, so doch langen, gesunden Leben mit schönen Genen bei immer voll gedecktem Tisch durch genetisch verbesserte Nahrung.
Eugenik hieß das für die Menschen zuständige Programm, und die für die Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais und Korn zuständige Wissenschaft heißt heute grüne Gentechnologie. Dagegen kann man eigentlich nichts sagen, und doch geraten die Genetik und die aus ihr hervorgegangene Gentechnologie zunehmend in die Kritik. Zu Recht natürlich, denn auf ihre Art führen die neuesten Ergebnisse der Genetik jene am Ursprung der Wissenschaft überwunden geglaubten rassistischen, sexistischen und deterministischen Konstrukte immer unverhohlener wieder ein. Das hat natürlich Gründe. In Abwandlung eines Diktums von Adorno kann man festhalten: Biologismen, die die Wissenschaft bereits überholt hatte, kehren zurück, weil der Augenblick der gesellschaftlichen Verwirklichung der antirassistischen Disposition der Natur versäumt wurde.
Wie es dazu gekommen ist, davon erzählt Michael Crichton in seinem neuen Roman auf eine Weise, die nichts zu wünschen übriglässt, wenn man sie strukturell auf die das Gerüst der Geschichte und Gegenwart der Genetik und Biotechnologie betreffenden Passagen und Literaturhinweise verkürzt. Crichton beginnt bereits auf der ersten Seite mit einer Aufzählung der Teilnehmer eines Kongresses der Biotechnologie mit dem Titel "BioChange 2006" und dem programmatischen Slogan: "Die Zukunft beginnt jetzt". Anwesend sind: "Investoren, Human Resource Manager, die stets auf der Suche nach geeigneten Wissenschaftlern waren, Spezialisten für Technologietransfer, Vorstandsvorsitzende, Juristen mit dem Fachgebiet ,Geistiges Eigentum' und nahezu alle Biotechfirmen der USA." Es handelt sich bei der Biotechnologie also um ein Geschäft auf dem höchsten Niveau mit allen Ingredienzien, die man heute für ein Geschäft braucht. Wissenschaftler können dabei als die Produzenten der Ware sehr viel Geld verdienen. Dazu müssen sie aber Aufmerksamkeit erwecken, das Branding muss stimmen.
Wie man sich das vorstellen muss, beschreibt Crichton in einer Szene, in der ein Genetikerteam der Columbia-Universität im "verglasten Konferenzzimmer der Marketingagentur Watson & Naeme auf der Madison Avenue" nach einem Konzept für die Vermarktung ihres gerade entdeckten Gens sucht. Zuerst muss natürlich der Name des Gens stimmen. Also geht man die Möglichkeiten durch. "Wie wär's mit smartes Gen?", schlägt einer vor. Oder vielleicht: Schlichtheitsgen, Sozialisierungsgen, Klugheitsgen, Richtigdenkergen, Partygen, Spaßgen, Fotogen, Telegen, Glücksgen. Klingt alles nicht gut, meinen die Marketingspezialisten, und so einigt man sich schließlich auf "Geselligkeitsgen", da sei alles drin, was die Leute heute brauchen: nämlich einen Hinweis auf die Korrekturmöglichkeit aller Störungen ihres Sozialverhaltens.
Crichton heftet der Szene dann Ausschnitte aus den Pressereaktionen an. "Wissenschaftler entdecken Gen für Geselligkeit", liest man da. Wer sich je gefragt hat, wie die Zeitungsmeldungen zum Gen für Homosexualität, politische Haltung oder eben Geselligkeit zustande kommen, der braucht nur diese Seiten zu lesen. Es stimmt alles, nichts ist übertrieben. Nur ein paar Seiten später liefert Crichton dann den Einblick in die Laborpraxis. Eine Mathematikerin lebt da mit einem Graupapageien zusammen, dem das menschliche Gen für Rechnen eingebaut wurde, und der rechnet jetzt wie wild drauflos. Nimmt man noch die Literaturhinweise im Anhang hinzu, die mit Gilbert Keith Chestertons in den zwanziger Jahren geschriebenem Essay "Eugenics and Other Evils: An Argument against the Scientifically Organized Society" eine echte Trouvaille enthalten, dann weiß man, woran man ist im molekulargenetischen Paradigma der Gegenwart. Mehr geht zurzeit nicht.
CORD RIECHELMANN
Michael Crichton: "Next". Roman. Deutsch von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Karl-Blessing-Verlag, 544 Seiten, 22,95 Euro. Siehe auch Wissenschaft, Seiten 56 und 57.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Gehören einem seine eigenen Gene noch selbst, wenn eine Uni die Zelllinie hat patentieren lassen? Dürfen Kopfgeldjäger einfach Gene beim Enkel zapfen, wenn der Träger der Gene nicht verfügbar? Diese und viele andere Fragen zur Patentierbarkeit von Genen und Genexperimenten …
Mehr
Gehören einem seine eigenen Gene noch selbst, wenn eine Uni die Zelllinie hat patentieren lassen? Dürfen Kopfgeldjäger einfach Gene beim Enkel zapfen, wenn der Träger der Gene nicht verfügbar? Diese und viele andere Fragen zur Patentierbarkeit von Genen und Genexperimenten wirft Crichton in seinem neuen Thriller auf. Sehr spannend und gut erzählt von Hannes Jaenicke, der beim Lesen amerikanischer Namen und Ausdrücke allerdings nicht gewollt so klingen sollte, als hätte er 5 Jahre in New York gelebt (oder hat er?)
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Nun habe ich Next auch gelesen, leider wird es für mich und andere Leser das letzte gewesen sein, den Michael Crichton erlag am 4. November 2008 im Alter von 66 Jahren in Los Angeles einem Krebsleiden.
Wieder hatte sich der Autor ein brisantes Thema geangelt, die Gentechnik. Und dieses Thema …
Mehr
Nun habe ich Next auch gelesen, leider wird es für mich und andere Leser das letzte gewesen sein, den Michael Crichton erlag am 4. November 2008 im Alter von 66 Jahren in Los Angeles einem Krebsleiden.
Wieder hatte sich der Autor ein brisantes Thema geangelt, die Gentechnik. Und dieses Thema wird auch noch sehr lange brisant bleiben.
Die Geschichte um Dave kommt aber erst im letzten Drittel zum Vorschein. Vorher ging es um Patienten, Forscher, Gerichtstermine und um Biotechfirmen. Auch ein Kopfgeldjäger versuchte sein Glück. Also sehr viele verschiedene Ebenen die sich am Ende des Buches zusammenfügten oder im Konsens dazu standen. Es war nicht einfach da mitzuhalten ohne sich Notizen zu machen. Auch die ganzen Namen der Protagonisten waren nicht einfach zu Händeln. Es gab Abschnitte da fragte ich mich wer ist jetzt eigentlich der Gute und wer der Böse. Unterschwelliges Thema hätte auch Geldscheffeln heißen können.
Wegen diesen vielen Ebenen ist die Vorstellung der Protagonisten auch eher Nebensache. Eine Entwicklung findet in diesem Sinne auch nicht statt, da alles in einer relativ kurzen Zeit geschieht.
Bei einigen Szenen mit einem bestimmten Vogel musste ich aus vollem Herzen lachen, da ich mir diese Szenen bildlich vorgestellt habe.
Es werden sehr viele Lateinische oder Medizinische Ausdrücke verwendet die den Lesefluss doch ziemlich beeinflussen.
Aber denn noch ein Buch welches uns aufzeigt was alles mit der Gentechnik möglich ist oder möglich sein könnte. Für mich sehr interessant zu lesen. Im Nachwort geht Michael Crichton noch darauf ein was an Gesetzesänderungen von Nöten wäre um die Person Mensch wirklich gegen Raubbau mit seinen Zellen zu schützen
Dieses Buch bekommt von mir 2 von 5 Sternen.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Michael Crichton regt mit diesem Buch zum Nachdenken an. Was passiert wirklich mit Zellen, Gewebeproben und Blutentnahmen, nachdem es im Labor ausgewertet wurde? Frank Burnets Zellen sind 3 Millionen Dollar wert und er kann nichts dagegen machen, dass man seine Zellen weiterverkauft und die …
Mehr
Michael Crichton regt mit diesem Buch zum Nachdenken an. Was passiert wirklich mit Zellen, Gewebeproben und Blutentnahmen, nachdem es im Labor ausgewertet wurde? Frank Burnets Zellen sind 3 Millionen Dollar wert und er kann nichts dagegen machen, dass man seine Zellen weiterverkauft und die Pharmakonzerne damit das große Geld machen - und gerät in Gefahr: seine Zellen sind beliebt.
Das Buch hat mir eine schlaflose Nacht bereitet. Es ist überaus spannend und interessant geschrieben und enthält viele - teils erschreckende - Details, die einen aufrütteln sollen. Wer nicht schon vorher darüber nachgedacht hat, ob die Genforschung wirklich so sinnvoll und gut ist, der wird spätestens nach dem Lsen dieses Buches intensiv darüber nachdenken.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Ein Musterbeispiel für die Korruption eines eigentlich ganz passablen deutschen Schauspielers durch Hollywood: Hannes Jaenickes Lesung dieses möglicherweise interessanten? Buches ist mit seiner Nuschelei und seiner anbiedernden, widerlichen Aussprache US-amerikanischer Namen nicht zu …
Mehr
Ein Musterbeispiel für die Korruption eines eigentlich ganz passablen deutschen Schauspielers durch Hollywood: Hannes Jaenickes Lesung dieses möglicherweise interessanten? Buches ist mit seiner Nuschelei und seiner anbiedernden, widerlichen Aussprache US-amerikanischer Namen nicht zu ertragen. Ein kompetenter Toningenieur hätte hier vielleicht manches verbessern können.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
3 Milliarden Dollar sind Frank Burnets Zellen wert. 3 Milliarden, von denen kein einziger Cent in seine Tasche fließen wird. Denn Burnet, gerade vom Knochenmarkkrebs geheilt, ist auf hinterhältige Weise von der Universitätsklinik in Los Angeles betrogen worden. Die Forscher …
Mehr
3 Milliarden Dollar sind Frank Burnets Zellen wert. 3 Milliarden, von denen kein einziger Cent in seine Tasche fließen wird. Denn Burnet, gerade vom Knochenmarkkrebs geheilt, ist auf hinterhältige Weise von der Universitätsklinik in Los Angeles betrogen worden. Die Forscher entwickelten aus seinen Immunzellen eine Zelllinie, die zum Sieg über den Krebs beiträgt. Für viel Geld verkaufte die University of California die Rechte an dieser Zelllinie an BioGen Research Inc., ohne Frank Burnets Einverständnis einzuholen. Wütend zieht er nun gegen das Unternehmen vor Gericht – erhält aber nicht Recht.
Eines Tages sind plötzlich alle Burnet-Zelllinien im Labor der BioGen kontaminiert. Damit steht die Firma vor dem finanziellen Ruin. Steckt Frank Burnet hinter diesem Anschlag? Oder versucht ein skrupelloser Konkurrent das Unternehmen vom Biotech-Spielfeld zu verdrängen? Nur eine einzige Chance hat der Geschäftsführer Rick Diehl, um die BioGen vor dem Konkurs zu bewahren: Er muss Burnet noch einmal Gewebe entnehmen, doch da befindet der sich schon auf der Flucht …<br />ein sehr spannendes buch das mir super gut gefallen hat.ich empfehle es weiter, an jeden der gerne thriller liest.es besteht eine paralle zu dem film fleisch.aber trotzdem ist das buch sehr gut und äußerst weiterzuempfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Dieses Buch kommt nicht an die Klasse von "Beute" oder "Welt in Angst" heran.
Die Handlung führt sehr viele Charaktere ein, von denen nur einige wenige den roten Faden bilden. Die Handlungsszenen scheinen aneinander gereiht. Eine rechte Spannung will nicht aufkommen.
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Das wohl mit Abstand schlechteste Buch von Michael Crichton.
Absolut enttäuschend und unfertg.
M. Crichton hat so viele gute Bücher geschrieben das man kaum glauben mag das Next aus seiner Feder stammt.
Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich