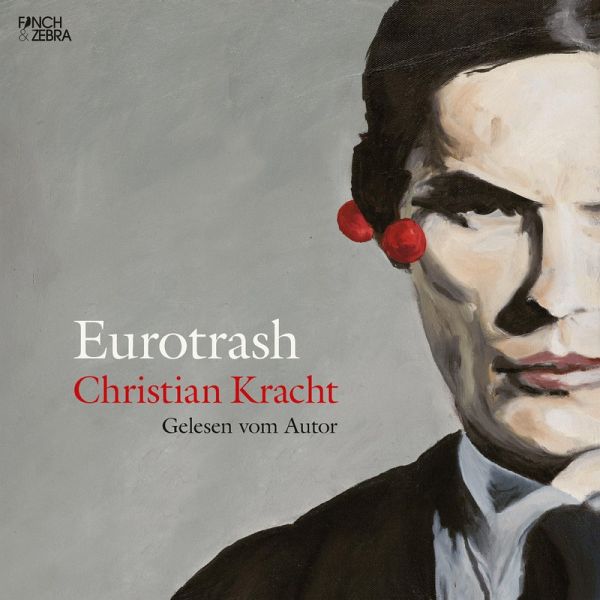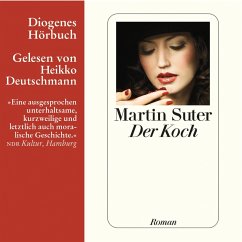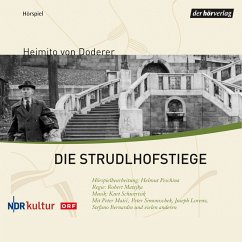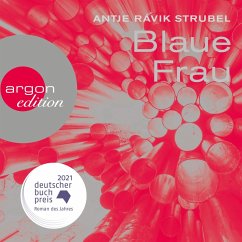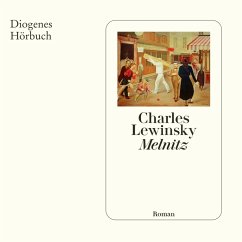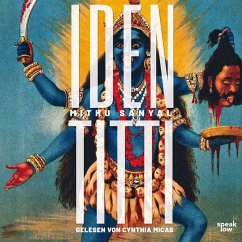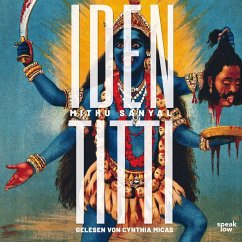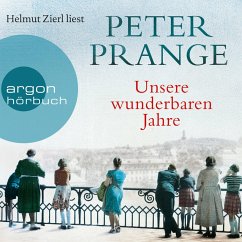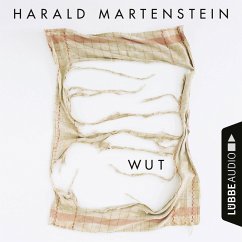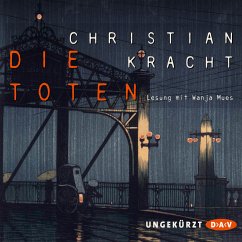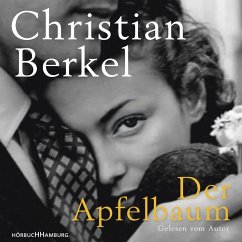Christian Kracht
Hörbuch-Download MP3
Eurotrash (MP3-Download)
Ungekürzte Lesung. 272 Min.
Sprecher: Kracht, Christian

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!





"I'll see you in twenty-five years." Laura Palmer. "Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, 'Faserland' genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen auf dem Zürichsee, relativ traumatisch." Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer ...
"I'll see you in twenty-five years." Laura Palmer. "Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, 'Faserland' genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen auf dem Zürichsee, relativ traumatisch." Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in "Faserland" ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In "Eurotrash" geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise - diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt. "Eurotrash" ist ein berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und sarkastischem Humor.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.
Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane 'Faserland', '1979', 'Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten', 'Imperium', 'Die Toten' und 'Eurotrash' sind in über 30 Sprachen übersetzt.

Produktdetails
- Verlag: Finch&Zebra
- Gesamtlaufzeit: 272 Min.
- Erscheinungstermin: 23. September 2021
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 4066004330822
- Artikelnr.: 62587448
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.03.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.03.2021Falsche Fische
Die grotesken Filmszenen der Erinnerung: In seinem Roman "Eurotrash" betrachtet Christian Kracht die eigene Familiengeschichte in einem Zerrspiegel. So entsteht eine Parodie auf die Mode des autobiographischen Schreibens, die uns fragt: In welcher Fiktion wollen wir leben?
Von Jan Wiele
Kann man noch deutlicher machen, dass etwas eine Parodie ist? In seiner Frankfurter Poetikvorlesung von 2018 sagte Christian Kracht: "Alles, was sich selbst zu ernst nimmt, ist reif für die Parodie." Er meinte nicht zuletzt die Vorlesungsreihe, in der er sprach. Und schon damals entstand der Eindruck, Kracht parodiere die Textgattung, in der er sich äußert, indem er seine eigene Lebensgeschichte in grotesk
Die grotesken Filmszenen der Erinnerung: In seinem Roman "Eurotrash" betrachtet Christian Kracht die eigene Familiengeschichte in einem Zerrspiegel. So entsteht eine Parodie auf die Mode des autobiographischen Schreibens, die uns fragt: In welcher Fiktion wollen wir leben?
Von Jan Wiele
Kann man noch deutlicher machen, dass etwas eine Parodie ist? In seiner Frankfurter Poetikvorlesung von 2018 sagte Christian Kracht: "Alles, was sich selbst zu ernst nimmt, ist reif für die Parodie." Er meinte nicht zuletzt die Vorlesungsreihe, in der er sprach. Und schon damals entstand der Eindruck, Kracht parodiere die Textgattung, in der er sich äußert, indem er seine eigene Lebensgeschichte in grotesk
Mehr anzeigen
überzeichneten Episoden erzählte und nach Schilderung einer Missbrauchserfahrung aus seiner Jugend sein ganzes literarisches Werk im Lichte dieser Erfahrung mit der Methode des Biographismus selbst auslegte. Er nannte dann explizit die Parodie eine "Heilung für den Missbrauch".
Nun erscheint Krachts neuer Roman. Er heißt "Eurotrash". Der Begriff bezeichnet oft eine triviale, obszöne Form der Popmusik - der Künstler Friedrich Liechtenstein sprach etwa gegenüber dieser Zeitung einmal von "Eurotrash der Skihütten". Aber laut dem für das Verständnis gegenwärtiger Kultur oft hilfreichen Online-Medium "Urban Dictionary" kann "Eurotrash" auch Menschen meinen, die sich durch zur Schau getragenen Wohlstand und gleichzeitig durch inszenierte Verlotterung, durch Modesucht in schmerzhaft empfundenem Ironiebewusstsein und durch Weltmüdigkeit auszeichnen.
Worauf also zielt die Parodie des Romans "Eurotrash"? Zum einen auf den konsumistischen, oberflächlichen Lebensstil, mit dem Kracht seit seinem Debüt "Faserland" (1995) wie kein anderer Gegenwartsautor in Verbindung gebracht wurde, weil er diesen Lebensstil darin vermeintlich affirmativ beschrieben hatte. Das war eine Fehlrezeption, allerdings eine äußerst produktive: Sie hängt der deutschsprachigen Popliteratur als Stigma bis heute an, teils auch nicht zu Unrecht. Im neuen Roman, der als Fortsetzung von "Faserland" beworben wird, malt Kracht in einer an Thomas Bernhard gemahnenden Spottlust die Schweiz als Hort des Eurotrashs aus. Und setzt sich mit der Frage auseinander, ob er und seine Familie vielleicht selbst "Eurotrash" sind.
Wenn man aber man den Titel auch als ironische Selbstdenunziation des Romans versteht, zielt die Parodie sogar auf dessen eigene Form: Seine zur Schau gestellte Mode wäre dann die des autobiographischen Erzählens, das seit ein paar Jahren nun zu einem regelrechten Kult vermeintlich authentischer Memoir-Literatur geführt hat. Ebenden hatte Kracht in seiner Vorlesung parodiert, und der Roman ist die konsequente Fortsetzung auch davon.
Sein Erzähler heißt Christian Kracht, und vieles dürfte damaligen Zuhörern der Vorlesung bekannt vorkommen: das Aufwachsen in kaltem Wohlstand, maximal entfremdet von den desinteressierten Eltern, die Hassliebe zur Schweizer Heimat, das angebliche Anzünden der Schule im Alter von sieben Jahren, der Vater, ein Manager im Verlag Axel Springers, als Parvenu im internationalen Jetset, der Expressionisten-Originalbilder unter dem Bett hortet, die nationalsozialistische Vergangenheit der Großeltern, ein kurioser Onkel. Neu allerdings ist nun die Geschichte der Mutter: Sie wird zum Zentrum des Romans, löst seine Handlung aus, indem sie den in Amerika lebenden Sohn zum Besuch in die Schweiz bittet, von dem man ahnt, es könnte der letzte sein. Diese Mutter ist es, die diesmal für die qualvolle Nabelschau sorgt, wenn erzählt wird, dass auch sie im Alter von elf Jahren missbraucht worden sei und doch nicht verhindern konnte, dass ihrem Sohn später das Gleiche geschah. "Der Zerfall dieser Familie, ja, die Atomisierung dieser Familie, als deren Tiefpunkt man den achtzigsten Geburtstag meiner Mutter im Gemeinschaftszimmer der Nervenklinik Winterthur bezeichnen muss, war von einer bodenlosen Hoffnungslosigkeit", heißt es zu Beginn. Die Mutter wird beschrieben als stark trinkendes, tablettenabhängiges Wrack. Die Wiederbegegnung mit dem Sohn ist denkbar schmerzhaft für beide, und doch haben beide sie bitter nötig.
Beide haben sich nämlich mit traumatischer Vergangenheit auseinanderzusetzen, wenn man so will, Trauerarbeit zu leisten. Der Erzähler gibt ohnehin zu, er lebe seit Jahrzehnten nur in der "ewig präsenten" Vergangenheit. Und gibt dann noch einen bedeutsamen Hinweis: "Ich lebte in Filmen."
Damit ist etwas Entscheidendes über die Erzählstruktur von Kracht-Romanen gesagt: Denn oft werden darin, ausgehend von einem Stichwort, Szenen filmisch ausfabuliert - Stilprinzip auch seines Kino-Romans "Die Toten" (2016). Unmittelbar nach dem Filmhinweis folgt hier eine vorgestellte Erinnerung aus der Kriegskindheit der Mutter, in der Deserteure an Laternenpfählen aufgeknüpft sind, Körperteile aus zerbombtem Häusern hängen. Dann folgt eine Betrachtung über den Vater, der aus Angst vor seiner Provinzialität zum Snob zu werden versucht - und schwups, sehen wir ihn in Londoner
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Klubs zwischen Roastbeefwagen und weißen Schürzen, wie er verzweifelt versucht mitzuhalten. Es klappt leider nicht, vielleicht weil der Vater, wie es noch später heißt, als "sonderbarer kleiner Mann dem Schauspieler Louis de Funès sehr geähnelt hatte"? Auch die Erinnerung des Erzählers an seine eigene Kindheit ist filmgesteuert: "Meine Träume sahen ungefähr so aus wie die Schlußszene in der Dürrenmatt-Verfilmung Es geschah am hellichten Tag", sagt er einmal: Stoff für Albträume.
Sein Hass-Bild der Schweiz wiederum scheint grundiert von Filmen des antikapitalistischen Revolutionärs Guy Debord, dessen Kritik an der "Gesellschaft des Spektakels" (1967) hier nicht nur gegen den Konsumismus der Eidgenossen, sondern auch gegen den der falsch verstandenen Popliteratur in Stellung gebracht wird: Die Barbourjacke aus "Faserland" weicht einem kratzigen Öko-Pullover.
Und doch besteht die Pointe des Romans "Eurotrash" darin, sich den vorgestanzten Film-Träumen nicht willenlos zu unterwerfen, sondern sie selbst zu gestalten: als Tagträume. Der sagenhafte Roadtrip, auf den sich der Erzähler darin mit seiner von Krankheit gezeichneten Mutter begibt, ist so eine Flucht in die Tagtraum-Realität.
Das dämmert dem Leser, wenn die Mutter den Sohn ständig bittet, Geschichten zu erzählen, und der bereitwillig losfabuliert. Aber immer deutlicher wird dann, dass auch die innerhalb der Romanfiktion als wahr ausgegebene Erzählung einer Taxifahrt kreuz und quer durch die Schweiz, bei der Mutter und Sohn mit Tausendfrankenscheinen aus Plastiktüten um sich werfen, bei Öko-Nazis übernachten, Borges' Grab besuchen, erst nach München und dann nach Afrika zu fliegen beschließen und doch am Ende wieder auf einem Klinikparkplatz landen, selbst eine solche Tagtraum-Fiktion sein könnte.
Die Schlüsselszene eines Fischessens wirkt wie ein poetologisches Emblem dieser Erkenntnis: "Im milchiggekochten Auge der Forelle", die vor den Protagonisten als "straff zusammengezogene hellblaue Leiche" unappetitlich auf dem Teller liegt, "spiegelte sich nichts", heißt es, und dann: "Was hätte sich auch spiegeln sollen?" Daraus erhellt nicht nur, dass die Figuren, die da am Tisch sitzen, gar nicht wirklich da sind. Sondern auch, da das lang herbeigesehnte Forellenmahl eine so drastische Enttäuschung ist: dass die falschen Fische der Fiktion eben oft schöner sind als die Wirklichkeit. Die Drastik dieser Wirklichkeit zu mildern durch steile Geschichten: das ist das Prinzip Christian Krachts, das er den aufrichtigen Memoir-Schreibern trotzig entgegenschleudert. Manchmal sogar mit Humor, wenn die Mutter etwa sagt, die Schweiz sei ja auch nur eine Erfindung der Engländer.
Das Ende des Romans schildert berührend die Übereinkunft von Mutter und Sohn, die Tagtraum-Welt gar nicht mehr zu verlassen. Und so landen beide am Ziel einer Reise, die sie nie angetreten haben: Heilung durch Fiktion.
Christian Kracht: "Eurotrash". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 210 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Nun erscheint Krachts neuer Roman. Er heißt "Eurotrash". Der Begriff bezeichnet oft eine triviale, obszöne Form der Popmusik - der Künstler Friedrich Liechtenstein sprach etwa gegenüber dieser Zeitung einmal von "Eurotrash der Skihütten". Aber laut dem für das Verständnis gegenwärtiger Kultur oft hilfreichen Online-Medium "Urban Dictionary" kann "Eurotrash" auch Menschen meinen, die sich durch zur Schau getragenen Wohlstand und gleichzeitig durch inszenierte Verlotterung, durch Modesucht in schmerzhaft empfundenem Ironiebewusstsein und durch Weltmüdigkeit auszeichnen.
Worauf also zielt die Parodie des Romans "Eurotrash"? Zum einen auf den konsumistischen, oberflächlichen Lebensstil, mit dem Kracht seit seinem Debüt "Faserland" (1995) wie kein anderer Gegenwartsautor in Verbindung gebracht wurde, weil er diesen Lebensstil darin vermeintlich affirmativ beschrieben hatte. Das war eine Fehlrezeption, allerdings eine äußerst produktive: Sie hängt der deutschsprachigen Popliteratur als Stigma bis heute an, teils auch nicht zu Unrecht. Im neuen Roman, der als Fortsetzung von "Faserland" beworben wird, malt Kracht in einer an Thomas Bernhard gemahnenden Spottlust die Schweiz als Hort des Eurotrashs aus. Und setzt sich mit der Frage auseinander, ob er und seine Familie vielleicht selbst "Eurotrash" sind.
Wenn man aber man den Titel auch als ironische Selbstdenunziation des Romans versteht, zielt die Parodie sogar auf dessen eigene Form: Seine zur Schau gestellte Mode wäre dann die des autobiographischen Erzählens, das seit ein paar Jahren nun zu einem regelrechten Kult vermeintlich authentischer Memoir-Literatur geführt hat. Ebenden hatte Kracht in seiner Vorlesung parodiert, und der Roman ist die konsequente Fortsetzung auch davon.
Sein Erzähler heißt Christian Kracht, und vieles dürfte damaligen Zuhörern der Vorlesung bekannt vorkommen: das Aufwachsen in kaltem Wohlstand, maximal entfremdet von den desinteressierten Eltern, die Hassliebe zur Schweizer Heimat, das angebliche Anzünden der Schule im Alter von sieben Jahren, der Vater, ein Manager im Verlag Axel Springers, als Parvenu im internationalen Jetset, der Expressionisten-Originalbilder unter dem Bett hortet, die nationalsozialistische Vergangenheit der Großeltern, ein kurioser Onkel. Neu allerdings ist nun die Geschichte der Mutter: Sie wird zum Zentrum des Romans, löst seine Handlung aus, indem sie den in Amerika lebenden Sohn zum Besuch in die Schweiz bittet, von dem man ahnt, es könnte der letzte sein. Diese Mutter ist es, die diesmal für die qualvolle Nabelschau sorgt, wenn erzählt wird, dass auch sie im Alter von elf Jahren missbraucht worden sei und doch nicht verhindern konnte, dass ihrem Sohn später das Gleiche geschah. "Der Zerfall dieser Familie, ja, die Atomisierung dieser Familie, als deren Tiefpunkt man den achtzigsten Geburtstag meiner Mutter im Gemeinschaftszimmer der Nervenklinik Winterthur bezeichnen muss, war von einer bodenlosen Hoffnungslosigkeit", heißt es zu Beginn. Die Mutter wird beschrieben als stark trinkendes, tablettenabhängiges Wrack. Die Wiederbegegnung mit dem Sohn ist denkbar schmerzhaft für beide, und doch haben beide sie bitter nötig.
Beide haben sich nämlich mit traumatischer Vergangenheit auseinanderzusetzen, wenn man so will, Trauerarbeit zu leisten. Der Erzähler gibt ohnehin zu, er lebe seit Jahrzehnten nur in der "ewig präsenten" Vergangenheit. Und gibt dann noch einen bedeutsamen Hinweis: "Ich lebte in Filmen."
Damit ist etwas Entscheidendes über die Erzählstruktur von Kracht-Romanen gesagt: Denn oft werden darin, ausgehend von einem Stichwort, Szenen filmisch ausfabuliert - Stilprinzip auch seines Kino-Romans "Die Toten" (2016). Unmittelbar nach dem Filmhinweis folgt hier eine vorgestellte Erinnerung aus der Kriegskindheit der Mutter, in der Deserteure an Laternenpfählen aufgeknüpft sind, Körperteile aus zerbombtem Häusern hängen. Dann folgt eine Betrachtung über den Vater, der aus Angst vor seiner Provinzialität zum Snob zu werden versucht - und schwups, sehen wir ihn in Londoner
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Klubs zwischen Roastbeefwagen und weißen Schürzen, wie er verzweifelt versucht mitzuhalten. Es klappt leider nicht, vielleicht weil der Vater, wie es noch später heißt, als "sonderbarer kleiner Mann dem Schauspieler Louis de Funès sehr geähnelt hatte"? Auch die Erinnerung des Erzählers an seine eigene Kindheit ist filmgesteuert: "Meine Träume sahen ungefähr so aus wie die Schlußszene in der Dürrenmatt-Verfilmung Es geschah am hellichten Tag", sagt er einmal: Stoff für Albträume.
Sein Hass-Bild der Schweiz wiederum scheint grundiert von Filmen des antikapitalistischen Revolutionärs Guy Debord, dessen Kritik an der "Gesellschaft des Spektakels" (1967) hier nicht nur gegen den Konsumismus der Eidgenossen, sondern auch gegen den der falsch verstandenen Popliteratur in Stellung gebracht wird: Die Barbourjacke aus "Faserland" weicht einem kratzigen Öko-Pullover.
Und doch besteht die Pointe des Romans "Eurotrash" darin, sich den vorgestanzten Film-Träumen nicht willenlos zu unterwerfen, sondern sie selbst zu gestalten: als Tagträume. Der sagenhafte Roadtrip, auf den sich der Erzähler darin mit seiner von Krankheit gezeichneten Mutter begibt, ist so eine Flucht in die Tagtraum-Realität.
Das dämmert dem Leser, wenn die Mutter den Sohn ständig bittet, Geschichten zu erzählen, und der bereitwillig losfabuliert. Aber immer deutlicher wird dann, dass auch die innerhalb der Romanfiktion als wahr ausgegebene Erzählung einer Taxifahrt kreuz und quer durch die Schweiz, bei der Mutter und Sohn mit Tausendfrankenscheinen aus Plastiktüten um sich werfen, bei Öko-Nazis übernachten, Borges' Grab besuchen, erst nach München und dann nach Afrika zu fliegen beschließen und doch am Ende wieder auf einem Klinikparkplatz landen, selbst eine solche Tagtraum-Fiktion sein könnte.
Die Schlüsselszene eines Fischessens wirkt wie ein poetologisches Emblem dieser Erkenntnis: "Im milchiggekochten Auge der Forelle", die vor den Protagonisten als "straff zusammengezogene hellblaue Leiche" unappetitlich auf dem Teller liegt, "spiegelte sich nichts", heißt es, und dann: "Was hätte sich auch spiegeln sollen?" Daraus erhellt nicht nur, dass die Figuren, die da am Tisch sitzen, gar nicht wirklich da sind. Sondern auch, da das lang herbeigesehnte Forellenmahl eine so drastische Enttäuschung ist: dass die falschen Fische der Fiktion eben oft schöner sind als die Wirklichkeit. Die Drastik dieser Wirklichkeit zu mildern durch steile Geschichten: das ist das Prinzip Christian Krachts, das er den aufrichtigen Memoir-Schreibern trotzig entgegenschleudert. Manchmal sogar mit Humor, wenn die Mutter etwa sagt, die Schweiz sei ja auch nur eine Erfindung der Engländer.
Das Ende des Romans schildert berührend die Übereinkunft von Mutter und Sohn, die Tagtraum-Welt gar nicht mehr zu verlassen. Und so landen beide am Ziel einer Reise, die sie nie angetreten haben: Heilung durch Fiktion.
Christian Kracht: "Eurotrash". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 210 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Jan Wiele zieht den Hut vor Christian Krachts etwas anderer Memoiren-Kunst. Wie der Autor und sein Erzähler diesmal antreten, die dunklen Ecken ihrer Familiengeschichte mit Fiktion zu überkleistern, findet Wiele schon lesenswert. Parodistisch, mit der Spottlust eines Thomas Bernhard geht das laut Wiele vor sich. Wiele folgt dem Erzähler und dessen Mutter durch eine Pappmaché-Schweiz, die der Roman filmisch und (alp-)träumerisch ausstaffiert. Das ist manchmal sogar witzig, findet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Krachts 'Dichtung und Wahrheit' (...) wird zu einem großen, heiteren Abenteuerroman, bestimmt dem herzlichsten, den es von Kracht bislang zu lesen gab.« Felix Stephan Süddeutsche Zeitung 20210304
Gebundenes Buch
Kracht lässt es wieder krachen
Mit seinem neuen Roman «Eurotrash» hat Christian Kracht eine Fortsetzung seines Debüts «‹Faserland» von 1995 vorgelegt. Darin setzt sich der umstrittene Schweizer Schriftsteller als Ich-Erzähler autofiktional mit der …
Mehr
Kracht lässt es wieder krachen
Mit seinem neuen Roman «Eurotrash» hat Christian Kracht eine Fortsetzung seines Debüts «‹Faserland» von 1995 vorgelegt. Darin setzt sich der umstrittene Schweizer Schriftsteller als Ich-Erzähler autofiktional mit der eigenen Familien-Geschichte auseinander. Als Plot dient ihm ein Besuch bei seiner hochbetagten, zeitweise dementen und alkoholkranken Mutter in Zürich, dem sich dann eine gemeinsam unternommene, spontane Reise durch die Schweiz anschließt. «Ich begreife meine Werke humoristisch» hat er mal erklärt, und so ist wohl auch dieser sechste Roman mit dem abfälligen Titel alles andere als ernst zu nehmen.
Die Hauptfigur ist die Mutter jenes Christian Kracht, der «vor einem Vierteljahrhundert» als seinen ersten Roman «Faserland» geschrieben hatte und gar nicht mehr weiß, warum der so heißt. So selbstbezüglich geht es hier zu, der Autor ist ein Meister der Selbstinszenierung. In dieser grotesken Roadnovel finden sich viele literarische Ingredienzien wieder, die man als typisch für ihn kennt. «Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich» lautet der erste Satz, auch hier wieder das anbiedernde Füllwort ‹Also› wie schon im Debüt, das den Leser ganz unmittelbar ansprechen soll. Weitere Motive sind das reichlich vorhandene und mit vollen Händen hinausgeworfene Geld, ferner Medikamenten-Missbrauch und Alkohol im großen Stil. Typisch, wenn auch weniger aufdringlich als im Debüt sind die immer wieder genannten Nobelmarken der Upperclass, zu der dieser hedonistische Ich-Erzähler sich zählt. Was man wohlwollend als Kapitalismus-Kritik auslegen kann, aber auch als Kennzeichen einer latenten Wohlstands-Verwahrlosung. In dieses Spiel mit dem Überfluss sind auch all die Luxus-Behausungen der Familie in Gstaad, Kampen auf Sylt, Cap Ferrat oder Myfair mit einbezogen, in denen der schnöselige Ich-Erzähler zu Hause war, alle mit wertvoller Kunst ausstaffiert. Und man verkehrte auch mit der Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Als Leser tut man gut daran, all das nicht ernst zu nehmen, dem Autor nicht auf den Leim zu gehen in diesem virtuosen Verwirrspiel zwischen Fakten und Fiktionen, das sich hinter dem Label ‹Roman› versteckt.
Mit dem Taxi starten Mutter und Sohn nach einen Besuch bei ihrer Bank zu ihrem Roadtrip, bei sich haben sie 600.000 Franken in einer prall gefüllten Plastiktüte, das Bargeld soll großzügig unter die Leute gebracht werden. Mit gegenseitigen Vorwürfen bieten die Beiden in ihren Gesprächen ein erschreckendes Bild ihres konfliktreichen Verhältnisses, er würde sie sträflich vernachlässigen, lautet der Vorwurf der Mutter. Den Sohn hingegen beschäftigt die Nazi-Vergangenheit des Großvaters, der auf Sylt Treffen der ehemaligen SS-Kameraden organisiert hat. Es sind funkelnde Dialoge, die da im Taxi oder Hotel geführt werden, wobei die erstaunliche Schlagfertigkeit und scheinbare Bildung der nur ‹Bunte› lesenden Mutter zu kuriosen Situationen führt, in denen sie den Sohn verblüfft und die oft einer Posse gleichen. Ihn aber kotzt alles an, er stört sich an der Verlogenheit bei seinem Blick in menschliche Abgründe.
«Christian Kracht ist ein ganz schlauer Bursche», wird Peter Handke zitiert, was zweifellos stimmt, Kracht lässt es wieder krachen! Allerdings war das doch wohl eher abwertend gemeint in jenem Zitat, mit dem auf dem Umschlag geworben wird. Was ein ausgewiesener Medienprofi dann, wie man sieht, mühelos ins Gegenteil drehen kann. Seine mit intertextuellen Bezügen gespickte, intellektuell anspruchsvolle Geschichte erweist sich im Endeffekt als ein selbstbezogenes Spiel um die eigene Person. Vieles dabei ist reine Pose, eine Attitüde, die auch auf den sprachlichen Stil zutrifft, der mit Attributen überladen eher altväterlich wirkt. Und wo führt das nun hin? Das Ende lässt alles offen, was noch unterstrichen wird durch sage und schreibe 14 leere Seiten am Ende, die bei der Seitenzahl aber ungeniert mitgezählt sind! Ist diese Leere in Wahrheit der Schluss?
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
Christian Kracht ist Schweizer mit deutschen Wurzeln. Er sieht sich selbst als Kosmopolit. Nach eigener Aussage begreift er seine Romane eher „humoristisch“, löst mit seinem Werk und Leben allerdings häufig heftige Kontroversen aus. Ein Mensch und Autor, der nicht einzuordnen …
Mehr
Christian Kracht ist Schweizer mit deutschen Wurzeln. Er sieht sich selbst als Kosmopolit. Nach eigener Aussage begreift er seine Romane eher „humoristisch“, löst mit seinem Werk und Leben allerdings häufig heftige Kontroversen aus. Ein Mensch und Autor, der nicht einzuordnen ist, und der in Eurotrash offensichtlich immer noch nach seinem eigenen Platz und Stellenwert in einem Leben sucht, dessen materielle Rahmenbedingungen andere bei einem flüchtigen Blick neidvoll als beste Vorraussetzungen für unbeschwertes Glück ansehen würden.
Eigentlich besteht Eurotrash aus zwei stilistisch sehr unterschiedlichen Teilen. Einem ersten Teil, in dem der Autor sinnierend in einem Hotelzimmer in Zürich liegt und kurz vor dem Treffen mit seiner Mutter die familiäre Vergangenheit autobiographisch Revue passieren lässt. In diesen Passagen, die ohne Zweifel ein ungeschöntes Stück Vergangenheitsbewältigung sind, hat Christian Kracht seine literarischen Höhepunkte. Bewegende Gedanken, tiefe Einblicke, gut ausformulierte, emotionale Textpassagen, flüssiger Erzählstil mit nur sparsam eingestreuten Dialogen.
Und zu verarbeiten gibt es mehr als genug.
Ihm selbst blieb es immer unklar, wie er sich aus der „Misere und den Geisteskrankenheiten“ dieser „zutiefst gestörten Familie“ heraus halbwegs normal entwickeln konnte. Diese Entwicklung scheint nicht abgeschlossen, denn die Vergangenheit ist für ihn auch heute noch „realer und präsenter als das Jetzt“.
Er gibt Einblicke in die Nazi-Vergangenheit der Familie, unter anderem am Beispiel des Großvaters mütterlicherseits, der es bis in die Reichspropaganda-Leitung in Berlin geschafft hatte und nach der Entnazifizierung wie so viele sowohl an seinen materiellen Gütern wie an seinem mentalen Gedankengut unbeirrt festhielt. Oder der Patenonkel, der viele Jahre versteckt hinter einem unbezahlbaren Gobelin eine sadomasochistische Folterkammer betrieb.
In die Historie eingewoben ist immer auch der polarisierende und provozierende Kracht, der mit diesem Buch keine Bewerbung für den diplomatischen Dienst abgibt: „Zürich, diese Stadt der Angeber und der Aufschneider und der Erniedrigung“. Oder Deutschland, „wo das Blut der ermordeten Juden immer noch in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren“.
Er beschreibt den Aufstieg seines Vaters vom Volontär bei Axel Springer zum Generalbevollmächtigten des Verlagsmagnaten, wodurch dieser es schliesslich selbst zu einem millionenschweren Vermögen bringt.
Gerade in diesem Zusammenhang strauchelt der Leser. Da beschreibt Kracht einerseits die familiäre Anhäufung von immensen Reichtümern mit illustren Immobilien in Gstaad („das einmal Aga Khan gehört hatte“), in Cap Ferrat, in London, auf Sylt, am Genfer See, die Sammlung deutscher Expressionisten und alle anderen Insignien des väterlichen Erfolgs. Imposant zu lesen und fast so beeindruckend wie die Exklusiv-Veröffentlichung der Illustrierten Bunte über die Reichen und Schönen dieser Welt. Jedoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Kracht kokettiert. Oder lamentiert er wirklich glaubhaft, wenn er von „totem Geld“ spricht, durchdrungen von Angeberei und Übertreibung seines feudalistischen Vaters, zu dem er nie eine emotionale Bindung aufbauen konnte. Wieviel von allem war lange Zeit Grundlage seines sehr freien Lebensstils und wieviel ist wirklich Last?
Im wesentlich längeren zweiten Teil reist Kracht mit seiner alkohol- und medikamentenabhängigen Mutter kreuz und quer durch die Schweiz. Hier wechselt Kracht zu einem völlig anderen Stil mit einem dominierenden Anteil an Dialogen zwischen Mutter und Sohn und nur kurzen Erinnerungspassagen. Offensichtlich ist auch das Verhältnis zu seiner Mutter, die einen Großteil der Zeit in psychiatrischen Kliniken verbringt, mehr als kompliziert. „Ein ständiges Verlieren, ein ständiges Kapitulieren.“ Die offensichtliche Dominanz der Mutter lässt den Road-Trip zu einem Ödipus-Komplex auf vier Rädern werden. Bis zum Ende des Buches ohne erkennbare Chance auf mentale Abnabelung und emotionale Ablösung.
Zum Schluß sei noch etwas Wichtiges ergänzt, worüber der Autor seine Leser im Unklaren lässt, beziehungsweise das er vielleicht auch bewusst nicht definiert.
Eurotrash ist in aussereuropäischen Ländern eine Bezeichnung für dort lebende, gehobene und wohlhabende Europäer. Eine weiter gefasste Definition impliziert verarmte oder „trashige“ Europäer oder sehr abwertend „weißen Müll“.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch Selten ein so sinnfreies Buch gelesen. Schon in Faserland waren die Monologe eines dekadenten Jünglings ermüdend, jetzt, 25 Jahre später, kommen noch die Ergüsse einer dementen Mutter dazu. Aber die meisten Rezensenten sind begeistert.
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Satirische Familiengeschichte
Immerhin muss man dem Autor zugute halten, dass er sich nach dem Vorgängerband „Faserland“ gesteigert hat. Dort ging es sinnlos von Sylt nach Zürich.
Nun gehen die Ausflüge ins Innere der Familie, die ihren Reichtum mit den …
Mehr
Satirische Familiengeschichte
Immerhin muss man dem Autor zugute halten, dass er sich nach dem Vorgängerband „Faserland“ gesteigert hat. Dort ging es sinnlos von Sylt nach Zürich.
Nun gehen die Ausflüge ins Innere der Familie, die ihren Reichtum mit den Inselgrößen von Sylt teilte. Dabei spielt auch die Nazi-Vergangenheit der Großeltern eine Rolle. Hauptfigur ist aber die im Schweizer Pflegeheim wohnende Mutter, die mit ihrem Sohn im Taxi durch die Schweiz reist und ihr Geld plastiktütenweise ausgibt.
Höhepunkt ist der Besuch einer Almhütte, wo Christian mit seiner Mutter drei Frauen (im Buch „Hexen“ genannt) ein paar Tausend Franken schenken will. Als die Frauen das Geld ablehnen, weht ein Windstoß die Scheine in den Abgrund. Plastiktüten sammeln übrigens auch den Kot der Mutter, weil sie einen künstlichen Darmausgang hat.
Als Parodie auf heile-Welt-Familiengeschichten habe ich das Buch gern gelesen. Mitunter waren einige Seiten aber aus meiner Sicht sinnlos. Ich vergebe mit 4 Sternen einen mehr als bei „Faserland“, weil es besser ist, verschweige aber nicht, dass es auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises von 2020 nichts zu suchen hätten. 2021 dagegen sind alle von mir gelesenen Bücher deutlich schwächer. Auch dieses.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für