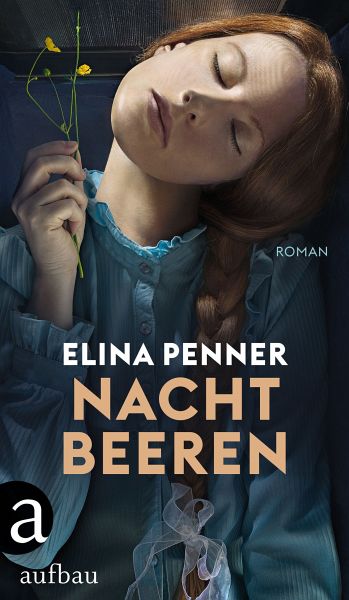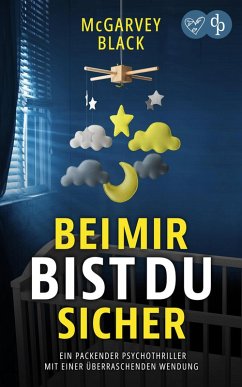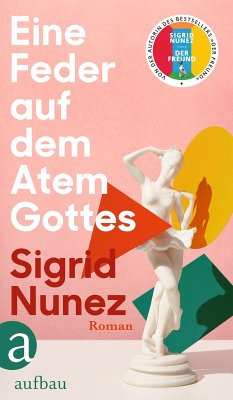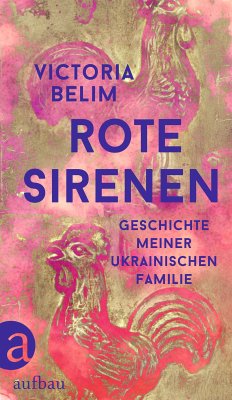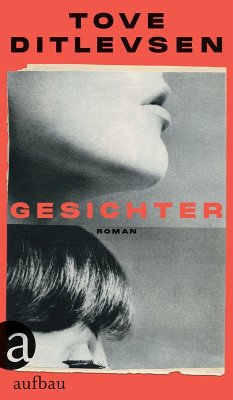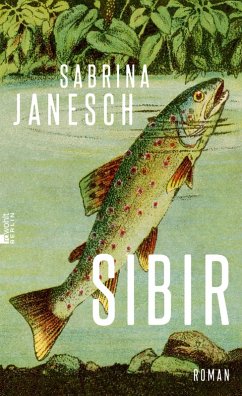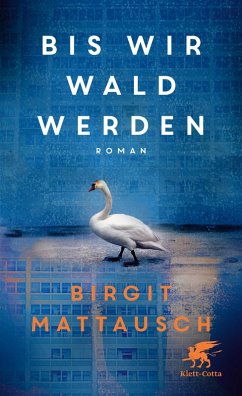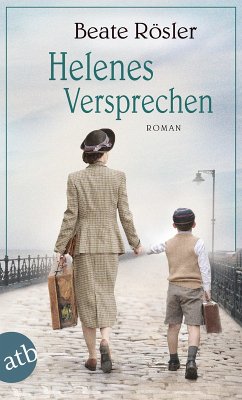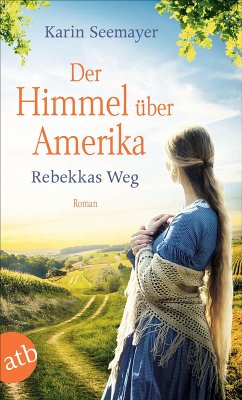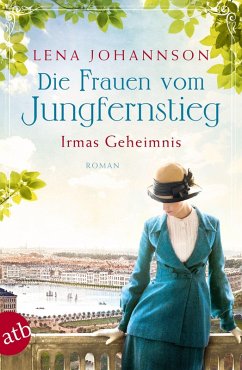Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)






Manchmal ist der einzige Ausweg die Flucht nach vorn, oder?In ihrem Debütroman erzählt Elina Penner von Nelli, die als kleines Mädchen als Russlanddeutsche nach Minden kommt. Sie spricht Plautdietsch und isst Tweeback und versucht, in der Provinz und dem neuen deutschen Leben anzukommen. Aber die Geschichten über ihr früheres Leben lassen sie nicht los, und als ihre geliebte Oma stirbt, gerät in Nelli etwas durcheinander. Ihr Mann Kornelius eröffnet ihr, sie für eine andere zu verlassen. Und Nelli ist sich am nächsten Morgen nicht sicher, ob sie ihn nicht aus Versehen umgebracht hat....
Manchmal ist der einzige Ausweg die Flucht nach vorn, oder?
In ihrem Debütroman erzählt Elina Penner von Nelli, die als kleines Mädchen als Russlanddeutsche nach Minden kommt. Sie spricht Plautdietsch und isst Tweeback und versucht, in der Provinz und dem neuen deutschen Leben anzukommen. Aber die Geschichten über ihr früheres Leben lassen sie nicht los, und als ihre geliebte Oma stirbt, gerät in Nelli etwas durcheinander. Ihr Mann Kornelius eröffnet ihr, sie für eine andere zu verlassen. Und Nelli ist sich am nächsten Morgen nicht sicher, ob sie ihn nicht aus Versehen umgebracht hat...
Elina Penner erzählt mit Komik und dunklem Humor von einer Gemeinschaft von Menschen, die aneinander festhalten, weil sie nichts anderes haben. Mittendrin eine junge Frau, die zusammenbricht - und ihren eigenen Weg sucht.
»Mit Sprachwitz und Sinn fürs Absurde erzählt Elina Penner von der Suche einer Russlanddeutschen nach ihren Wurzeln.« Brigitte.
»Ein Roman über eine junge Frau, die ihren eigenen Weg geht - schräg, dunkel und so gut.« Laura Karasek.
»Immer lustig und gefährlich zugleich. Elina Penner hält uns in stetiger Spannung, was als nächstes passiert, immer zwischen Schock, Lachen und tiefer Rührung. Ein bittersüßes Debüt.« Christian Dittloff.
»Elina Penner erzählt unfassbar witzig und klug die spannendste Familiengeschichte, die ich seit langem gelesen habe.« Ninia LaGrande Binias.
»Der Roman des Jahres.« Kareen Dannhauer.
»In einem umwerfenden Stakkato aus kurzen, klaren Sätzen setzt Erzählerin Nelli ein. Elina Penner erschafft eine starke Frauenfigur, der man gern zuhört und auf unbekanntes Terrain folgt.« Börsenblatt.
»Ein ungewöhnliches Debüt. Sie schafft unvergessliche Charaktere und unvergleichliche Szenen, fein austariert zwischen zarter Tragik und dunkler Komik.« Emotion.
In ihrem Debütroman erzählt Elina Penner von Nelli, die als kleines Mädchen als Russlanddeutsche nach Minden kommt. Sie spricht Plautdietsch und isst Tweeback und versucht, in der Provinz und dem neuen deutschen Leben anzukommen. Aber die Geschichten über ihr früheres Leben lassen sie nicht los, und als ihre geliebte Oma stirbt, gerät in Nelli etwas durcheinander. Ihr Mann Kornelius eröffnet ihr, sie für eine andere zu verlassen. Und Nelli ist sich am nächsten Morgen nicht sicher, ob sie ihn nicht aus Versehen umgebracht hat...
Elina Penner erzählt mit Komik und dunklem Humor von einer Gemeinschaft von Menschen, die aneinander festhalten, weil sie nichts anderes haben. Mittendrin eine junge Frau, die zusammenbricht - und ihren eigenen Weg sucht.
»Mit Sprachwitz und Sinn fürs Absurde erzählt Elina Penner von der Suche einer Russlanddeutschen nach ihren Wurzeln.« Brigitte.
»Ein Roman über eine junge Frau, die ihren eigenen Weg geht - schräg, dunkel und so gut.« Laura Karasek.
»Immer lustig und gefährlich zugleich. Elina Penner hält uns in stetiger Spannung, was als nächstes passiert, immer zwischen Schock, Lachen und tiefer Rührung. Ein bittersüßes Debüt.« Christian Dittloff.
»Elina Penner erzählt unfassbar witzig und klug die spannendste Familiengeschichte, die ich seit langem gelesen habe.« Ninia LaGrande Binias.
»Der Roman des Jahres.« Kareen Dannhauer.
»In einem umwerfenden Stakkato aus kurzen, klaren Sätzen setzt Erzählerin Nelli ein. Elina Penner erschafft eine starke Frauenfigur, der man gern zuhört und auf unbekanntes Terrain folgt.« Börsenblatt.
»Ein ungewöhnliches Debüt. Sie schafft unvergessliche Charaktere und unvergleichliche Szenen, fein austariert zwischen zarter Tragik und dunkler Komik.« Emotion.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 0.49MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
Elina Penner wurde 1987 als mennonitische Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion geboren und kam 1991 nach Deutschland. Plautdietsch ist ihre Muttersprache. Nach Jahren in Berlin und in den USA lebt sie mit ihrer Familie in Ostwestfalen. "Nachtbeeren" ist ihr Debütroman.
Produktdetails
- Verlag: Aufbau Verlage GmbH
- Seitenzahl: 248
- Erscheinungstermin: 14. März 2022
- Deutsch
- ISBN-13: 9783841229601
- Artikelnr.: 62932431
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.03.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.03.2022Abseits der Rechthaben-Falle
Slata Roschal und Elina Penner erzählen in ihren Debütromanen jeweils von russlanddeutscher Migration und religiöser Umorientierung
"Mit den Türken sind sie sich einig: Egal, was passiert, Hauptsache, die Kinder sind nicht schwul und heiraten keine Kartoffel. Alles andere kriegt man irgendwie hin." Die so denken, sind Ohnse, russlanddeutsche Mennoniten in Ostwestfalen, und die Romanfigur Nelli, die das hier mit einigem Abstand beobachtet, gehört ebenso dazu wie ihre Autorin Elina Penner. Sie, wir, ich und dann noch die Kartoffeln, die das schließlich lesen sollen - die Komplexität postmigrantischen Erzählens lebt von der Unmöglichkeit, sich selbst eindeutig zu verorten.
Zum
Slata Roschal und Elina Penner erzählen in ihren Debütromanen jeweils von russlanddeutscher Migration und religiöser Umorientierung
"Mit den Türken sind sie sich einig: Egal, was passiert, Hauptsache, die Kinder sind nicht schwul und heiraten keine Kartoffel. Alles andere kriegt man irgendwie hin." Die so denken, sind Ohnse, russlanddeutsche Mennoniten in Ostwestfalen, und die Romanfigur Nelli, die das hier mit einigem Abstand beobachtet, gehört ebenso dazu wie ihre Autorin Elina Penner. Sie, wir, ich und dann noch die Kartoffeln, die das schließlich lesen sollen - die Komplexität postmigrantischen Erzählens lebt von der Unmöglichkeit, sich selbst eindeutig zu verorten.
Zum
Mehr anzeigen
einen stimmt ja, was Penner in der Danksagung zu ihrem Debütroman "Nachtbeeren" schreibt: "dass das Selbstverständliche in meiner Welt die Faszination der anderen ist". Die gilt es zu wecken, ohne die migrantischen Binnenwelten dabei exotisierend einem voyeuristischen Blick preiszugeben, sagen wir: im Stile von Deborah Feldmans "Unorthodox". Zum anderen aber ist auch ein strukturelles Rechthaben gegen die jeweils anderen zu vermeiden, wie es sich nur allzu leicht in die Erzählung einer Heldin in schwieriger, auch verletzender Umgebung einschleicht. Denn hier droht die Trivialität des Selbstidentischen und eines Freund-Feind-Schemas.
Wie kann Literatur eine derart anspruchsvolle Balance überhaupt leisten? Die Antwort lautet immer: in ihrer sprachlichen Form. Schon wenn das Erzählen auf mehrere Stimmen verteilt ist, man also nicht alles aus Sicht einer autornahen Instanz präsentiert bekommt, ist das der Qualität meist förderlich. Das ist das Erfolgsrezept von Fatma Aydemirs Roman "Dschinns" (siehe obenstehende Rezension), und "Nachtbeeren" lässt neben der traumatisierten, anorektischen und überforderten Nelli auch deren gläubigen Sohn Jakob und den schwulen Bruder Eugen zu Wort kommen.
Dabei setzt der Roman auch auf Genreelemente: Die Handlung kommt in Gang, als Jakob seinen Vater auf mehrere Toppits-Gefrierbeutel verteilt in der Kühltruhe findet. Nun müssen die Onkel ran, und im weiteren Verlauf lernt man dann so einiges über die "in Tupperware konservierte" Sprache des Plautdietsch, die Auffassungen der Community zu Politik und Leben, Rezepte mit Schwarzem Nachtschatten, das Angebot im Mix Markt, die Gottesdienste und Helene Fischer (Ohnse Loyna). Es entsteht das Bild eines letztlich doch recht beschränkten Milieus: "Ohnse Menschen beklagen gerne die Zustände in der Welt und lachen sofort danach. Aber das kann der Ostwestfale an sich ja auch ganz gut" - Exotismusgefahr gebannt!
Nun gibt es in diesem Frühjahr noch einen zweiten Debütroman mit russlanddeutschem Hintergrund. Slata Roschals "153 Formen des Nichtseins" setzt die autofiktionale Geschichte einer jungen Frau namens Ksenia aus 153 kurzen Abschnitten zusammen. Neben erzählenden Miniaturen finden sich darunter Dialoge und Briefe, neben Einkaufslisten und Traumprotokollen stehen Kleinanzeigen, Social-Media-Einträge, ein Konferenzbericht, ein Fragebogen, Notizzettel sowie Liedgut und andere Texte der Zeugen Jehovas, zu denen die Familie jüdischer Herkunft im Zuge der Übersiedlung nach Deutschland konvertiert. Ksenia muss sich also nicht nur von tief verankerten russlanddeutschen Maßstäben emanzipieren (eine Frau müsse etwa die Phase ihrer Schönheit und Jugend nutzen, um einen wohlhabenden Mann zu angeln), sondern sich auch aus einer Sekte lösen. Früh ist sie als Ehefrau und Mutter ge- und auch überfordert, was insbesondere ihr Studium der Literaturwissenschaften in München und die ersten Schritte einer Laufbahn als Schriftstellerin verkompliziert ("da half kein Migrationshintergrund, kein gutes Porträtfoto").
All das schlägt sich in Sprache nieder. Roschal gelingt das Kunststück, sämtliche Facetten im Ich ihrer Figur mitsprechen zu lassen, und zwar nicht nacheinander, sondern in jedem einzelnen Abschnitt. Mitunter streiten in einem einzigen Satz emanzipatorischer Zukunftsentwurf und Reste religiöser Weltsicht miteinander; die von den Eltern gelernte Sorge um das wirtschaftliche Auskommen bleibt in den prekären Stipendienphasen präsent. Ihre neu erworbene akademische Intellektualität erlaubt Ksenia, sich von den konservativen Altbeständen etwas zu distanzieren, während diese ihre Gegenwart weiterhin mit existenzieller Wucht aufladen.
Roschals Prosa wirkt auf den ersten Blick einfach, fast alltäglich. Sie ist zugänglich, mitunter ergreifend, und doch praktiziert sie jene Vielstimmigkeit, die der große russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin bei Dostojewski gefunden hatte, und macht sie fruchtbar für die relevanten Diskurse unserer Gegenwart. Denn es ist ja nicht zuletzt das weibliche postmigrantische Subjekt, das auf diese Weise in seiner Komplexität zur Sprache kommt. Und die tut dem Diskurs so gut wie der Literatur.
Roschals Prosa hat enormen Zug: "Während wir uns anzogen, kam die Erzieherin raus, fragte vorsichtig und geheimnisvoll, warum wir kein Schweinefleisch äßen, aus religiösen Gründen bestimmt. Jüdische Wurzeln, sagte ich, und sie fragte fasziniert, ob wir zur Synagoge gingen, und die ganzen Feste, wir würden ja dann auch kein Weihnachten feiern, nicht, und ich, Wir sind nur bisschen Juden." Wo weniger gute Literatur aus der gut gemeinten, aber oftmals verletzenden Neugier der Durchschnittsdeutschen einen Vorwurf machen und damit in die Rechthaben-Falle tappen würde, verhindert Ksenias verblüffende Antwort das Zementieren vermeintlicher Identitäten, das in solchen Fällen von beiden Seiten droht. "Wir sind nur bisschen Juden" - das hat man so in deutschsprachiger Literatur noch nicht gelesen! Identität wird dabei nicht geleugnet, sondern in die Vielfalt dessen hineingestellt, was wir alle, mit welchem Hintergrund auch immer, realistischerweise immer sind, nämlich dies, jenes und einiges in Querung.
Das betrifft vor allem auch das Trauma, den bösen Zwilling der Identität. Roschals Roman leugnet Probleme und Defizite nicht, im Gegenteil fordert uns jeder Abschnitt ja eindringlich auf, die spezifische Form des Nichtseins zu finden, auf die er verweist. Und doch, wie großartig: 153 Formen des Nichtseins statt eines identitätsbegründenden Traumas! Und ist nicht jedes Sein ein beschränktes? In der Vielfalt der Abwesenheiten eröffnen sich demnach immer auch Möglichkeitsräume, die in die Zukunft weisen.
Und das tut dieser Roman insgesamt. Während man sich bei Penners "Nachtbeeren" am Ende dann doch fragt, ob die Handlung tatsächlich der Schwere der Probleme angemessen ist, die zuvor in Gestalt Nellis aufgerufen wurden, findet Roschals Roman in seiner überraschenden Struktur und seiner vielstimmigen Prosa eine überzeugende Lösung dafür, wie eine literarisch anspruchsvolle, diskursiv komplexe und zugleich sehr gut lesbare Erzählliteratur heute aussehen kann. MORITZ BASSLER
Elina Penner: "Nachtbeeren". Roman.
Aufbau Verlag, Berlin. 248 S., geb., 22,- Euro.
Slata Roschal: "153 Formen des Nichtseins". Roman.
Homunculus Verlag, Erlangen 2022. 176 S., Abb., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Wie kann Literatur eine derart anspruchsvolle Balance überhaupt leisten? Die Antwort lautet immer: in ihrer sprachlichen Form. Schon wenn das Erzählen auf mehrere Stimmen verteilt ist, man also nicht alles aus Sicht einer autornahen Instanz präsentiert bekommt, ist das der Qualität meist förderlich. Das ist das Erfolgsrezept von Fatma Aydemirs Roman "Dschinns" (siehe obenstehende Rezension), und "Nachtbeeren" lässt neben der traumatisierten, anorektischen und überforderten Nelli auch deren gläubigen Sohn Jakob und den schwulen Bruder Eugen zu Wort kommen.
Dabei setzt der Roman auch auf Genreelemente: Die Handlung kommt in Gang, als Jakob seinen Vater auf mehrere Toppits-Gefrierbeutel verteilt in der Kühltruhe findet. Nun müssen die Onkel ran, und im weiteren Verlauf lernt man dann so einiges über die "in Tupperware konservierte" Sprache des Plautdietsch, die Auffassungen der Community zu Politik und Leben, Rezepte mit Schwarzem Nachtschatten, das Angebot im Mix Markt, die Gottesdienste und Helene Fischer (Ohnse Loyna). Es entsteht das Bild eines letztlich doch recht beschränkten Milieus: "Ohnse Menschen beklagen gerne die Zustände in der Welt und lachen sofort danach. Aber das kann der Ostwestfale an sich ja auch ganz gut" - Exotismusgefahr gebannt!
Nun gibt es in diesem Frühjahr noch einen zweiten Debütroman mit russlanddeutschem Hintergrund. Slata Roschals "153 Formen des Nichtseins" setzt die autofiktionale Geschichte einer jungen Frau namens Ksenia aus 153 kurzen Abschnitten zusammen. Neben erzählenden Miniaturen finden sich darunter Dialoge und Briefe, neben Einkaufslisten und Traumprotokollen stehen Kleinanzeigen, Social-Media-Einträge, ein Konferenzbericht, ein Fragebogen, Notizzettel sowie Liedgut und andere Texte der Zeugen Jehovas, zu denen die Familie jüdischer Herkunft im Zuge der Übersiedlung nach Deutschland konvertiert. Ksenia muss sich also nicht nur von tief verankerten russlanddeutschen Maßstäben emanzipieren (eine Frau müsse etwa die Phase ihrer Schönheit und Jugend nutzen, um einen wohlhabenden Mann zu angeln), sondern sich auch aus einer Sekte lösen. Früh ist sie als Ehefrau und Mutter ge- und auch überfordert, was insbesondere ihr Studium der Literaturwissenschaften in München und die ersten Schritte einer Laufbahn als Schriftstellerin verkompliziert ("da half kein Migrationshintergrund, kein gutes Porträtfoto").
All das schlägt sich in Sprache nieder. Roschal gelingt das Kunststück, sämtliche Facetten im Ich ihrer Figur mitsprechen zu lassen, und zwar nicht nacheinander, sondern in jedem einzelnen Abschnitt. Mitunter streiten in einem einzigen Satz emanzipatorischer Zukunftsentwurf und Reste religiöser Weltsicht miteinander; die von den Eltern gelernte Sorge um das wirtschaftliche Auskommen bleibt in den prekären Stipendienphasen präsent. Ihre neu erworbene akademische Intellektualität erlaubt Ksenia, sich von den konservativen Altbeständen etwas zu distanzieren, während diese ihre Gegenwart weiterhin mit existenzieller Wucht aufladen.
Roschals Prosa wirkt auf den ersten Blick einfach, fast alltäglich. Sie ist zugänglich, mitunter ergreifend, und doch praktiziert sie jene Vielstimmigkeit, die der große russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin bei Dostojewski gefunden hatte, und macht sie fruchtbar für die relevanten Diskurse unserer Gegenwart. Denn es ist ja nicht zuletzt das weibliche postmigrantische Subjekt, das auf diese Weise in seiner Komplexität zur Sprache kommt. Und die tut dem Diskurs so gut wie der Literatur.
Roschals Prosa hat enormen Zug: "Während wir uns anzogen, kam die Erzieherin raus, fragte vorsichtig und geheimnisvoll, warum wir kein Schweinefleisch äßen, aus religiösen Gründen bestimmt. Jüdische Wurzeln, sagte ich, und sie fragte fasziniert, ob wir zur Synagoge gingen, und die ganzen Feste, wir würden ja dann auch kein Weihnachten feiern, nicht, und ich, Wir sind nur bisschen Juden." Wo weniger gute Literatur aus der gut gemeinten, aber oftmals verletzenden Neugier der Durchschnittsdeutschen einen Vorwurf machen und damit in die Rechthaben-Falle tappen würde, verhindert Ksenias verblüffende Antwort das Zementieren vermeintlicher Identitäten, das in solchen Fällen von beiden Seiten droht. "Wir sind nur bisschen Juden" - das hat man so in deutschsprachiger Literatur noch nicht gelesen! Identität wird dabei nicht geleugnet, sondern in die Vielfalt dessen hineingestellt, was wir alle, mit welchem Hintergrund auch immer, realistischerweise immer sind, nämlich dies, jenes und einiges in Querung.
Das betrifft vor allem auch das Trauma, den bösen Zwilling der Identität. Roschals Roman leugnet Probleme und Defizite nicht, im Gegenteil fordert uns jeder Abschnitt ja eindringlich auf, die spezifische Form des Nichtseins zu finden, auf die er verweist. Und doch, wie großartig: 153 Formen des Nichtseins statt eines identitätsbegründenden Traumas! Und ist nicht jedes Sein ein beschränktes? In der Vielfalt der Abwesenheiten eröffnen sich demnach immer auch Möglichkeitsräume, die in die Zukunft weisen.
Und das tut dieser Roman insgesamt. Während man sich bei Penners "Nachtbeeren" am Ende dann doch fragt, ob die Handlung tatsächlich der Schwere der Probleme angemessen ist, die zuvor in Gestalt Nellis aufgerufen wurden, findet Roschals Roman in seiner überraschenden Struktur und seiner vielstimmigen Prosa eine überzeugende Lösung dafür, wie eine literarisch anspruchsvolle, diskursiv komplexe und zugleich sehr gut lesbare Erzählliteratur heute aussehen kann. MORITZ BASSLER
Elina Penner: "Nachtbeeren". Roman.
Aufbau Verlag, Berlin. 248 S., geb., 22,- Euro.
Slata Roschal: "153 Formen des Nichtseins". Roman.
Homunculus Verlag, Erlangen 2022. 176 S., Abb., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Viktor Funk empfiehlt Elina Penners Debütroman über eine dysfunktionale mennonitisch-russlanddeutsche Familie. Wie die Autorin eine Welt erschließt, die den meisten von uns unbekannt sein dürfte, uns mit Wörtern aus dem Plautdietschen überrascht und die verschiedenen Wirklichkeiten ihrer Figuren vorstellt, die der mennonitischen und der offiziellen Sowjetunion, die der deutschen Gegenwart und die einer utopischen Traumwelt, findet Funk stark. Zu entdecken gibt es laut Funk nicht nur unbekannte Lebenswelten, sondern auch eine tragische, komische und lehrreiche Geschichte über patriarchale Strukturen und Umsiedlungserfahrungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Elina Penners 'Nachtbeeren' ist ein tragischer, ein lustiger, ein unterhaltsamer und ein lehrreicher Roman.« Frankfurter Rundschau 20220823
Streckenweise sehr gut
''Ich bin eine 35-jährige gläubige, fromme und bekehrte Mennoniten, und mein Mann ist weg. Vielleicht, um bei der Frau zu sein, die er liebt. Ich frage mich, ob einer meiner Brüder ihn töten würde, wenn ich nur den Mund aufkriegen und fragen …
Mehr
Streckenweise sehr gut
''Ich bin eine 35-jährige gläubige, fromme und bekehrte Mennoniten, und mein Mann ist weg. Vielleicht, um bei der Frau zu sein, die er liebt. Ich frage mich, ob einer meiner Brüder ihn töten würde, wenn ich nur den Mund aufkriegen und fragen würde.’’ (Tolino S. 32)
Nachtbeeren
Elina Penner
Die 35-jährige Nelli, ist fromm. Ein Nesthäkchen und Nachzügler, mit vier älteren Brüdern. Sie selbst wurde direkt nach ihrer Metzgerlehre, mit zwanzig Jahren, schwanger und heiratete den Kindesvater. Seitdem sie im Alter von vier Jahren nach Deutschland kam, wohnt sie in Minden und dort spricht sie mit ihrer Familie ‚Plautdietsch‘. Doch vor allem ist sie Tochter von 'Russlanddeutschen‘.
''Ich wusste, wenn ich Leuten erzählte, wo ich herkam und wer ich war, dann würden Hiesige an die russischen Schminktanten denken.
Wir waren einfach Russen, die ins Land gekommen waren, Tausende von ihnen. Wir alle tranken Wodka, konnten kein Deutsch, hatten aber deutsche Nachnamen. So stellen sich die Hiesigen das vor. So machte es Sinn. Ich erklärte immer und immer wieder, alles, auch meinen Nachnamen, meine Sprache, doch niemand hörte richtig zu. Sie lächelten verständnisvoll und nickten nur.’’ (Tolino S. 73)
Jeden Sonntag trifft sich die Familie bei 'Öma' oder bei den Brüdern, es wird gegessen und viel getrunken. Meistens sind es die selben Themen, über die sie sprechen: Über die Flucht, den Glauben und die Kartoffeln. Einst waren sie froh, nach der Flucht aus Russland, in einer Notunterkunft zu wohnen. In der Notunterkunft waren sie noch mit einer Herdplatte zufrieden gewesen. Hauptsache weg aus Russland! Doch im Laufe der Jahre schimpfen sie immer mehr auf die Deutschen, die Kartoffeln.
Nelli, lehnte einst den Glauben ab, aber nach der Totgeburt ihres zweiten Kindes, und dem Tode ihrer geliebten ‚Öma‘ wurde sie depressiv, starrte tagelang ins Leere und fand Trost im Gebet.
Als ihr Mann Kornelius ihr beichtet, dass er eine andere liebt, ist sie so verwirrt, dass sie sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kann, ob sie ihren Mann vielleicht umgebracht hat - zumindest ist er weg.
Der Debütroman von Elina Penner sprach mich mit seinem besonderen Cover sofort an. Die Schreibweise und die kurzen Sätze sind unaufgeregt, passen aber hervorragend zur Geschichte.
Besonders gut gefiel mir der Einblick in die Denkweise, ja in die Zerrissenheit der Aussiedler, nach der Flucht. Dies wird sehr gut und glaubwürdig dargestellt. Auch die liebevolle Mutter-Sohn-Beziehung gefiel mir hervorragend.
Worüber ich mich jedoch sehr gestört habe, sind die Vorurteile/Verallgemeinerungen über die Deutschen, sowie dass die Deutschen insgesamt 14 Mal als ‚Kartoffeln' bezeichnet wurden.
Fazit: Ein interessantes Debüt, mit zartem schwarzem Humor, aber auch nicht mehr.
3/ 5
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nachtbeeren ist ganz klar jetzt schon ein Jahreshighlight von mir und wird noch öfter gelesen werden.
Ich habe selten ein Buch gelesen, in dem für mich einfach jeder Satz saß. Kein Wort zu viel, keine unnätigen Ausschweifungen. Der Schreibstil der Autorin ist on point und am …
Mehr
Nachtbeeren ist ganz klar jetzt schon ein Jahreshighlight von mir und wird noch öfter gelesen werden.
Ich habe selten ein Buch gelesen, in dem für mich einfach jeder Satz saß. Kein Wort zu viel, keine unnätigen Ausschweifungen. Der Schreibstil der Autorin ist on point und am liebsten würde man immer tiefer und tiefer in diese Geschichte eintauchen.
Schnell habe ich gemerkt, dass für mich nicht die Handlung im Vordergrund steht. Und das hat überhaupt nichts damit zutun gehabt, dass das Buch nicht spannend ist oder so. Im Gegenteil, die Geschichte ist mitreißend.
Was dieses Buch aber so besonders macht, sind die Einblicke in die Gefühlswelt der Protagonisten, geprägt durch ihre Herkunft und die Traumata ihrer Vorfahren, So viele Stellen habe ich mehrfach gelesen, sie dann noch meiner Mutter vorgelesen und Freundinnen geschickt. Ich war selbst ganz überrascht von mir, aber ich kam aus dem Nicken gar nicht mehr raus.
Ich bin einfach nur dankbar für dieses Werk. Für das Verständnis, das mir in keinem Buch bisher so begegnet ist und für die klare Benennung so vieler Dinge, die in meinem Kopf immer nur an der Oberfläche gekratzt haben.
Das heißt nicht, dass diese Geschichte nicht trotzdem von jedem verstanden werden kann. Im Gegenteil, ich glaube, dass jeder davon profitiert, sich auf diese Erzählung einzulassen.
Außerdem gefällt mir der lockere Schreibstil von wahnsinnig gut. Ich tu mich sehr oft schwer mit schwarzem Humor, finde ihn oft too much. Hier hat er mich aber komplett abholen können. Diese Kombination aus düster und doch etwas schräg ist einfach total meins. Vor allem, wenn dann noch so eine Tiefgründigkeit dazu kommt.
Das Buch umfasst nur etwa 250 Seiten, also habt ihr alle keine Ausrede, es nicht zu lesen
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nun, das ist ein wirklich zu tiefst eindrücklicher Roman, welcher stark nachhallt und im Geiste noch weiter reift. Er zählt für mich zu jener bemerkenswerter Lektüre, dessen Gesamtheit ich erst ein paar Tage später so richtig begreifen konnte – und noch mehr …
Mehr
Nun, das ist ein wirklich zu tiefst eindrücklicher Roman, welcher stark nachhallt und im Geiste noch weiter reift. Er zählt für mich zu jener bemerkenswerter Lektüre, dessen Gesamtheit ich erst ein paar Tage später so richtig begreifen konnte – und noch mehr genießen durfte.
Erzählt wird die Geschichte von Nelli Neufeld, Mennonitin und Russlanddeutsche. Ihre Muttersprache ist Plautdietsch (da musste ich erstmal googeln), und das kommt in so manchen Zitaten im Roman immer wieder mal vor. So wie es damals möglich war, kam sie mit ihrer Familie zu Beginn der 1990er Jahre nach Deutschland. Dies alles trifft auch für die Autorin zu.
Nelli ist und bleibt eine Außenseiterin, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Familie. Ungeliebt und ungewollt – das sind nicht die besten Voraussetzungen für ein glückliches Leben, gar eine glückliche Kindheit. Von den Mitschülern gehänselt und ausgelacht, von den Eltern … ja, was wohl? Die einzigen, welche ihr am ehesten so etwas wie Liebe entgegen bringen konnten, waren ihre „Öma“, und ihr Bruder Eugen. Letzterer hat es selbst nicht leicht und verlässt die Familie. In ihrer eigene Familie mit Ehemann Kornelius und Sohn Jakob, den sie wirklich sehr liebt, bleibt ihr ebenfalls das erhoffte Glück versagt. Kornelius ist: „… kein Ehemann, sondern ein Mann in der Ehe ...“. Als Öma stirbt, zieht es Nelli restlich den Boden unter den Füssen weg.
Nelli, Jakob und Eugen erzählen die Geschichte über ihr Leben als Russlanddeutsche, über ihren Glauben und ihre Religion, Sprache und Familie. Sie versuchen darzustellen, wie es so ist, in einer entwurzelten Umgebung zu recht zu kommen, das „neue“ Leben in Deutschland contra den uralten Gepflogenheiten der Familie mit all ihren sonntäglichen Treffen und Ritualen zu meistern. Wie kann man (und frau) loslassen, wenn die Ketten derart stark sind. Es fängt von klein auf an bei Nelli, und der Bogen der verletzten und zerquetschten Seele reicht weit, beginnend von Essstörungen bis zu Misshandlungen und noch vielem mehr.
Ich könnte noch so viel darüber erzählen … auch darüber, dass trotz all der Tragik der Grundtenor gar nicht so schwarz war … obwohl, auch ein wenig schwarzer Humor taucht auf, wenn man dem Geheimnis einer Kühltruhe nachgeht, welches sich wie ein kleiner (schwarzer) Faden durch den Roman zieht.
Es ist ein sehr besonderes Buch, welches etwas Ruhe und viel Empathie beim Lesen benötigt. Letztendlich wird man mit einem außergewöhnlichen Lesegenuss und vielen Gedanken belohnt, welche es mehr als wert sind, bedacht zu werden.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Neufelds sind mennonitische Aussiedler aus Russland, die ihre neue Heimat in Minden gefunden haben. Dort leben sie weitestgehend unter sich, pflegen ihre Werte und Traditionen, kochen nach den alten Rezepten und reden Plautdietsch, einen deutschen Dialekt mit Einsprengseln besonders aus dem …
Mehr
Die Neufelds sind mennonitische Aussiedler aus Russland, die ihre neue Heimat in Minden gefunden haben. Dort leben sie weitestgehend unter sich, pflegen ihre Werte und Traditionen, kochen nach den alten Rezepten und reden Plautdietsch, einen deutschen Dialekt mit Einsprengseln besonders aus dem Russischen. Zu den Traditionen gehört das sonntägliche Treffen, bei dem man stundenlang zusammensitzt, isst und Neuigkeiten austauscht. Teil der Familie Neufeld ist auch Nelli, die als Kind in den 1990ern nach Minden kam und mittlerweile selbst verheiratet und Mutter eines 15-jährigen Sohns ist. Nelli ist eine Bekehrte, was heißt, dass sie streng nach den Glaubensregeln lebt. Die Familie, die Zugehörigkeit, sind ihr wichtig. Doch an diesem Sonntag ist sie nicht bei der Sache. Immer wieder schweifen ihre Gedanken zu ihrem Mann Kornelius, der ihr am Donnerstag eröffnet hatte, dass er sie wegen einer anderen verlassen will. Seitdem ist er verschwunden. Wo ist er? Lebt er noch? Und wenn nicht, hat Nelli etwas damit zu tun?
„Nachtbeeren“, das Debüt von Elina Penner, ist kein Krimi. Aber was ist es dann? Eine Familiengeschichte? Ein Roman über Mennoniten? Über Aussiedler? Über die Suche nach Heimat und Zugehörigkeit? Über Integration? Über prägende Erlebnisse der Kindheit? Über Selbstfindung? Abgrenzung? Er ist alles das, aber vor allem eins: gelungen.
Penner schreibt mit leichter, oft amüsanter Hand, karikiert und konterkariert in einem Streich. Als Leserin musste ich öfter innehalten, weil mir erst mit Verzögerung klar geworden ist, was mir gerade im lockeren Tonfall mitgeteilt wurde. Welche prägenden Erfahrungen ihre Figuren gemacht haben, wie tief die Verletzungen gehen. Und dabei entwickelt sie einen Spannungsboden, den man durchaus mit „Suspense“ bezeichnen kann. Ich habe schon länger nicht mehr mit so viel Ungeduld Seiten umgeblättert.
Was man aus „Nachtbeeren“ mitnimmt, ist vielfältig. Es war ungemein interessant, mehr über Mennoniten zu erfahren, über ihr Leben in Deutschland, über das ich überhaupt nichts wusste. Aber die eigentliche Geschichte ging nicht darin unter. Penner hat eine sehr gute Balance zwischen ihren Themen gefunden, sie verflochten, ohne dass eine zwangsläufige Verkettung entstanden wäre, die sich auf einen „Kulturkreis“ beschränkt hätte.
„Nachtbeeren“ war eine Zufallsentdeckung, über die ich sehr froh bin. Es war zwar kein Buch, das einem den Atem raubt und völlig erschlagen oder beseelt zurücklässt. Aber es war eins, dessen Lektüre viel Spaß gemacht hat, eins, von dem ich erwarte, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und Elina Penner werde ich ab sofort im Auge behalten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für