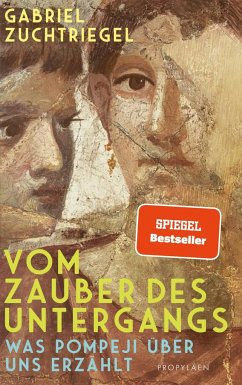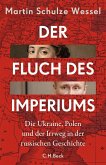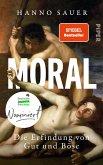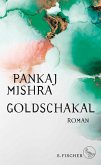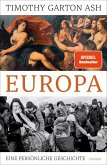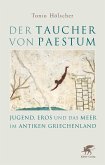Ein neuer Blick auf Pompeji und die befreiende Kraft der Kultur
Garküchen, ein Sklavenzimmer, griechische Theater, Villen, Thermen und Tempel - die Ausgrabungen in Pompeji offenbaren eine Welt. Doch was hat sie mit uns zu tun? Gabriel Zuchtriegel, der neue Direktor des Weltkulturerbes, legt eindrucksvoll dar, dass verschüttete Altertümer, starre Ruinen und schweigende Bilder uns noch heute verändern können.
Fast täglich kommt Gabriel Zuchtriegel bei seiner Arbeit an der Kreuzung der zwei Hauptachsen Pompejis vorbei, steht da, wo am Morgen des 25. Oktober im Jahr 79 n. Chr. eine ganze Stadt unter Asche und Geröll versank. Wenn Zuchtriegel die Skulptur des im Schlaf überraschten Fischerjungen sieht, muss er an seinen Sohn denken, der sich genauso einrollt, um nicht zu frieren. Dass solche Momente wesentlich sind, um zu vermitteln, was die Antike mit uns zu tun hat, darum geht es in diesem Buch. Gabriel Zuchtriegel bringt uns anhand der archäologischen Entdeckungenvom 19. Jahrhundert bis heute neben Ausgrabungstechniken auch Fragestellungen näher, die mit dem Wandel der Gesellschaft und unserer Gegenwart verknüpft sind. Das alles verbindet er mit seinem Werdegang als Archäologe, der Pompeji nicht nur als Weltkulturerbe erhalten möchte, sondern sich dafür einsetzt, dass alle diesen Ort als den ihren begreifen.
»Ein kluges und auf zurückhaltende Weise persönliches Buch« FAS
»Liebeserklärung an die Archäologie« FAZ
»So lebendig wurde noch nie über Archälogie erzählt« Die Zeit
Garküchen, ein Sklavenzimmer, griechische Theater, Villen, Thermen und Tempel - die Ausgrabungen in Pompeji offenbaren eine Welt. Doch was hat sie mit uns zu tun? Gabriel Zuchtriegel, der neue Direktor des Weltkulturerbes, legt eindrucksvoll dar, dass verschüttete Altertümer, starre Ruinen und schweigende Bilder uns noch heute verändern können.
Fast täglich kommt Gabriel Zuchtriegel bei seiner Arbeit an der Kreuzung der zwei Hauptachsen Pompejis vorbei, steht da, wo am Morgen des 25. Oktober im Jahr 79 n. Chr. eine ganze Stadt unter Asche und Geröll versank. Wenn Zuchtriegel die Skulptur des im Schlaf überraschten Fischerjungen sieht, muss er an seinen Sohn denken, der sich genauso einrollt, um nicht zu frieren. Dass solche Momente wesentlich sind, um zu vermitteln, was die Antike mit uns zu tun hat, darum geht es in diesem Buch. Gabriel Zuchtriegel bringt uns anhand der archäologischen Entdeckungenvom 19. Jahrhundert bis heute neben Ausgrabungstechniken auch Fragestellungen näher, die mit dem Wandel der Gesellschaft und unserer Gegenwart verknüpft sind. Das alles verbindet er mit seinem Werdegang als Archäologe, der Pompeji nicht nur als Weltkulturerbe erhalten möchte, sondern sich dafür einsetzt, dass alle diesen Ort als den ihren begreifen.
»Ein kluges und auf zurückhaltende Weise persönliches Buch« FAS
»Liebeserklärung an die Archäologie« FAZ
»So lebendig wurde noch nie über Archälogie erzählt« Die Zeit
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Sabine Seifert freut sich über den frischen Wind, den Gabriel Zuchtriegel mit seinem Buch in die archäologische Szene bringt. Denn der 1981 geborene und damit als Vertreter einer neuen Generation gehandelte Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji setzt sich in seinem Buch über die untergegangene Stadt auch mit Themenfeldern auseinander, die in seinem Fachgebiet bisher wenig Beachtung erfuhren, lobt Seifert: So etwa mit sexueller Gewalt, die die antike Mythologie durchzog und dabei so selbstverständlich war, dass es gar keine Begriffe dafür gab, oder auch mit Postkolonialismus und Diskursanalyse, so die Kritikerin. Dass Zuchtriegel sein Buch in Richtung solcher Themen öffne und in diesem Zuge auch sein eigenes Hadern mit der Archäologie in seinem beruflichen Werdegang thematisiere, findet Seifert spannend. Auch andere Kapitel, die sich etwa um das erste freigelegte Sklavenzimmer oder um ein nicht altehrwürdiges, sondern alltägliches Pompei mit Werkstätten, Schenken und Wohnungen drehen, findet sie so "lebendig", dass ihr eine Vorkenntnis zu Pompeji nicht notwendig scheint. Einzig über die "Probleme der Konservierung und des Denkmalschutzes" bezüglich der Ausgrabungen hätte sie gern noch etwas mehr gelesen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Liebeserklärung an die Archäologie: Gabriel Zuchtriegel, Direktor der Welterbestätte Pompeji, lädt ein zu Entdeckungen in der untergegangen Stadt.
Rund sechshundertmal im Jahr rückt im Archäologischen Park von Pompeji der medizinische Notdienst aus. Bei etwa jedem fünften Einsatz handelt es sich um Herz-Kreislauf-Probleme. Das heiße Wetter gilt als nur ein Grund dafür. In den Medien wird über das Stendhal-Syndrom spekuliert, benannt nach dem französischen Schriftsteller, den die Besichtigung der Basilica di Santa Croce in Florenz 1817 "in eine Art Ekstase" versetzte, die in Erschöpfung umschlug, "mein Lebensquell war versiegt, und ich fürchtete umzufallen". Die Psychologin Graziella Magherini hat die kulturelle Reizüberflutung bei ausländischen Touristen der Kunstmetropole diagnostiziert und 1979 mehr als hundert Fallgeschichten in einem Buch beschrieben: Herzrasen, Atemnot und Hyperventilation, Ohnmacht, Schwindel, Schweißausbrüche, Übelkeit, Halluzinationen zählen zu den Symptomen.
Mit diesen "Risiken und Nebenwirkungen" eröffnet Gabriel Zuchtriegel, seit gut zwei Jahren Direktor der Welterbestätte, sein Buch. "Ich selbst blieb bisher verschont", gesteht er und räumt ein, an einigen Orten in Pompeji für sich "eine gewisse Gefährdung" zu sehen: So bei der Skulptur eines im Schlaf überraschten Fischerjungen, der sich in seinen Kapuzenmantel eingerollt hat, "wie mein achtjähriger Sohn das manchmal macht". Das eigentliche Problem aber ist für den Archäologen ein anderes, er nennt es "Sammlersyndrom": Die Einstellung, antike Kunstwerke zu Besitztümern herabzuwürdigen und unter den Pompeji-Besuch einen Haken zu setzen, womöglich gar eine Scherbe mitgehen zu lassen. Da ist ihm Stendhal näher, der beim Verlassen der Kirche empfand, "das alles spricht lebendig zu meiner Seele", und zur Gruppe der "spirituellen Pilger" gehört, die ins Museum gehen, "um Energie zu tanken, sich selbst besser kennenzulernen", Verlustgefühle inklusive. "Wir können alle dieser Gruppe beitreten", ruft Zuchtriegel dem Leser zu: "Probieren Sie es selbst aus!"
Das Buch ist weniger eine Anleitung als eine Einladung dazu. Keine wissenschaftliche Studie, vermittelt es auch Grundwissen und Ergebnisse der Forschung, vor allem aber eine unakademische Zuwendung, die nicht von der eigenen Erfahrungswelt abstrahiert, sondern mit den Altertümern in Dialog treten und eine sinnliche Wahrnehmung erschließen lässt. "Emotionale Triebfeder" ist ein Schlüsselbegriff des 1981 geborenen Autors, seine Biographie steht dafür: Angefangen bei dem Gymnasiasten als von den Eltern seiner Mitschüler engagierter Latein-Nachhilfelehrer in Oberschwaben über den Studenten der Humboldt-Universität, der sich mit seiner Abschlussarbeit über Latrinen und Abwassersysteme in antiken griechischen Städten als Nestbeschmutzer des Fachs auszeichnet, und den Direktor des Archäologischen Parks von Paestum und Vela bis zur für ihn selbst überraschenden Berufung zum Hüter des Archäologischen Parks von Pompeji mit gerade einmal 39 Jahren.
Leben und Archäologie, Archäologie und Leben: Zuchtriegel trennt sie auch nicht in der Darstellung, Stationen der Biographie werden nicht chronologisch aneinandergereiht, sondern eingeflochten. Wie er dabei vom einen zum anderen (und wieder zurück) kommt, die Geschichte der im Jahre 79 n. Chr. untergegangenen Stadt wie auch die der 1748 begonnenen Ausgrabung rekapituliert, Funde und Werke einordnet, Fragen der Interpretation und Restaurierung erörtert und immer wieder aktuelle Bezüge herstellt, wie er ab- und wieder zurückschweift, sich in Debatten stürzt, die Absurditäten der Bürokratie oder die Sensationslust der Presse kritisch streift, das alles und manches mehr fügt sich, farbig und luzide erzählt, zu einer Liebeserklärung an die Archäologie: Fremd und faszinierend, wie sie der Gegenwart entgegentritt, zeigt sie dieser ihre Grenzen und ihre Veränderbarkeit auf.
Das biographische Band verknüpft vier essayistische Kapitel. "Was ist dran an klassischer Kunst?", fragt das erste. Dass die Römer in der griechischen Kunst, mit der sie Tempel, Häuser und Gärten schmückten, ihre "Klassik" hatten, nimmt Zuchtriegel als Ausgangspunkt, den Begriff neu zu bedenken: zunächst an der Statue des Apollo Citarista, dann an der Gestalt des Hermaphroditus, die ihn Vorstellungen zum antiken Umgang mit Körpern und Sexualität sondieren lässt. "Im Sog des Ritus" geht der engen Verzahnung von Religion und Kunst nach, erklärt den Aufstieg des Dionysus zum "neuem Gott", würdigt die "Operation Mysterienvilla" von Amedeo Maiuri während des Faschismus als maßstabsetzende Grabung und diskutiert die konträren Deutungen des Freskenzyklus in ihrem Saal von Paul Veyne und Gilles Sauron.
Das Kapitel "Eine Stadt am Rande der Katastrophe" wartet mit einer neuen Schätzung der Größe Pompejis auf: Nicht nur zwölf- oder zwanzigtausend, sondern eher 45.000 Menschen lebten in einer "vollgestopften Stadt" und mithin auf sehr engem Raum. Was den jüngsten Fund des Sklavenzimmers der Civita Giuliana so bedeutend macht, ist der "Seltenheitswert des Alltäglichen": Ein Titel, der, so Zuchtriegel, auch Programm ist und "als Überschrift für meinen persönlichen Zugang zur Archäologie und zu Pompeji stehen könnte". "Was am Ende zählt", muss aber der Leser dieses Buches, in seiner Entdeckerfreude gestärkt, selbst bestimmen.
Schon Zuchtriegels Vorgänger Massimo Osanna, der 2014 antrat und "die (tatsächlichen und angeblichen) Skandale (...) vergessen ließ", hatte die Ausgrabungsstätte geöffnet. Sein "Grande Progetto Pompei" schärfte die Aufmerksamkeit für das Alltagsleben und entwarf das neue Bild einer lebendigen, kompletten Stadt, deren Bewohner - im Schnitt waren es vor der Pandemie mehr als zehntausend Besucher - sich aber meist nur einen Tag in ihr aufhalten. Zuchtriegel, der, fast eine Generation jünger als Osanna, diesen Maestro nennt, baut das aus. Leidenschaftlich berichtet er von dem Vorhaben, das er im ersten Jahr für sein wichtigstes hält: Ein Theaterworkshop mit Jugendlichen aus dem von Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsemigration und der Camorra kontaminierten Umland, der eine emotionale Bindung zu der von vielen "als eine Art Ufo" wahrgenommenen antiken Stadt herstellte und diese zu einem Teil ihres Lebens machte. Aristophanes' Komödie "Die Vögel" wurde adaptiert und zum "Traum vom Fliegen", mit dem der nächste große Fund, was für ein schöner Zufall, in Verbindung trat: Marcus Venerius Secundio, der sich das Grab bauen ließ, war ein freigelassener Sklave, der zu Wohlstand gelangt war und, so die Inschrift, "allein griechische und lateinische Spiele über vier Tage veranstaltete". Vielleicht wird damit angedeutet, wo Zuchtriegel mit Pompeji hinwill. Das Theaterprojekt unternimmt den Versuch, die antike Stadt vom Bann des Vergangenen zu befreien: So verstanden und belebt, ist sie keine eingefrorene Welt, kein "nur" musealer Ort mehr.
"Neapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art von trunkner Selbstvergessenheit. Mir geht es ebenso, ich erkenne mich kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch", notiert Goethe am 16. März 1787, fünf Tage nach dem Besuch in Pompeji, in der "Italienischen Reise", nachdem er sich schon bei seiner Ankunft in Italien "wie neu geboren" vorgekommen war. Eine Art Wandlung hat auch Zuchtriegel, der die Annahme der italienischen Staatsbürgerschaft 2020 eine "Herzensangelegenheit" nennt, an sich beobachtet. Schon bei seiner ersten Grabung mit einem rein italienischen Team hatte er das Gefühl, "in Italien irgendwie besser reinzupassen", formuliert er salopp: "Tatsächlich sagen mir Freunde, die mich sowohl als 'Deutschen' als auch als 'Italiener' kennen, dass ich in der italienischen Fassung wesentlich extrovertierter wirke . . ." Gut möglich, dass das dem auf Deutsch, doch entspannt und unvergrübelt geschriebenen Buch zugutegekommen ist. ANDREAS ROSSMANN
Gabriel Zuchtriegel: "Vom Zauber des Untergangs". Was Pompeji über uns erzählt.
Propyläen Verlag, Berlin 2023. 240 S., Abb., geb., 29,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Gabriel Zuchtriegels so famoses wie ungewöhnliches Buch „Vom Zauber des Untergangs – Was Pompeji über uns erzählt“
„Ich bin Archäologe mit Schlagseite.“ Gabriel Zuchtriegel ist ein Phänomen. Seit 2021 leitet der 41-Jährige den Archäologischen Park der durch einen Vesuvausbruch zerstörten antiken Stadt Pompeji. Es ist eine der berühmtesten Ausgrabungsstätten der Welt, nur Rom, die Alhambra, Athen, die Pyramiden von Gizeh und das Tal der Könige haben für ein breiteres Publikum eine ähnliche Faszinationskraft. Als Gabriel Zuchtriegel ernannt wurde, begannen, er beschriebt es in seinem soeben erschienenen Buch „Vom Zauber des Untergangs. Was Pompeji über uns erzählt“ anschaulich, „sechs Wochen Dauerbeschuss“ durch Gegner seiner Berufung. Er sei zu jung und zu unerfahren, 140 Kollegen unterschrieben eine Petition gegen ihn. Aus vollkommen heiterem Himmel kam dieser Widerstand allerdings nicht.
Gabriel Zuchtriegel ist kein akademischer Archäologe, der still vor sich hin gräbt, sondern einer, der anders denkt als die meisten seiner Kollegen: „Wenn wir als Gesellschaft in Denkmalschutz und Forschung investieren, was können Denkmalschutz und Forschung der Gesellschaft zurückgeben?“ Das schreibt er nicht als rhetorische Frage, er lebt es. Also startete er ein Projekt, „das ich im ersten Jahr in Pompeji für mein wichtigstes halte“, die Aufführung der „Vögel“ des Aristophanes mit siebzig 14- bis 17-Jährigen aus der Gegend, oft arme Kinder, denen Pompeji genauso fremd war wie der griechische Komiker. Manche „mussten erst mal überzeugt werden, nicht bekifft zu den Proben zu kommen“. Bei der Premiere im großen Theater vom Pompeji heulten viele, auch Zuchtriegel, „aber niemand bemerkte es, weil ich in der ersten Reihe saß“. Mittlerweile wird in Pompeji auch wieder Wein produziert, 150 Schafe mähen das Gras zwischen den Ruinen, „kostenlos“.
Ist Gabriel Zuchtriegel, dieser „Archäologe mit Schlagseite“, auch Sozialarbeiter, Marketing-Genie, Querulant, Überflieger, Aktivist? Ja. Denn all diese Spezialbegabungen sind für einen Archäologen, zumal den Chef von Pompeji, überlebenswichtig, um seinen Job im Sinne der von Zuchtrigel formulierten gesellschaftlichen Verpflichtung zu machen. Dazu passt auch dieses so ungewöhnliche wie grandiose Buch. Es kommt als eine vielfach gebrochene Rechtfertigung und Doppelbiografie daher, weil die Geschichte Pompejis, beim legendären Vesuv-Ausbruchs 79 n.Chr. verschüttet und ab 1748 wieder ausgegraben, mit der Lebensgeschichte seines Chefarchäologen verwoben wird. Was nicht (nur) Gabriel Zuchtriegels Eitelkeit geschuldet ist. Sondern der Einsicht, „dass wir Wahrheit immer nur verpackt kriegen“. Die Persönlichkeit eines Forschers, seine Bildung, Religionszugehörigkeit, Vorlieben prägen seine Erkenntnisse, das hat das oberschwäbisch katholische Scheidungskind Zuchtriegel schon als Student bei dem Diskursanalysenvordenker Michel Foucault gelesen.
„16 Quadratmeter ganz alltäglichen Elends.“ Unweit von Pompeji in Civita Giuliana entpuppte sich eine Grabung, wie so oft waren zuvor Raubgräber am Werk gewesen, „als die schönste Entdeckung, an der ich an meinem Archäologendasein bislang mitwirken konnte“: besagter Miniraum mit Minifenster, drei Holzbetten, eines für ein Kind, Nachttopf, Tonkrüge, Decken, Amphoren. Drei Menschen haben hier gelebt und gearbeitet – waren es Sklaven? Jeder Tourist kennt in Neapel die bassi, die ärmlichen Kleinstwohnungen im Erdgeschoß von Palästen, da kommt die moderne „Stadt dem antiken Pompeji erstaunlich nah“.
Die meisten Menschen in der Antike waren bitterarm, „man aß Brot, und das war’s“. In dem zu drei Viertel ausgegrabenen Pompeji wurden bisher 36 Bäckereien entdeckt und 80 Thermopolia, vulgo Fastfood-Filialen. Aufgrund einer Grabinschrift errechnet Zuchtriegel für den Großraum Pompeji eine Bevölkerung von 8000 freien Männern, dazu kamen Frauen, Kinder, Sklaven, es könnten insgesamt 45 000 Menschen gewesen seien. Die Hälfte lebte womöglich innerhalb der Stadtmauern in 1400 Wohnungen: „Pompeji war eine mit Menschen vollgestopfte Stadt.“ Das sind Zuchtriegels Schätzungen. Sicher ist, dass die 130 Quadratkilometer des Großraums Pompeji nicht ausreichten, um so viele Menschen mit Brot zu versorgen, auch wegen der vielen Luxuslandvillen sowie des lukrativen und deshalb exzessiv betriebenen Weinanbaus. Man war vom Getreideimport abhängig, eine vierjährige Lebensmittelknappheit ist belegt. Zuchtriegel vergleicht die Situation mit der Versorgung Nordafrikas mit ukrainischem Getreide. Die Armut und Rückständigkeit in Pompeji seien nur schwer vorstellbar.
Der Archäologe erklärt, dass seine Faszination für die Antike auch von der Sehnsucht geprägt wurde, „in der Vergangenheit nicht nur eine andere Welt zu finden, sondern eine, die echter, wahrer, besser war“. Zumal im Sozialen war sie das jedoch nicht. Doch es gibt auch noch andere Aspekte der Epoche. Zuchtriegel entwirft unterhaltsam mäandernd ein schillernd brüchiges Alltagsbild, in dem dann auch die Standardthemen der Pompeji-Literatur vorkommen. Sexualität und Religion spielen eine beherrschende, sich auch gegenseitig befruchtende Rolle.
„Niemand musste sich auf eine bestimmte sexuelle Orientierung festlegen.“ Das klingt modern, war aber römischer Alltag. Vor allem für die freien Männer, die sich ihre Partner aussuchen konnten. Mann war durchaus bisexuell. Nur freier Mann mit freiem Mann, das war unmöglich. Cicero schwärmte für seinen Privatsekretär, einen Sklaven, Hadrian für einen nichtrömischen Epheben. In den Statuen der Villen wurde gern die „Sinnlichkeit des männlichen Körpers“, meist des nackten, gefeiert. Hermaphrodit, Kind der beiden in seinem Namen genannten Götter, entpuppt sich in Darstellungen anders als beim Großdichter Ovid als eine vollkommen schöne Frau, zusätzlich ausstaffiert mit Hoden und Penis. Was nicht nur den Hirtengott Pan erschreckt, als er seinen Irrtum bemerkt: „Phallus trifft auf Phallus.“
Erotik war zwar den Römern fremd, Vergewaltigung aber so alltäglich, dass es nicht einmal ein eigenes Wort dafür gab. Auch Frauenfeindlichkeit war gang und gäbe. Zuchtriegel erinnert an die Macho-Witzeleien von Archäologenmännern angesichts der ersten Genderstudies, und er würdigt die Pionierin Margarete Bieber (1879 – 1978), eine der großen, fast vergessenen Archäologinnen.
Öfter legt die antike Literatur falsche Fährten. Auch im Fall der Villa dei Misteri, deren Freskenzyklus weltberühmt ist, keine andere antike Wandmalerei ist derart umfangreich und faszinierend. Im Zentrum sieht der Besucher das teilweise zerstörte Bild von Rausch- und Skandalgott Dionysos mit einer Frau (Ariadne? Selene?), dazu eine Auspeitschung, eine Nackttänzerin, einen alten Suffkopf, einen nackten Musiker, einen lesenden Jungen, einen Korb mit etwas Verhülltem (Phallus) darin. Seit der Entdeckung vor 100 Jahren reizt dieser Zyklus zu immer neuen Deutungen. Man hat darin einen Mysterienkult entdecken wollen, Hochzeitsriten oder einen „dionysischen Sommertagstraum“. Gabriel Zuchtriegel ist vorsichtig: „Sich dogmatisch auf eine Lesart zu versteifen, ist das Falscheste, was man tun kann.“ Vermutlich steckt hier auch schon Kunst im modernen Sinn drin, die Antike kannte allerdings keine L’art pour l’art.
Sicher spielt hier auch Religion eine Rolle, schließlich „gab es keine Trennung zwischen Welt und Göttern“. Aber was war das für eine Religion? Ist das monotheistische Christentum für ihr Verständnis hilfreich? Gabriel Zuchtriegel wirft solche Fragen gern auf, verzaubert dann mit einem neuen Detail und lässt seine glücklichen Leser und Leserinnen allein weiterträumen. Es wäre kein Wunder, wenn sich in nächster Zeit halb Deutschland auf den Weg nach Pompeji macht.
REINHARD BREMBECK
„Was können Denkmalschutz
und Forschung der
Gesellschaft zurückgeben?“
Gabriel Zuchtriegel:
Vom Zauber des
Untergangs. Was Pompeji über uns erzählt.
Propyläen Verlag.
240 Seiten, 29 Euro.
Sozialarbeiter, Marketing-Genie, Querulant, Überflieger, Aktivist: Gabriel Zuchtriegel, Chef des Archäologischen Parks Pompeji.
Foto: Sandro Michahelles
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Zaubern mit Scherben - Gabriel Zuchtriegels so famoses wie ungewöhnliches Buch« Reinhard Brembeck Süddeutsche Zeitung 20230614