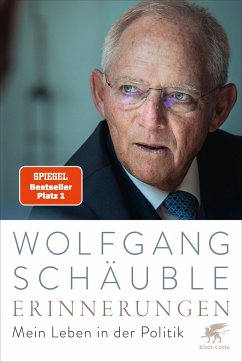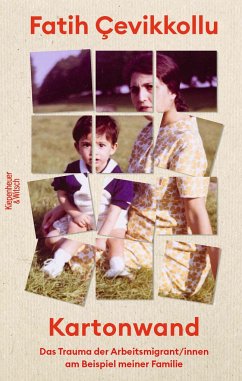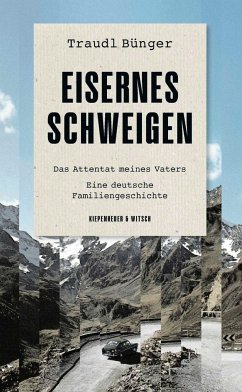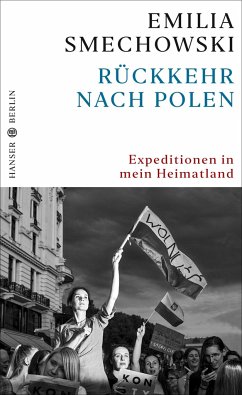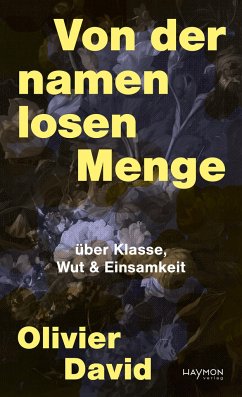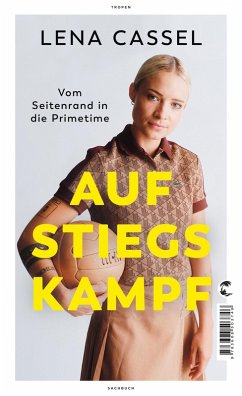Traumland
Der Westen, der Osten und ich
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein persönlicher Blick auf eine Epoche der Freiheit im Osten wie im Westen Europas. Glänzend erzählt.Mit spielerischem Scharfsinn hilft uns Adam Soboczynski uns selbst ebenso zu verstehen wie diesen seltsamen Osten Europas. Er erzählt von seiner Jugend in der Bonner und dem Erwachsensein in der Berliner Republik, von der großen Freiheit zwischen den Jahren 1989 und 2022, und wie sie verloren zu gehen droht - in beiden Teilen Europas. Im Osten wird sie von außen bedroht, im Westen durch innere Kämpfe.Adam Soboczynski zieht als Sechsjähriger aus Polen in die westdeutsche Provinz. Er verl...
Ein persönlicher Blick auf eine Epoche der Freiheit im Osten wie im Westen Europas. Glänzend erzählt.
Mit spielerischem Scharfsinn hilft uns Adam Soboczynski uns selbst ebenso zu verstehen wie diesen seltsamen Osten Europas. Er erzählt von seiner Jugend in der Bonner und dem Erwachsensein in der Berliner Republik, von der großen Freiheit zwischen den Jahren 1989 und 2022, und wie sie verloren zu gehen droht - in beiden Teilen Europas. Im Osten wird sie von außen bedroht, im Westen durch innere Kämpfe.
Adam Soboczynski zieht als Sechsjähriger aus Polen in die westdeutsche Provinz. Er verlässt mit seinen Eltern die Arbeitersiedlung einer polnischen Chemiefabrik und gelangt in ein fremdes Traumland voller Wunderwerke wie den Ford Capri, die große Trommel Chio Chips und Freiheit. Dass er in seiner neuen Heimat ganz angekommen ist, merkt er Jahre später, als er Deutschland genauso vermieft und unerträglich findet, wie es sich für einen echten Deutschen gehört. Sein Blick wandert immer wieder in den Osten Europas, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur Blüte gelangt und bald schon wieder bedroht wird. Und wer hätte gedacht, dass sich auch die Freiheit im Westen in Gefahr befindet? Durch Trump und die AfD, aber auch durch die allgegenwärtige Empfindlichkeit der Aufklärungs- und Liberalismuskritiker. Ein heiteres, ein melancholisches, ein kluges und gegenwärtiges Buch.
Mit spielerischem Scharfsinn hilft uns Adam Soboczynski uns selbst ebenso zu verstehen wie diesen seltsamen Osten Europas. Er erzählt von seiner Jugend in der Bonner und dem Erwachsensein in der Berliner Republik, von der großen Freiheit zwischen den Jahren 1989 und 2022, und wie sie verloren zu gehen droht - in beiden Teilen Europas. Im Osten wird sie von außen bedroht, im Westen durch innere Kämpfe.
Adam Soboczynski zieht als Sechsjähriger aus Polen in die westdeutsche Provinz. Er verlässt mit seinen Eltern die Arbeitersiedlung einer polnischen Chemiefabrik und gelangt in ein fremdes Traumland voller Wunderwerke wie den Ford Capri, die große Trommel Chio Chips und Freiheit. Dass er in seiner neuen Heimat ganz angekommen ist, merkt er Jahre später, als er Deutschland genauso vermieft und unerträglich findet, wie es sich für einen echten Deutschen gehört. Sein Blick wandert immer wieder in den Osten Europas, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur Blüte gelangt und bald schon wieder bedroht wird. Und wer hätte gedacht, dass sich auch die Freiheit im Westen in Gefahr befindet? Durch Trump und die AfD, aber auch durch die allgegenwärtige Empfindlichkeit der Aufklärungs- und Liberalismuskritiker. Ein heiteres, ein melancholisches, ein kluges und gegenwärtiges Buch.