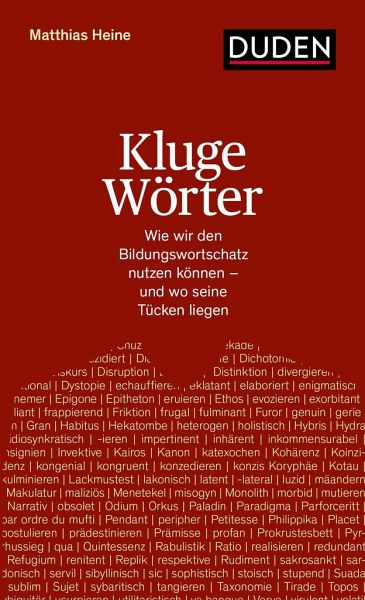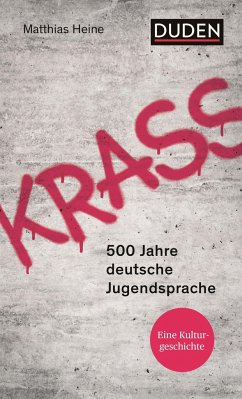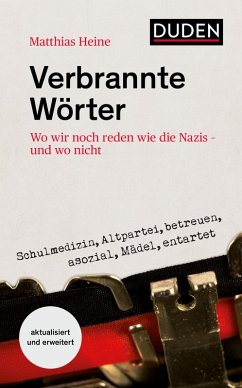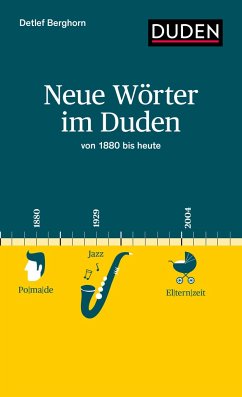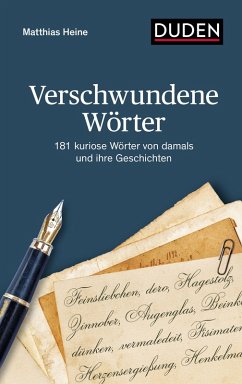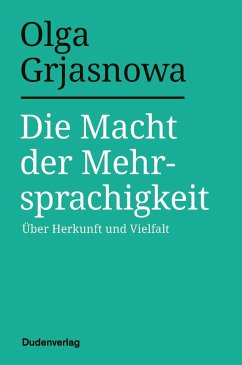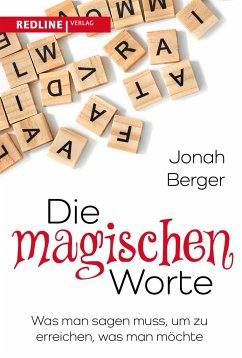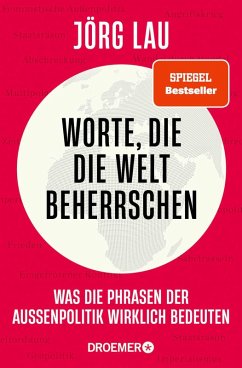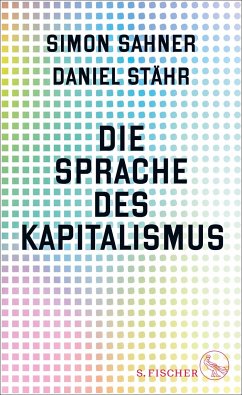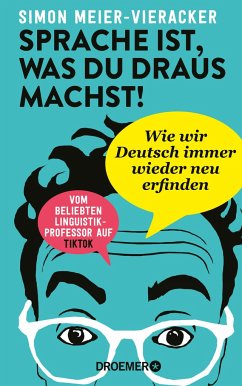Matthias Heine
Gebundenes Buch
Kluge Wörter
Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können - und wo seine Tücken liegen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Matthias Heine ermöglicht einen einfachen Zugang zu gebildeter und gehobener Sprache und nimmt uns mit auf eine Kulturgeschichte der Bildungssprache. Wörter wie "Ambiguität", "Chimäre", "eruieren" und "genuin" werden erklärt in ihrer Geschichte, ihren aktuellen Verwendungsweisen und den damit verbundenen Fallen. Was ist problematisch an "Narrativ" und an "Taxonomie" und wann sind "redundant" oder "latent" passend einzusetzen? Dieser Ritt durch die interessantesten Wörter der deutschen Bildungssprache ermöglicht es, die eigene Sprache aufzubessern und Spannendes über sie zu erfahren.
Matthias Heine, 1961 geboren, arbeitet als Journalist in Berlin. Seit 2010 ist er Kulturredakteur der 'Welt' . Zuletzt erschien von ihm 'Verbrannte Wörter. Wo wir noch so reden wie die Nazis und wo nicht' (2019), 'Krass. 500 Jahre deutsche Jugendsprache' (2021) und 'Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache.' (2022)
Produktdetails
- Duden - Sachbuch
- Verlag: Duden / Duden / Bibliographisches Institut
- Artikelnr. des Verlages: 8914
- Seitenzahl: 285
- Erscheinungstermin: 11. März 2024
- Deutsch
- Abmessung: 211mm x 135mm x 28mm
- Gewicht: 436g
- ISBN-13: 9783411757077
- ISBN-10: 3411757078
- Artikelnr.: 69118211
Herstellerkennzeichnung
Bibliograph. Instit. GmbH
Mecklenburgische Straße 53
14197 Berlin
info@cvk.de
"Dort findet man keine streng gegliederten Wörterbuchartikel, sondern wortbiographische Miniaturen. In einem angenehm lesbaren Bildungsdeutsch geschrieben, führen sie durch die Sprach- und Kulturgeschichte des Deutschen und der Sprachen, in denen viele dieser Wörter wurzeln." Frankfurter Allgemeine Zeitung
Bei dem Buch „Kluge Wörter“ von Matthias Heine handelt es sich um eine Zusammenstellung von dem Autor interessant erscheinenden Wörtern, die in kurzen, essayistischen Aufsätzen vorgestellt werden. Dabei beleuchtet er die Geschichte der Wörter, ihre Entstehung sowie …
Mehr
Bei dem Buch „Kluge Wörter“ von Matthias Heine handelt es sich um eine Zusammenstellung von dem Autor interessant erscheinenden Wörtern, die in kurzen, essayistischen Aufsätzen vorgestellt werden. Dabei beleuchtet er die Geschichte der Wörter, ihre Entstehung sowie ihre frühere und aktuelle Verwendung.
Von veralteten Begriffen über selten genutzte Spezialbegriffe bis hin zu inflationär gebrauchten Modewörtern bietet das Buch eine breite Palette an interessanten Informationen. Die Aufsätze sind gut geschrieben und erläutern die Geschichte und den Gebrauch der Wörter auf anschauliche Weise.
Allerdings bleibt ein Kritikpunkt: Der Untertitel „Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können - und wo seine Tücken liegen“ wird nicht erfüllt. Obwohl die Aufsätze interessante Informationen bieten, fehlt es an praktischen Anwendungsbeispielen oder konkreten Informationen, wie man den aufgeführten Wortschatz im Alltag nutzen kann. Das ist schade, denn das Buch hätte das Potenzial, den / die Leser*in zu inspirieren, den Bildungswortschatz in den eigenen Sprach- und Schreibgebrauch zu integrieren. Wenn der Autor diesen Aspekt stärker betont und praktische Anwendungsstrategien anbieten würde, wäre der Mehrwert des Buchs noch gesteigert gewesen. Weiterhin hätte ich mir eine zusätzliche, die Essays ergänzende stichpunktartige Erläuterung jedes Worts im Stil eines Wörterbuchs gewünscht, vielleicht mit Etymologie, Daten des ersten Auftreten, Übersetzung in „alltägliches“ Deutsch, Verwechslungsgefahr mit anderen Wörter usw.
Fazit: Ein durchaus empfehlenswertes Buch, das Leser*innen, die sich für die Geschichte und Bedeutung von Wörtern interessieren, viele bemerkenswerte Informationen bietet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
In dem Buch „Kluge Wörter“ des Berliner Journalisten Matthias Heine wurden einige interessante und auch weniger bekannte Wörter der Bildungssprache bzw. gehobenen Sprache gesammelt.
Es beginnt mit einer kleinen Einführung, dann werden die in alphabetischer Reihenfolge …
Mehr
In dem Buch „Kluge Wörter“ des Berliner Journalisten Matthias Heine wurden einige interessante und auch weniger bekannte Wörter der Bildungssprache bzw. gehobenen Sprache gesammelt.
Es beginnt mit einer kleinen Einführung, dann werden die in alphabetischer Reihenfolge gegliederten „Klugen Wörter“ erklärt. Wo kommt das Wort her, welchen Ursprung hat es, wie wurde es früher gebraucht und für was steht es heute. Dies geschieht in einer recht ausführlichen, recht gehobenen, aber auch humorvollen Art und Weise. Zum immer mal durchblättern bestens geeignet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Allein der Titel „Kluge Wörter“ regt zum Nachdenken an – was sind „Kluge Wörter“? Und gibt es diese überhaupt? Kann ein Wort an sich überhaupt „klug“ sein, oder ist hierzu ein Verstand nötig? Diese Gedanken gingen mir als erstes …
Mehr
Allein der Titel „Kluge Wörter“ regt zum Nachdenken an – was sind „Kluge Wörter“? Und gibt es diese überhaupt? Kann ein Wort an sich überhaupt „klug“ sein, oder ist hierzu ein Verstand nötig? Diese Gedanken gingen mir als erstes durch den Kopf. Matthias Heine versteht darunter Wörter, die der Bildungssprache zuzurechnen sind und die nicht selten als Distinktionsmerkmal dienen.
Der Autor hat eine bunte Auswahl an bildungssprachlichen Wörtern zusammengetragen, die sowohl recht geläufige wie aufoktroyieren, fulminant, impertinent oder misogyn umfasst, als auch eher Unbekanntes wie bramarbasieren, Prokrustesbett oder idiosynkratisch. Zu jedem Eintrag erfährt man als Leser*in Wissenswertes und oft Erstaunliches zu Herkunft, Bedeutung und Verwendung. Dies fand ich sehr interessant, insbesondere da sich die Letzteren im Laufe der Zeit manchmal gewandelt oder sogar ins Gegenteil verkehrt haben (etwa frugal). Ergänzt werden diese Erläuterungen durch diverse Zitate. Dank des angenehmen Schreibstils mit humorvollem Unterton wirkt das Buch keineswegs trocken, sondern liest sich sehr vergnüglich.
Dennoch erfüllt das Buch nicht ganz die Erwartungen, die ich aufgrund der Kurzbeschreibung hatte. Diese versprach eine „einfachen Zugang“ zu gebildeter Sprache und Erklärungen zu „aktuellen Verwendungsweisen und den damit verbundenen Fallen“. Dieses Versprechen löst das Buch nur teilweise ein. Die vom Autor ausgewählten Zitate sind häufig mehrere Jahrhunderte alt und entstammen der Philosophie und Hochliteratur. Dem Verständnis ist dies nicht zuträglich. Während die historischen Bedeutungen bzw. die Wortherkunft genau erläutert werden, fehlt oft eine präzise Beschreibung der heutigen Verwendung samt aussagekräftiger moderner Beispiele. Das ist jedoch nötig, um ein Gefühl für ein Wort zu bekommen und es auch sicher und korrekt in den aktiven Wortschatz einzubinden. Nichts ist sprachlich peinlicher als ein falsch benutztes Fremdwort. Ich musste hier immer wieder nebenbei noch Wikipedia zu Rate ziehen, um mir die entsprechenden Informationen zu holen. Ebenso habe ich Hinweise auf Wörter vermisst, mit denen es leicht zu Verwechslungen kommen kann. Bei „avisieren“ vs. „anvisieren“ merkt Heine dies an, bei „dezidiert“ hingegen fehlt ein Verweis auf „dediziert“.
Fazit: Ein unterhaltsames und aus sprachhistorischer Sicht interessantes Buch, als Nachschlagewerk und zur Erweiterung des aktiven Wortschatzes nur bedingt geeignet.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
In jungen Jahren habe ich mich häufig gegen „Fremdwörter“ gesträubt, weil ich der Meinung war, dass die deutsche Sprache so umfangreich ist und Erklärungen ganz vieler Begriffe einfach gar keine Fremdwörter benötigen, um sie zu verstehen. Aber dennoch bin …
Mehr
In jungen Jahren habe ich mich häufig gegen „Fremdwörter“ gesträubt, weil ich der Meinung war, dass die deutsche Sprache so umfangreich ist und Erklärungen ganz vieler Begriffe einfach gar keine Fremdwörter benötigen, um sie zu verstehen. Aber dennoch bin ich von Natur aus neugierig und lernbegeistert.
Aufmerksam geworden auf „Kluge Wörter“ bin ich durch diesen Satz in der Inhaltsbeschreibung: „Matthias Heine ermöglicht einen einfachen Zugang zu gebildeter und gehobener Sprache und nimmt uns mit auf eine Kulturgeschichte der Bildungssprache.“ Es ist zwar nicht so, dass ich „einen einfachen Zugang zu gebildeter und gehobener Sprache“ gefunden habe, aber dennoch habe ich viel Interessantes und Wissenswertes zu einigen der ausgewählten Wörter im Blick auf Herkunft und Verwendungsweise erfahren.
Aus dem Begriff „Kluge Wörter“ bin ich allerdings nicht schlau geworden. Für mich bleiben die Fragen: Was sind „kluge Wörter“? Sind „kluge Wörter“ wirklich nur Fremdwörter? Können nicht auch deutsche Begriffe „kluge Wörter“ sein?
„Kluge Wörter“ bekommt einen Platz im Regal „Nachschlagewerke“. Es ist kein Buch, das ich einmal lese und am Ende zufrieden damit sein kann, „die eigene Sprache aufzubessern“, sondern es bietet sich an, immer mal wieder drin zu blättern und Neues zu entdecken. Bildungssprachlich wird sich für mich nach diesem Buch nichts ändern.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
"Kluge Wörter: Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können - und wo seine Tücken liegen" von Matthias Heine ist eine Sammlung von 160 Wörtern, die als bildungssprachlich und zum Teil "schwer" gelten. Gleich zu Beginn geht der Autor auch auf die Tücken …
Mehr
"Kluge Wörter: Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können - und wo seine Tücken liegen" von Matthias Heine ist eine Sammlung von 160 Wörtern, die als bildungssprachlich und zum Teil "schwer" gelten. Gleich zu Beginn geht der Autor auch auf die Tücken des Gebrauchs von bildungssprachlichen Wörtern ein, insbesondere da dieser manchmal als angeberisch gilt und negativ konnotiert ist. Zur Auswahl der Wörter schreibt der Autor, dass er erklärungsbedürftige Wörter gegenüber solchen, die allgemein bekannt sind, bevorzugt. Je nachdem, wie stark man selbst Gebrauch von bildungssprachlichen Wörtern benutzt, werden einem viele der Wörter dennoch sehr bekannt vorkommen.
Die Auswahl reicht von ab ovo und abundant über aufoktroyieren, Diadochenkämpfe, Epitheton, Gran, inkommensurabel bis hin zu Orkus, profan, Rabullistik, sibyllinisch und endet mit Zäsur und Zerberus. Je nach Wort reichen die Wurzeln sehr weit in die Geschichte zurück, aber in manchen Fällen, wie beim Wort Dystopie schreibt der Autor: "Damit wir dieses Wort brauchten, musste uns erst der optimistische Blick auf die Zukunft abhandenkommen." (S. 91) So ist hin und wieder auch etwas Schmunzeln beim Lesen garantiert.
Mein Fazit: Ein schönes Sachbuch für alle, die sich für die Sprache an sich und Bildungssprache im Besonderen interessieren und das eine oder andere neue (alte) Wort lernen möchten, um sich selbst oder Andere zu "tangieren" ;)
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ich habe eine große Affinität zu Sprache und Worten. Ich liebe es, über Bedeutung, Herkunft und Zusammenhänge nachzudenken und zu lesen. Deshalb hatte ich mich auf die Lektüre dieses Buches wirklich gefreut, versprechen Titel und Untertitel „Kluge Wörter – …
Mehr
Ich habe eine große Affinität zu Sprache und Worten. Ich liebe es, über Bedeutung, Herkunft und Zusammenhänge nachzudenken und zu lesen. Deshalb hatte ich mich auf die Lektüre dieses Buches wirklich gefreut, versprechen Titel und Untertitel „Kluge Wörter – Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können – und wo seine Tücken liegen“ genau das. Und auch die Inhaltsbeschreibung ließ erhoffen, dass man sich nach der Lektüre besser ausdrücken kann, ohne jedoch überheblich zu wirken.
Leider wurden meine Erwartungen enttäuscht.
Der erste Eindruck des Buches ist solide, ein schlichter und dennoch ordentlicher Einband. Doch schon beim Lesen stellt man fest, dass hier nicht wirklich sorgfältig gearbeitet wurde, denn das Buch enthält relativ viele orthografische Fehler.
Die Einleitung fand ich inhaltlich ansprechend, wenn auch zu kurz. Hier hätte ich mir durchaus etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht. Außerdem setzte die verwendete Sprache teilweise voraus, dass man die Lektüre des Buches eigentlich gar nicht „nötig“ hatte. Womit ich sagen will, dass der Autor bereits in der Einleitung eine recht gehobene Sprache nutzte.
Im zweiten Teil widmet sich der Autor dann der „Erklärung“ der klugen Wörter. Die Auswahl der Wörter erschien mir sehr willkürlich. Warum hat es wohl das eine Wort in die Auflistung geschafft und das andere nicht? Viele Worte waren sehr „altbacken“. Drückt man sich bildungssprachlich wirklich eher wie im letzten Jahrhundert aus.
In den Einträgen erläutert der Autor dann meist die Herkunft und ggf. wie sich der Gebrauch und auch die Bedeutung verändert hat. Teilweise führt er Zitate an, in denen das Wort verwendet wurde. Jedoch fehlen mir meist tatsächliche aktuelle Anwendungsbespiele und die Tücken, die im Untertitel versprochen wurden.
Vielleicht bin ich nicht gebildet genug, um den Ausführungen des Autors folgen zu können. Zumindest bei einigen Worten wusste ich zwar nach der Lektüre des Eintrags so manches über die Geschichte des Wortes, aber trotzdem nicht, was denn nun konkret bedeutet.
Außerdem hätte ich mir eine Art Stichwortverzeichnis gewünscht. Denn mit etwas Glück findet man an bildungssprachliches Wort, das einem irgendwo begegnet und dessen Bedeutung man nicht sicher kennt im Buch und kann es nachlesen. Umgekehrt aber, wenn ich etwas bestimmtes ausdrücken möchte, weiß ich nicht, wo ich nachschlagen muss, um ein passendes Wort zu finden, das ich dafür verwenden könnte.
Insofern hilft das Buch nicht, den Bildungswortschatz zu nutzen, sondern höchstens ihn besser zu verstehen.
Insgesamt würde ich 2,5 Sterne vergeben, weshalb ich auf 3 Sterne aufrunde. Ich hätte mir das Buch nicht gekauft, hätte ich vorher gewusst, was mich erwartet. Ich kann hier leider keine Kaufempfehlung aussprechen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für