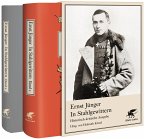Die Erlebnisse Ernst Jüngers vom Januar 1915 bis zum August 1918 an der Westfront spiegeln sich in den »Stahlgewittern« wieder: vom Grabenkrieg in der Champagne und der Schlacht bei Cambrai bis hin zu den Stoßtruppunternehmen in Flandern und zuletzt der Verleihung des Ordens Pour le mérite nach seiner Verwundung.
»'In Stahlgewittern' machte ihn zum Helden einer Generation junger Offiziere, die alles gegeben hatten und am Ende bestenfalls das Eiserne Kreuz davontrugen. Gide pries es als 'das schönste Kriegsbuch, das ich je las.' Tatsächlich ähnelt es keinem anderen Buch der damaligen Zeit - keine Spur von den pastoralen Meditationen eines Siegfried Sassoon oder Edmund Blunden, kein Anflug von Feigheit wie bei Hemingway, kein Masochismus wie bei T. E. Lawrence und kein Mitleid wie bei Remarque.«
Bruce Chatwin
»'In Stahlgewittern' machte ihn zum Helden einer Generation junger Offiziere, die alles gegeben hatten und am Ende bestenfalls das Eiserne Kreuz davontrugen. Gide pries es als 'das schönste Kriegsbuch, das ich je las.' Tatsächlich ähnelt es keinem anderen Buch der damaligen Zeit - keine Spur von den pastoralen Meditationen eines Siegfried Sassoon oder Edmund Blunden, kein Anflug von Feigheit wie bei Hemingway, kein Masochismus wie bei T. E. Lawrence und kein Mitleid wie bei Remarque.«
Bruce Chatwin

Eine editorische Großtat: Jüngers "In Stahlgewittern"
Er hätte sein Kriegstagebuch "In Stahlgewittern" eigentlich gerne "Rot und Grau" genannt, hat der Schriftsteller Ernst Jünger 1995 gesagt, in Anlehnung an Stendhals "Rot und Schwarz". Bei Stendhal sagt man immer, Rot stehe für das Militär, Schwarz für den Klerus. Rot und Grau wären beides Kriegsfarben gewesen: das Stahlgrau der Waffen, das Feldgrau der deutschen Uniformen, das der Kriegslandschaft und das Rot vielleicht ganz einfach das vergossene Blut.
Rot und Grau jedenfalls waren am Donnerstagabend die beiden Bände, die - noch als Druckfahnen - in den Redaktionsräumen der Zeitschrift "Merkur" in Berlin-Charlottenburg auf den Tischen lagen. Der Germanist Helmuth Kiesel stellte dort die von ihm edierte historisch-kritische Ausgabe der "Stahlgewitter" vor, die Ende Oktober in den Buchhandel kommen wird und am 10. September auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Der Schauspieler Ulrich Matthes wird dort den Text lesen und hat schon Übung darin: In Volker Schlöndorffs "Das Meer am Morgen" war er im vergangenen Jahr als Ernst Jünger zu sehen.
Was Helmuth Kiesel geleistet hat, ist bewunderungswürdig und die Ausgabe für all jene, die "In Stahlgewittern" nicht einfach lesen, sondern sich genau damit beschäftigen wollen, spektakulär. Sie klärt, längst überfällig, auch ein Missverständnis, das mit der Werkausgabe, die unter Jüngers Mitwirkung 1978 bei Klett Cotta erschien, in die Welt kam. Dort nämlich stand vor dem Text der "Stahlgewitter" im ersten Band die Jahreszahl 1920. Was man auf den darauffolgenden Seiten lesen konnte, waren aber gar nicht die "Stahlgewitter" von 1920. Es war die siebte von Jünger erstellte Fassung. Ein völlig anderer Text.
Mit "ameisenhaftem Trieb, am beschriebenen und bedruckten Papier herumzuminieren", so nannte er das selbst einmal, hat Ernst Jünger sein Kriegstagebuch immer neuen Umstellungen, Einfügungen und Streichungen unterzogen. Von einer "Revisionsmanie" ist in der Forschung deshalb gesprochen und natürlich auch versucht worden, diesen "ameisenhaften Trieb" zu deuten: Die lebenslange Korrekturarbeit sei ein nach Vollendung strebender Prozess, behaupteten die einen. Sie sei eine politische Angelegenheit, meinten - insbesondere in den Lektüren der siebziger Jahre - die anderen. Jünger, der die extrem nationalistischen Passagen, die er 1924 in sein Werk einfügte, 1934 wieder löschte, weil er sich mit den Nazis nicht gemein machen wollte, habe das Buch je nach politischer Lage umgeschrieben. Wieder andere lasen seine Retuschierarbeit als ästhetische Aufrüstung mit Plötzlichkeitsmomenten, so dass sich der Text wie eine Art Schocktraining lesen lasse, wie ein Trimm-dich-Pfad, auf dem der "Neue Mensch" für die gefährlichen Landschaften der Moderne ausgebildet werden sollte.
Bisher musste, wer solche Überlegungen anstellen oder nachvollziehen wollte, sich die verschiedenen Ausgaben mühsam besorgen, Kopien anfertigen, Passagen ausschneiden und nebeneinanderlegen. Jetzt gibt es - dank Helmuth Kiesel - auf 1250 Seiten in zwei Bänden alles in einem Buch. Kiesel hat sich für einen Paralleldruck entschieden: Jeweils auf der linken Seite der Ausgabe findet der Leser den Text der Erstausgabe von 1920 und rechts den von 1978. Die dazwischenliegenden Fassungen werden zweimal präsentiert: in Form eines textgeschichtlichen Apparatbands (das ist der zweite Band der Ausgabe), der alle Veränderungen registriert. Und in Form verschiedenfarbiger Einfügungen im Text des ersten Bandes. Alles, was rot ist, stammt von 1922, dunkelrot von 1924, dunkelblau von 1934, hellblau von 1935 und grün von 1961.
Was dabei herauskommt, ist nicht nur die farbenfroheste Ernst-Jünger-Ausgabe, die es jemals gegeben hat. Es ist auch ein einmaliges editorisches Projekt, das Lesern die Möglichkeit gibt, die "Stahlgewitter" buchstäblich historisch und kritisch zu lesen und auch biographische Rückschlüsse zu ziehen. Orte der Selbstbespiegelung des Autors Jünger sind in diesem lebenslangen Umschreibungsprozess insbesondere die jeweiligen Vorworte der Ausgaben: "Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte, und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder Wein", liest man etwa im Vorwort der fünften Auflage.
Immer wieder hat Jünger bei seinen Bearbeitungen die Notizhefte aus den Gräben zur Hand genommen, die seinem Buch zugrunde liegen und im Literaturarchiv in Marbach aufbewahrt werden. Da sind sie dann auch wieder, die Farben Grau und Rot, der vertrocknete Schlamm, Blut oder Wein. Es sind die Farben seines nie endenden Krieges.
JULIA ENCKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Stephan Speicher hält die "Stahlgewitter" für ein wichtiges Buch. Noch wichtiger, lesbar auch für Nichtspezialisten, findet er die von Helmuth Kiesel herausgebrachte historisch-kritische Ausgabe. Für Speicher ein Musterbeispiel an Lesbarkeit und Erkenntnisreichtum. Zum einen, da es farbige Absetzungen ermöglichen, wirklich jede Änderung, jede Variante des Textes, die der Autor verfasst hat, nachzuvollziehen. Zum anderen, da Speicher offenbar kein anderes Buch kennt, das den Gang der Humanisierung eines Autors so vor Augen führt, vom, nun ja, kriegsinteressierten Landsknecht zum beinahe melancholischen Skeptiker der eigenen Erinnerung. Besonders der auf jeder Doppelseite mögliche Vergleich zwischen Erstausgabe und Ausgabe letzter Hand hat es Speicher angetan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

die Arbeit am Text
Ernst Jüngers Weltkriegs-Buch „In Stahlgewittern“
ist in einer kritischen Ausgabe erschienen
VON STEPHAN SPEICHER
Wer in den 1970er oder 1980er Jahren Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ lesen wollte, machte eine merkwürdige Erfahrung. Der umstrittene Autor – die Verleihung des Goethepreises 1982 machte noch gehörigen Ärger – erschien in diesem Buch, das doch das skandalisierteste war, weit weniger blutdürstig als erwartet. Man wusste aber auch, dass Jünger seine Werke immer wieder überarbeitet hatte, er selbst sprach von seinem „ameisenhaften Trieb“, an den eigenen Texten „herumzuminieren“. Wenn die Fassungen von 1961 und 1978 gar nicht kriegstreiberisch wirken, wenn sie im Gegenteil einen grauenvollen Eindruck von der Wirklichkeit des Geschehens vermitteln, lag das möglicherweisen an glättenden Bearbeitungen, die der Autor, besserer Einsicht oder auch bloßem Opportunismus folgend, vorgenommen hatte? Man hätte es gern an der Erstausgabe überprüft. Doch die war unauffindbar, in keiner öffentlichen Bibliothek zu bekommen.
Der Streit um Jünger hat sich beruhigt, die Frage nach der Erstausgabe aber blieb interessant. Nun ist sie beantwortet. Der Heidelberger Germanist Helmuth Kiesel hat eine historisch-kritische Ausgabe der Stahlgewitter vorgelegt. Solche Ausgaben, die die Textgeschichte mit allen Varianten dokumentieren, sind üblicherweise etwas für Spezialisten. Hier ist es anders. Was Kiesel und seine Kollegen geleistet haben, ist von Belang nicht bloß für den ohnedies zu allem entschlossenen Jünger-Leser.
Der erste der beiden Bände bietet den Text, auf der linken Seite den der Erstausgabe von 1920, auf der rechten Seite den der Ausgabe letzter Hand (1978). Was der Autor beginnend mit der 2. Auflage von 1924 einfügte, später aber wieder strich, ist, farbig abgesetzt und mit den Daten der Einfügung und Streichung versehen, in den Text der Erstausgabe eingefügt. Und auch auf den rechten Seiten sind die Einfügungen, die es bis in die Ausgabe letzter Hand schafften, datiert. Das mag verwickelt klingen, ist aber sehr übersichtlich und ermöglicht es, ständig hin- und herzuspringen, ohne den ursprünglichen Lektürezusammenhang zu verlieren.
Wie steht der Jünger des Jahres 1920 vor uns? Jedenfalls nicht als Reklameredner des Tötens. Die Schreie der Verwundeten werden dem Leser nicht erspart, ebenso wenig der Eindruck der unbestatteten Leichname, das widerstrebende Treten auf „die weichen, nachgebenden Körper“, ihr süßlicher Verwesungsgeruch. Dass der Stoßtrupp von „Blutdurst, Wut und Alkoholgenuss“ angetrieben wird, ist kein Loblied auf die Kämpfer. Nicht erst die späteren Fassungen lassen verstehen, warum die „Stahlgewitter“ so unverdächtige Kritiker beeindruckten wie Erich Maria Remarque („ohne jedes Pathos“), Johannes R. Becher („das unbarmherzigste, das brutalste und nackteste Kriegsbuch“) oder Paul Levi: „Kaum ist eine furchtbarere Anklage gegen den Krieg geschrieben als dieses Buch eines Mannes, der zum Kriege positiv eingestellt ist.“
Die „Stahlgewitter“ als Buch gegen den Krieg zu lesen, das lief der Autorenintention zuwider, aber nicht vollständig. Das Lob von links traf die Absicht Jüngers zur Objektivität oder Sachlichkeit: „Ich lege keine Helden-Kollektion vor. Ich will nicht beschreiben, wie es hätte sein können, sondern wie es war.“ Dazu gehört die Achtung des Gegners. Der Krieg ist Bewährung für den Einzelnen und die Gesamtheit, er ist nicht Kreuzzug für eine moralisch überlegene Sache, für deutsche Kultur etwa versus englische Krämerhaftigkeit. Dass seine Untergebenen im Gegner einen „persönlichen Feind“ sehen, findet Jünger falsch: „merkwürdig, wie wenig objektiv sie den Krieg auffassen “.
Die Fassung von 1920 zeigt in manchen Zügen den noch unerfahrenen Autor. Es gibt wackelnde Bilder, konventionelle Redensarten („Venus entzog dem Mars manchen Diener“ – es geht um Geschlechtskrankheiten), gedankliche Widersprüche. Und doch ist es ein bedeutendes Buch. Wie es sich in knapp 60 Jahren weiterentwickelte, ist kaum weniger interessant. Sechsmal hat Jünger sein Buch überarbeitet, durchgreifend 1924, 1935 und 1961. Die Fassung von 1924, entstanden unter dem Eindruck des „Ruhrkampfs“, nationalisiert den Krieg. „Unserem Schutz fühlen wir die wahren, die geistigen Güter des Volkes anvertraut (. . .) solange noch im Dunkel die Klingen blitzen und flammen, soll es heißen: Deutschland lebt und Deutschland soll nicht untergehen!“
Die nationalen Ausbrüche werden 1934 ziemlich vollständig wieder getilgt, Jünger, der sich in dieser Zeit aus Berlin nach Goslar zurückzog, wollte sein Buch der nationalsozialistischen Ausbeutung entziehen. Zugleich werden längere reflektierende Passagen eingeführt, die das Erleben des kämpfenden Subjekts analysieren. Die letzte große Überarbeitung 1961 humanisiert das Buch weiter, der noch verbliebene Landsknechtston wurde reduziert, der Autor spricht auch über das Fortwirken der Eindrücke.
Mit Hilfe der neuen Ausgabe lässt sich in jedem Moment der Lektüre sehen, was der Autor in mehr als 50 Jahren einfügte und strich. Gelegentlich muss man auch das Variantenverzeichnis im zweiten Band zu Rate ziehen. Was die einzelnen Änderungen motivierte, bleibt der Interpretation des Lesers überlassen, es fehlt an Selbstzeugnissen, die darüber Auskunft gäben. In der Jünger-Forschung konkurrieren zwei Thesen zu den Bearbeitungstendenzen. Die Finalitätsthese nimmt an, dass der Autor nach der gültigen literarischen Gestalt des Buches suchte, die Opportunitätsthese sieht in den Bearbeitungen Versuche, immer wieder neu auf die wechselnden politischen Verhältnisse und die damit wechselnde eigene Haltung zu reagieren.
Finalität und Opportunität sind keine strenge Alternative. Dass Jünger 1924 und 1934 politischen Beweggründen folgte, liegt auf der Hand. War es auch 1961 so? Sein früherer Sekretär Armin Mohler warf es ihm vor. Jünger passe sich an den westdeutschen Zeitgeist an. Das kann sein. Aber es gibt doch eine große Tendenz, die seit den dreißiger Jahren die Bearbeitungen prägt. Krieg, Gefahr, Tod werden als Grenzerfahrung beschrieben: „eine Einweihung, die nicht nur die glühenden Kammern des Schreckens öffnete, sondern auch durch sie hindurchführte“. Solche Grenzüberschreitungen haben Jünger immer und immer stärker beschäftigt, man denke an seine Drogenexperimente oder die Nebenbeschäftigung mit den letzten Worten Sterbender, in denen er die Ahnung neuer Welten suchte.
Eine historisch-kritische Ausgabe der „Stahlgewitter“, 1200 Seiten dick, das sieht aus wie eine jener Hybrid-Editionen, von denen man sich fragt, ob sie nicht nur Nutzer, sondern auch Leser finden. Hier ist es anders, sollte jedenfalls anders sein. Denn der Leser sieht ein hochproblematisches Buch sich in knapp 60 Jahren entwickeln. Er erkennt Opportunitäten, aber er begreift auch, wie Jünger sich immer neu darüber im Klaren zu werden bemüht, was die Kriegserlebnisse, die er als junger Mann hatte, mit ihm in den folgenden Jahrzehnten gemacht haben.
Schon in der ersten Fassung hatte Jünger von dem Anblick eines Toten gesprochen, den er „quer durch den Schädel getroffen hatte“. Und er fügte hinzu: „Ein merkwürdiges Gefühl, einem Menschen ins Auge zu sehen, den man selbst getötet.“ 1961 schreibt er: „Oft habe ich später an ihn zurückgedacht, und mit den Jahren häufiger. Der Staat, der uns die Verantwortung abnimmt, kann uns nicht von der Trauer befreien; wir müssen sie austragen. Sie reicht tief in die Träume hinab.“
Ernst Jünger: In Stahlgewittern. Historisch-kritische Ausgabe. Herausgegeben von Helmuth Kiesel. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2013. Zwei Bände, zus. 1245 Seiten, 88 Euro.
Lange war die Erstausgabe
unauffindbar, in öffentlichen
Bibliotheken nicht vorhanden
Porträt des Autors in der zweiten Auflage von „In Stahlgewittern“, Berlin 1922. Foto: oh
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Kiesels Edition stellt sowohl in der philologischen Aufbereitung als auch in der souveränen Kommentierung eine herausragende Leistung dar.« Jan Robert Weber, Edition in der Kritik, Februar 2015 »Die Edition erfüllt alle Ansprüche. Sie gestattet es dem Leser erstmals, die zuweilen erheblich voneinander abweichenden sieben Fassungen des Textes zu vergleichen und die Bemühungen des Autors um sprachliche Präzisierung zu verfolgen.« Urs Bitterli, NZZ am Sonntag, 25.5.2014 , -