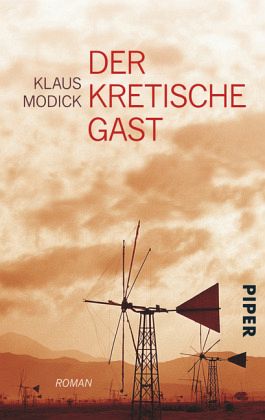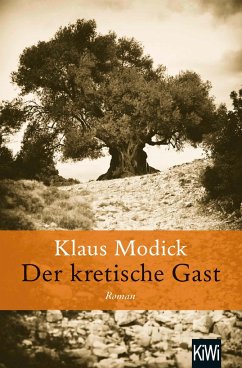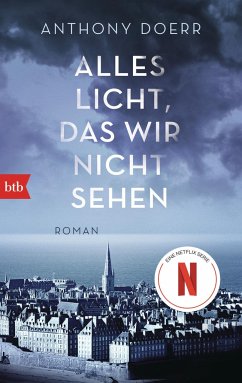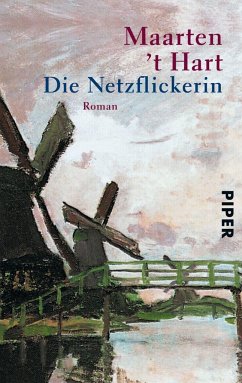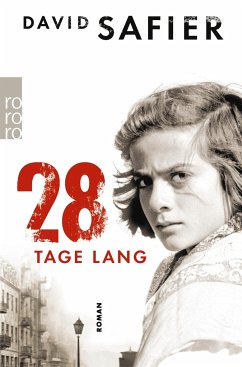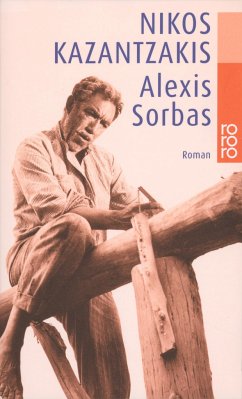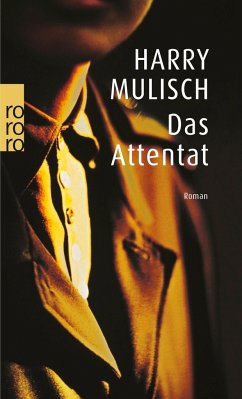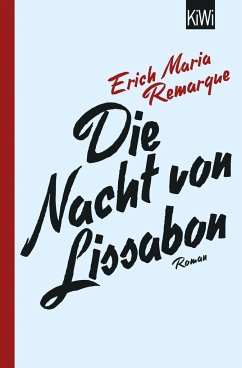Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Kreta 1943: Der deutsche Archäologe Johann Martens soll im Auftrag der Wehrmacht die Kunstschätze der besetzten Insel katalogisieren. Der Einheimische Andreas wird zu seinem Fahrer und Führer, doch verbindet beide bald mehr. Die Lebensart der Kreter und noch mehr Andreas' schöne Tochter Eleni schlagen Martens immer mehr in ihren Bann. Als die Deutschen eine Razzia planen, muss sich Johann entscheiden, wo er steht.
Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach unter anderem als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach einigen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Nicolas-Born-Preis und der Bettina-von-Arnim-Preis. Zudem war er Stipendiat der Villa Massimo. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Romanen, darunter "Der kretische Gast", "Die Schatten der Ideen" und "Sunset".

©Peter Kreier
Produktdetails
- Piper Taschenbuch Bd.4206
- Verlag: Piper
- 7. Aufl.
- Seitenzahl: 452
- Erscheinungstermin: 21. Februar 2005
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 120mm x 26mm
- Gewicht: 328g
- ISBN-13: 9783492242066
- ISBN-10: 3492242065
- Artikelnr.: 12742857
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.11.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.11.2003Die Spur der Weine
Klaus Modick sucht das Land der Griechen mit der Kehle
Die Weltgeschichte ist "ein Bilderbuch, das die heftigste und blindeste Sehnsucht der Menschen spiegelt: die Sehnsucht nach Vergessen". Das liest in Klaus Modicks neuem Roman der angehende Historiker Lukas, und will es sich merken. An dieser Stelle weiß der Leser schon, daß einmal mehr an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte erinnert werden soll. Es geht um die deutsche Besatzungsherrschaft auf Kreta 1941 bis 1945, den Widerstand dagegen und selbstverständlich um die Liebe in den Zeiten des Krieges. Modick hat für das Buch ausgiebig recherchiert und läßt historische Personen auftreten, die Romanhandlung sei aber im wesentlichen frei
Klaus Modick sucht das Land der Griechen mit der Kehle
Die Weltgeschichte ist "ein Bilderbuch, das die heftigste und blindeste Sehnsucht der Menschen spiegelt: die Sehnsucht nach Vergessen". Das liest in Klaus Modicks neuem Roman der angehende Historiker Lukas, und will es sich merken. An dieser Stelle weiß der Leser schon, daß einmal mehr an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte erinnert werden soll. Es geht um die deutsche Besatzungsherrschaft auf Kreta 1941 bis 1945, den Widerstand dagegen und selbstverständlich um die Liebe in den Zeiten des Krieges. Modick hat für das Buch ausgiebig recherchiert und läßt historische Personen auftreten, die Romanhandlung sei aber im wesentlichen frei
Mehr anzeigen
erfunden.
Diese beginnt 1943 auf Kreta. Der junge deutsche Archäologe Johann Martens soll auf der besetzten Insel erkunden, welche Kunstgegenstände sich als Beutegut für Hitlers Germanisches Museum eignen. Im Verhältnis zu seinem griechischen Führer erlebt er die seit der Antike bekannte Doppelbedeutung von "Xenos" als Fremder und Gast. Als er sich auch noch in die schöne Eleni verliebt, wird ihm seine Doppelrolle zur Identitätsfrage: "Man weiß nicht, wessen Freund man ist. Man weiß auch nicht mehr, wessen Feind man ist. Ich weiß nicht einmal mehr genau, wer ich überhaupt bin." Da hat er, in einer ehrwürdigen Tradition seit Winckelmann und Goethe, schon das Griechentum zum Ideal der Lebenskunst erhoben. Als er seinen Führungsoffizier Leutnant Friedrich Hollbach schließlich bei der Ermordung von Zivilisten beobachtet, ist sein Schicksal entschieden.
Modick verknüpft diesen Hauptstrang in Verdoppelung des Erinnerungsthemas mit einer im Jahre 1975 spielenden detektivischen Vätererkundung im Stil der siebziger Jahre. Lukas, der Sohn Hollbachs, findet auf dem Hamburger Flohmarkt zufällig ein paar alte Fotos mit unleserlicher Aufschrift, die ihn erst in ein griechisches Lokal und dann auf die kretische Spur führen. "Und ganz nebenbei auch noch seinen Vaterkomplex bewältigen?" Auch er verliebt sich in eine schöne Griechin, nämlich ausgerechnet in die Tochter von Eleni und Johann. "Eine Wahnvorstellung, eine fatal fixe Idee, daß es keine Zufälle gab im Leben?" Am schicksalhaften und geschichtsträchtigen Ort führt Modick schließlich die beiden Handlungsstränge melodramatisch zusammen.
Bei der Darstellung der Schauplätze greift Modick tief in die Kiste des Malerischen und der nordischen Griechenlandsehnsucht. "Jetzt ging im Osten die Sonne auf, und aus dem dämmrigen Blau, in das Meer und Berge getaucht waren, stiegen Farben und Umrisse. Zuerst verwandelte sich das Wasser in ein lichtdurchflutetes Blau, der Saum des Strandes zu blendendem Weiß, dann fanden die Felsen ihr tönernes Braun und die Oliven, Eichen und Zypressen ihre Grünschattierungen." Die Sinnlosigkeit des Krieges soll sich vor allem im Appell an die Sinnlichkeit erweisen. Es riecht "nach Thymian und Lavendel, Erde und Früchten, Honig und Ziegenmilch". Aus dampfenden Schüsseln wird Lammfleisch mit Fladenbrot gegessen, man trinkt "reichlich Retsina" und raucht "Unmengen griechischer Zigaretten der Marke Papastratos". Und vom Raki wird schon vormittags nachgeschenkt.
Die aufständischen Griechen sind bei Modick so pittoresk griechisch wie Schillers Räuber räuberisch. "Er trug über weißem Hemd eine bestickte Weste, eine merkwürdige Pluderhose und hochschäftige Stiefel, und quer über seinen Knien lag ein Gewehr, auf dessen Doppellauf er die Hände stützte. Um die Stirn hatte er eine Art Turban oder ein Tuch geschlungen, dessen Fransen ihm auf die Augenbrauen fielen." Schnell zuckt da die Hand zum Messergriff, aber die Dialoge der feurigen Männer fallen zwecks historischer Information des Lesers gelegentlich ziemlich hölzern aus: ",Hört auf, euch selbst zu zerfleischen, solange wir echte Feinde haben. Mir ist es egal, ob jemand Kommunist ist. Ich will ein freies Kreta, sonst gar nichts.' ,Wenn die Deutschen weg sind, kommen die Engländer wieder', knurrte Pavlos. ,Nennst du das etwa Freiheit?'" Zwecks stilistischer Abwechslung werden die wörtlichen Reden nicht nur geknurrt, sondern auch gekeucht, gegrinst, gelacht oder genickt.
In schwelgerischer Metaphorik scheint schließlich Modick Goethes Idealbild der schönen Helena zugleich mit Winckelmanns Griechenkult noch einmal beschwören zu wollen. Wie der Antiquar des achtzehnten Jahrhunderts erscheint dem Archäologen des zwanzigsten die Schönheit des Menschen im Zusammenhang mit der Landschaft. "In ihren Augen waren geschliffene Steine, wie von der Schale eines Vogeleis gefaßt, ihre Ohren wie Muscheln, die am Strand glänzten, und im Beben ihrer Nasenflügel, im Zittern ihrer Lippen spiegelten sich die Bewegungen des Meers, ein Heben und Senken und tiefes Atmen, das zum Sturm anschwoll und langsam verebbte." Über dieser opulenten Wahrnehmung des Schönen als reiner Präsenz und der Vision eines Verschmelzens mit dem Elementaren aber schwebt je schon das Verhängnis in Gestalt der unbarmherzigen Zwangsläufigkeit der Geschichte.
Klaus Modick liebt Kreta über alles, und er weiß, daß die deutsche Besatzung auf der Insel bis heute nicht vergessen ist. Vor lauter Liebe aber ist diesem versierten Produzenten intelligenter Unterhaltungsliteratur die Distanz abhanden gekommen. So versenkt er sein Thema in Kitsch und Klischee und in einem Übermaß an emphatischen Stilmitteln. Über der Beschwörung der Erinnerung, der Schönheit und der Liebe scheint er vergessen zu haben, daß zur Erzählkunst das Weglassen gehört wie zum Trinken das Aufhören. Andernfalls droht ein mächtiger Kater.
FRIEDMAR APEL.
Klaus Modick: "Der kretische Gast". Roman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 464 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Diese beginnt 1943 auf Kreta. Der junge deutsche Archäologe Johann Martens soll auf der besetzten Insel erkunden, welche Kunstgegenstände sich als Beutegut für Hitlers Germanisches Museum eignen. Im Verhältnis zu seinem griechischen Führer erlebt er die seit der Antike bekannte Doppelbedeutung von "Xenos" als Fremder und Gast. Als er sich auch noch in die schöne Eleni verliebt, wird ihm seine Doppelrolle zur Identitätsfrage: "Man weiß nicht, wessen Freund man ist. Man weiß auch nicht mehr, wessen Feind man ist. Ich weiß nicht einmal mehr genau, wer ich überhaupt bin." Da hat er, in einer ehrwürdigen Tradition seit Winckelmann und Goethe, schon das Griechentum zum Ideal der Lebenskunst erhoben. Als er seinen Führungsoffizier Leutnant Friedrich Hollbach schließlich bei der Ermordung von Zivilisten beobachtet, ist sein Schicksal entschieden.
Modick verknüpft diesen Hauptstrang in Verdoppelung des Erinnerungsthemas mit einer im Jahre 1975 spielenden detektivischen Vätererkundung im Stil der siebziger Jahre. Lukas, der Sohn Hollbachs, findet auf dem Hamburger Flohmarkt zufällig ein paar alte Fotos mit unleserlicher Aufschrift, die ihn erst in ein griechisches Lokal und dann auf die kretische Spur führen. "Und ganz nebenbei auch noch seinen Vaterkomplex bewältigen?" Auch er verliebt sich in eine schöne Griechin, nämlich ausgerechnet in die Tochter von Eleni und Johann. "Eine Wahnvorstellung, eine fatal fixe Idee, daß es keine Zufälle gab im Leben?" Am schicksalhaften und geschichtsträchtigen Ort führt Modick schließlich die beiden Handlungsstränge melodramatisch zusammen.
Bei der Darstellung der Schauplätze greift Modick tief in die Kiste des Malerischen und der nordischen Griechenlandsehnsucht. "Jetzt ging im Osten die Sonne auf, und aus dem dämmrigen Blau, in das Meer und Berge getaucht waren, stiegen Farben und Umrisse. Zuerst verwandelte sich das Wasser in ein lichtdurchflutetes Blau, der Saum des Strandes zu blendendem Weiß, dann fanden die Felsen ihr tönernes Braun und die Oliven, Eichen und Zypressen ihre Grünschattierungen." Die Sinnlosigkeit des Krieges soll sich vor allem im Appell an die Sinnlichkeit erweisen. Es riecht "nach Thymian und Lavendel, Erde und Früchten, Honig und Ziegenmilch". Aus dampfenden Schüsseln wird Lammfleisch mit Fladenbrot gegessen, man trinkt "reichlich Retsina" und raucht "Unmengen griechischer Zigaretten der Marke Papastratos". Und vom Raki wird schon vormittags nachgeschenkt.
Die aufständischen Griechen sind bei Modick so pittoresk griechisch wie Schillers Räuber räuberisch. "Er trug über weißem Hemd eine bestickte Weste, eine merkwürdige Pluderhose und hochschäftige Stiefel, und quer über seinen Knien lag ein Gewehr, auf dessen Doppellauf er die Hände stützte. Um die Stirn hatte er eine Art Turban oder ein Tuch geschlungen, dessen Fransen ihm auf die Augenbrauen fielen." Schnell zuckt da die Hand zum Messergriff, aber die Dialoge der feurigen Männer fallen zwecks historischer Information des Lesers gelegentlich ziemlich hölzern aus: ",Hört auf, euch selbst zu zerfleischen, solange wir echte Feinde haben. Mir ist es egal, ob jemand Kommunist ist. Ich will ein freies Kreta, sonst gar nichts.' ,Wenn die Deutschen weg sind, kommen die Engländer wieder', knurrte Pavlos. ,Nennst du das etwa Freiheit?'" Zwecks stilistischer Abwechslung werden die wörtlichen Reden nicht nur geknurrt, sondern auch gekeucht, gegrinst, gelacht oder genickt.
In schwelgerischer Metaphorik scheint schließlich Modick Goethes Idealbild der schönen Helena zugleich mit Winckelmanns Griechenkult noch einmal beschwören zu wollen. Wie der Antiquar des achtzehnten Jahrhunderts erscheint dem Archäologen des zwanzigsten die Schönheit des Menschen im Zusammenhang mit der Landschaft. "In ihren Augen waren geschliffene Steine, wie von der Schale eines Vogeleis gefaßt, ihre Ohren wie Muscheln, die am Strand glänzten, und im Beben ihrer Nasenflügel, im Zittern ihrer Lippen spiegelten sich die Bewegungen des Meers, ein Heben und Senken und tiefes Atmen, das zum Sturm anschwoll und langsam verebbte." Über dieser opulenten Wahrnehmung des Schönen als reiner Präsenz und der Vision eines Verschmelzens mit dem Elementaren aber schwebt je schon das Verhängnis in Gestalt der unbarmherzigen Zwangsläufigkeit der Geschichte.
Klaus Modick liebt Kreta über alles, und er weiß, daß die deutsche Besatzung auf der Insel bis heute nicht vergessen ist. Vor lauter Liebe aber ist diesem versierten Produzenten intelligenter Unterhaltungsliteratur die Distanz abhanden gekommen. So versenkt er sein Thema in Kitsch und Klischee und in einem Übermaß an emphatischen Stilmitteln. Über der Beschwörung der Erinnerung, der Schönheit und der Liebe scheint er vergessen zu haben, daß zur Erzählkunst das Weglassen gehört wie zum Trinken das Aufhören. Andernfalls droht ein mächtiger Kater.
FRIEDMAR APEL.
Klaus Modick: "Der kretische Gast". Roman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 464 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
»Ein unglaublich raffiniertes Werk, das zum packenden Hochkaräter heranwächst und trotz seiner fiktiven Handlung überaus authentisch wirkt.« Lovis Binder Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Broschiertes Buch
„Und er wußte, daß in der Flüchtigkeit dieses Anblicks die Dauer beschlossen lag und vielleicht sogar ein Funken Ewigkeit.“ (Originalzitat Seite 406, Auflage 2005)
Inhalt
Lukas Hollbach, Student, kauft im März 1975 auf einem Flohmarkt von Kindern zwei gerahmte …
Mehr
„Und er wußte, daß in der Flüchtigkeit dieses Anblicks die Dauer beschlossen lag und vielleicht sogar ein Funken Ewigkeit.“ (Originalzitat Seite 406, Auflage 2005)
Inhalt
Lukas Hollbach, Student, kauft im März 1975 auf einem Flohmarkt von Kindern zwei gerahmte Fotografien. Die eine Fotografie, auf der zwei Männer zu sehen sind, kommt ihm bekannt vor. Das andere Foto zeigt eine Hafenansicht und auf der Rückseite entdeckt er eine Notiz in griechischer Sprache. Eine Studienkollegin erkennt den Hafen, Agia Galini auf Kreta, und zu Sommerbeginn fährt Lukas auf diese Insel, eine Reise die ihn in die Vergangenheit führt, ins Jahr 1943, als Kreta von den Deutschen und Engländern besetzt war.
Als Johann Martens, Archäologe, auf Grund seiner Sprachkenntnisse 1943 den Auftrag erhält, für die deutsche Wehrmacht die Kunstschätze der Insel Kreta zu katalogisieren, kann er nicht ablehnen. Als der deutsche Leutnant, dem er auf Kreta zugeteilt ist, feststellt „Katalogisieren kann man nur, was man zu Gesicht bekommt, wovor man nicht die Augen verschließt“ (Zitat Seite 36), ist Johann anfangs nicht bewusst, wie rasch dies für ihn Wirklichkeit wird. Er muss Entscheidungen treffen, die ihn in Lebensgefahr bringen. Der griechische Wort Xenos bedeutet sowohl „Fremder“, als auch „Gast“ und manchmal erfolgt der Übergang fließend.
Thema und Genre
Dieser Roman ist ein zeitgeschichtliches Epos und eine eindrucksvolle Schilderung der Insel Kreta. Es umfasst die beiden letzten Kriegsjahre, als Kreta von den Deutschen und von den Engländern besetzt war. Die stolzen Kreter wollten jedoch vor allem eines, Freiheit. Es geht hier um Entscheidungen, die in dieser gefährlichen, dunklen Zeit jeder für sich selbst treffen musste, wo zwischen Mut und Verrat, zwischen dem Ausführen der Befehle wie unter Zwang und der Befehlsverweigerung alles möglich war. Es geht aber auch um die heutige Generation der Kinder und wie sie mit der Vergangenheit der Familie umgehen.
Charaktere
Johann Martens ist Archäologe und versucht, sich als Deutscher möglichst neutral zu verhalten. Gewalt lehnt er ab, doch auf Kreta wird er mit einer Realität konfrontiert, wo er nicht mehr wegschauen kann. Durch den Einheimischen Andreas, der ihm von den Deutschen als Chauffeur und Übersetzer zugeteilt wurde, lernt er rasch, hinter die Kulissen zu blicken und beginnt zu verstehen, worum es wirklich geht. Ein mutiger, unangepasster Protagonist.
Lukas Hollbach wird im Zuge seiner Recherchen 1975 endgültig erwachsen und er entdeckt die Schönheit der Insel Kreta, die griechische Gastfreundschaft und taucht tief in die Ereignisse der Kriegsjahre ein, die auch ihn betreffen.
Der Autor geht realistisch, aber sensibel mit den Charakteren der besetzten Insel um, dadurch bleiben die handelnden Personen im Graubereich und es gibt keine gut – böse Stereotypen. Das macht diesen Roman so beeindruckend, unvorhersehbar und spannend. Natürlich kommen auch Frauen in der Geschichte vor, sowohl Johann, als auch Lukas verlieben sich, doch steht die Liebesgeschichte nicht im Vordergrund, sondern erklärt manche Entscheidungen der Hauptprotagonisten.
Handlung und Schreibstil
Die Erzählung ist zweisträngig. Die beiden zeitlich getrennten Ereignisketten 1943 und 1975 sind ineinander verschränkt. Ort der Handlung ist überwiegend die Insel Kreta. Jedes Kapitel trägt als Überschrift Ort und Jahr und ist in nummerierte Unterkapitel eingeteilt. Dadurch bleibt der Roman für den Leser übersichtlich. Die gesamte Geschichte ist sehr spannend erzählt.
Dieser Roman ist pures Lesevergnügen, sprachlich gekonnte Schilderungen wecken Sehnsucht nach Kreta, ohne jedoch bemüht metaphorisch zu sein.
Fazit
Dies ist das erste Buch, das ich von diesem Autor gelesen habe, aber es werden bald weitere folgen. Sprachgewandt zieht uns Klaus Modick von der ersten Zeile an in eine sehr spannende Handlung mit interessanten, vielschichtigen Charakteren. Dieser Roman ist ein Page-turner, der alle Erwartungen erfüllt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Zu viel Zufall
Ich bin ein Modick-Fan. Seine letzten Bücher „Keyseerlings Geheimnis“ und „Konzert ohne Dichter“ konnte ich eine Bestnote geben. Bei diesem schon älterem Werk muss ich aber einen Stern abziehen. Der Grund liegt darin, dass die Verknüpfung der …
Mehr
Zu viel Zufall
Ich bin ein Modick-Fan. Seine letzten Bücher „Keyseerlings Geheimnis“ und „Konzert ohne Dichter“ konnte ich eine Bestnote geben. Bei diesem schon älterem Werk muss ich aber einen Stern abziehen. Der Grund liegt darin, dass die Verknüpfung der Urlaubsgeschichte des Sohn von Hollbach mit den Kriegserlebnissen des kretischen Gast unglaubwürdig erschient.
Hätte der Autor besser nicht daran getan diese Nebenhandlung wegzulassen? Das eigentlich spannende nämlich wie der Vater zu den Kriegsverbrechen steht, die sein Sohn aufdeckt wird gar nicht erzählt. Dafür viele romantische Liebesschnulze.
Doch wie bei Modick sonst auch ist die Historie gut recherchiert, so dass ich zustimmen könnte. So könnte es gewesen sein. Man bekommt Lust beim nächsten Kreta-Urlaub nach den Spuren der Vergangenheit zu suchen.
Vielleicht hat sich Modick die Kritik an diesem Buch zu Herzen genommen und die nächsten Bücher kürzer und prägnanter geschrieben. Wegen der Spannung im Mittelteil noch 4 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für