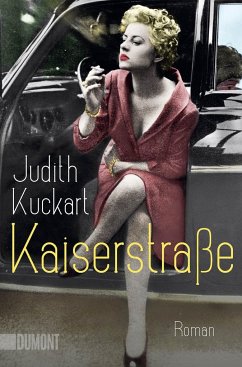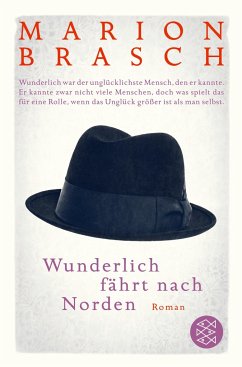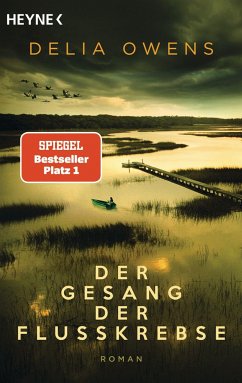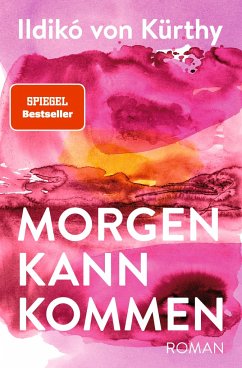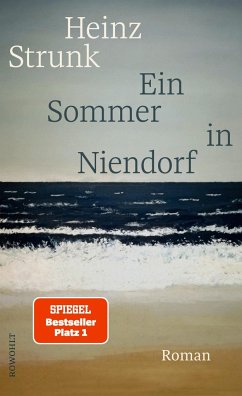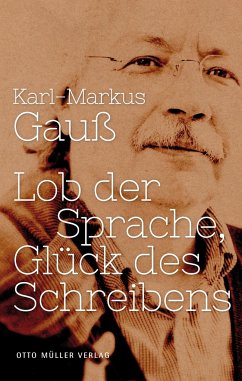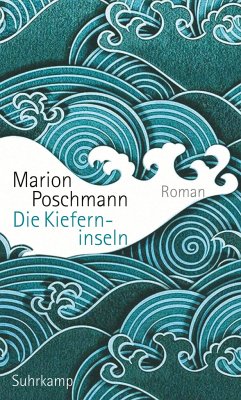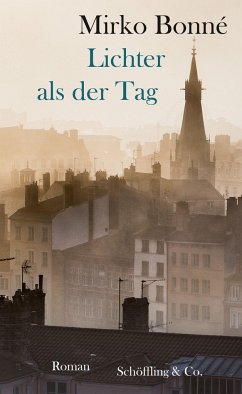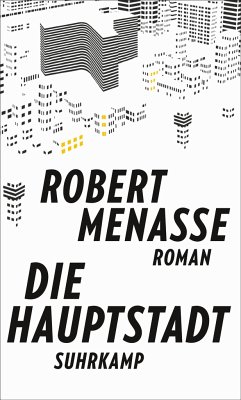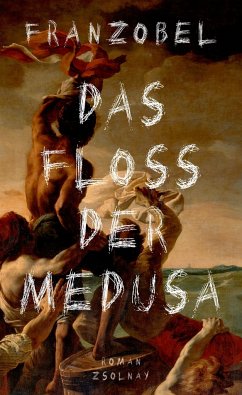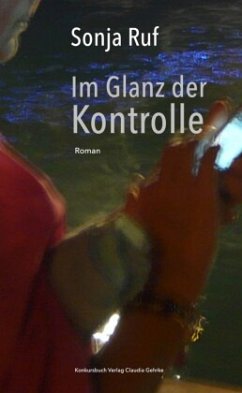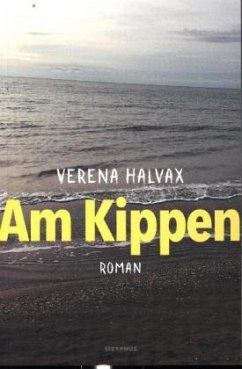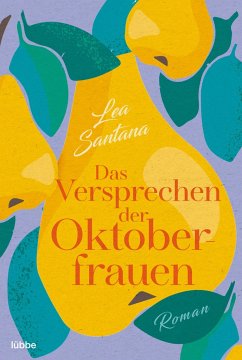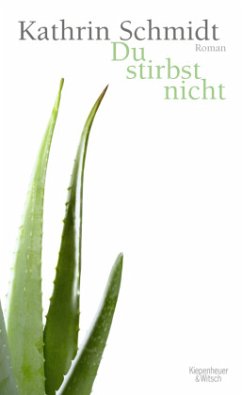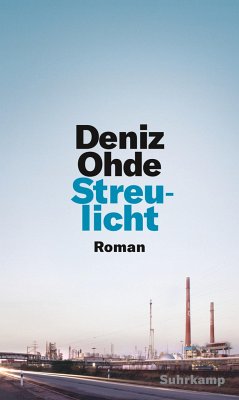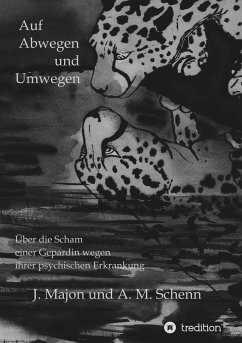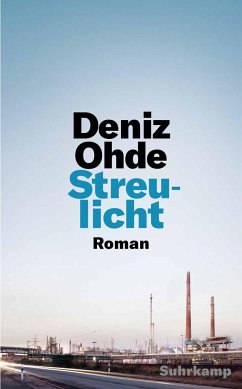Nicht lieferbar
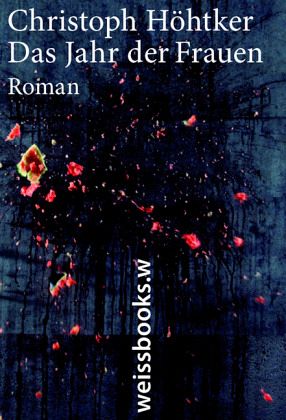
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Was ist zu tun, wenn man von allem endgültig genug hat, der Therapeut aber dennoch Vorsätze für das neue Jahr hören möchte? Frank Stremmer, ausgebrannter deutscher Expat in Diensten einer illustren internationalen Genfer Organisation, rafft sich zu einem letzten Kraftakt auf: Zwölf Frauen in zwölf Monaten! Ohne Geld, ohne Versprechungen, ohne Perspektiven. Was als müde Provokation gegenüber seinem Psychologen beginnt, entwickelt sich schon bald zur fixen Idee.Denn am Ende soll nichts Geringeres stehen als: Die Erlösung. Zwölf Frauen in zwölf Monaten bedeuten für Stremmer die »Leg...
Was ist zu tun, wenn man von allem endgültig genug hat, der Therapeut aber dennoch Vorsätze für das neue Jahr hören möchte? Frank Stremmer, ausgebrannter deutscher Expat in Diensten einer illustren internationalen Genfer Organisation, rafft sich zu einem letzten Kraftakt auf: Zwölf Frauen in zwölf Monaten! Ohne Geld, ohne Versprechungen, ohne Perspektiven. Was als müde Provokation gegenüber seinem Psychologen beginnt, entwickelt sich schon bald zur fixen Idee.
Denn am Ende soll nichts Geringeres stehen als: Die Erlösung. Zwölf Frauen in zwölf Monaten bedeuten für Stremmer die »Legitimation« zum Freitod. Seine irrwitzige Jagd durch Online-Portale, Bars und Schlafzimmer endet jedoch nicht im Frieden leerer Schlaftablettenröhrchen, sondern im Chaos eines afrikanischen Bürgerkriegsstaates.
Denn am Ende soll nichts Geringeres stehen als: Die Erlösung. Zwölf Frauen in zwölf Monaten bedeuten für Stremmer die »Legitimation« zum Freitod. Seine irrwitzige Jagd durch Online-Portale, Bars und Schlafzimmer endet jedoch nicht im Frieden leerer Schlaftablettenröhrchen, sondern im Chaos eines afrikanischen Bürgerkriegsstaates.
Höhtker, ChristophChristoph Höhtker, 1967 in Bielefeld geboren, Soziologiestudium. Lebt seit 2004 in Genf und arbeitet dort für eine internationale Organisation.Neben seinen Romanen publiziert Christoph Höhtker in unregelmäßigen Abständen «Reiseberichte» in der NZZ, der Welt, der Zeit, in Konkret, der WOZ oder im Magazin des Tages-Anzeiger.
Produktdetails
- Verlag: weissbooks
- Seitenzahl: 250
- Erscheinungstermin: 11. August 2017
- Deutsch
- Abmessung: 214mm x 146mm x 24mm
- Gewicht: 456g
- ISBN-13: 9783863371180
- ISBN-10: 3863371186
- Artikelnr.: 48166167
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.09.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.09.2017Aus dem Leben eines Pick-up-Taugenichts
Popp-Literatur mit Ironiewimpel: Christoph Höhtker geht mit seinem Helden auf Abschiedstournee
So ähnlich ist schon der namenlose Ich-Erzähler aus Christian Krachts Roman "1979" verlorengegangen, jener dandyhafte Ästhetizist, der irgendwo in chinesischen Straflagern seine Bestimmung als guter Gefangener gefunden hat. Diesmal ist es das anarchische Gewaltafrika, das dem einigermaßen prätentiös an Lebens- und Weltekel leidenden und dies nicht nur im Gespräch mit seinem Therapeuten Niederegger zugleich dauerironisierenden Ich-Erzähler Frank Stremmer zur finalen Destination wird. Oder ist sie gar nicht final? Der suizidale Held - "die Trostlosigkeit in meinem Leben ist einfach
Popp-Literatur mit Ironiewimpel: Christoph Höhtker geht mit seinem Helden auf Abschiedstournee
So ähnlich ist schon der namenlose Ich-Erzähler aus Christian Krachts Roman "1979" verlorengegangen, jener dandyhafte Ästhetizist, der irgendwo in chinesischen Straflagern seine Bestimmung als guter Gefangener gefunden hat. Diesmal ist es das anarchische Gewaltafrika, das dem einigermaßen prätentiös an Lebens- und Weltekel leidenden und dies nicht nur im Gespräch mit seinem Therapeuten Niederegger zugleich dauerironisierenden Ich-Erzähler Frank Stremmer zur finalen Destination wird. Oder ist sie gar nicht final? Der suizidale Held - "die Trostlosigkeit in meinem Leben ist einfach
Mehr anzeigen
überwältigend" - hat bereits zwei Vorgängerromane überlebt, warum nicht auch diesen doch irgendwie offenen Schluss? Vor allem aber geht es bei Christoph Höhtker ungravitätischer zu als bei Kracht, dafür bedeutend lustiger (was freilich nicht allzu schwer ist).
Schon die Erzählsituation, sieht man von der schwülstigen Sexbesessenheit des Erzählers ab, ist eine pikarische. Frank Stremmer, in einem früheren Leben (und Roman) gutbezahlter, schlagfertiger und sarkastisch die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns zelebrierender Hochfinanzmauscheleienschönredner, ist inzwischen - immer noch schlagfertig, neurotisch und verzweifelt, immer noch in Genf - für die gelungene Karikatur einer überheblichen, ja neokolonialistischen Nichtregierungsorganisation namens "Global Enhancement Foundation (GEF)" tätig: ein Schelm im System, der für selbiges (und sich) wieder nur Verachtung übrig hat. Alle anderen GEF-Mitarbeiter hingegen sind von der eigenen vermeintlichen Relevanz geblendet, am stärksten der Executive Chairman Raphael Gonzales-Blanco, den man intern nur "RGB" nennt: "Nächstes Jahr geht der Trottel in Rente, es zieht ihn zurück auf seine Landgüter, aber vorher wurde noch genügend Geld vom Communications-Etat abgezweigt, um ein völlig irres Buchprojekt zu finanzieren." Für die Erstellung dieser RGB-Lobhudelbiographie unter dem Codenamen "Valparaiso" wurden Stremmer und sein Kollege Erik Lynberg eingestellt. Die beiden PR-Strategen begleiten den absolutistischen Boss auf diverse Reisen, zuletzt eben nach Afrika.
Für das Memoirenbuch tun sie jedoch einfach gar nichts, weil es offenbar genügt, alle Beteiligten mit improvisierten Schmeicheleien bei Laune zu halten. Stremmer feilt stattdessen an einer nachgerade blödsinnigen Zwiebel-Novelle herum und wirft sich mit Vehemenz dem Taedium vitae in die Arme. Das Einzige, was dem so wattiert vor sich hinlebenden Zyniker, der irgendwann überrascht feststellt, dass man ihm auch noch mehrere Wochen Urlaub aufnötigt ("Wovon?"), einen Rest von Lebenskitzel verschafft, ist - leider - Geschlechtsverkehr. "Leider" muss man sagen, denn dieser zweite Handlungsstrang, der sich schnell in den Vordergrund spielt, hat anders als der parodistische Entwicklungshilfe-Plot gar keine Richtung mehr und erstaunlich wenig Pep.
Die Struktur des Buches ergibt sich denn auch schlicht durch die alberne, dem Therapeuten aufgenötigte Wette Frank Stremmers, sich umbringen zu dürfen, wenn er ein Jahr lang jeden Monat eine andere Frau ins Bett bekommt ("verbraucht"), ohne dafür zu zahlen. Mit einem Rachefeldzug habe das nichts zu tun, eher mit gesteigerter Aufwartung: eine "Abschiedstournee". Was sich hier verabschiedet, ist aber vor allem die Handlung. In überraschungsarmen Wiederholungsschleifen werden nun tatsächlich alle zwölf Eroberungen von der Anbahnung bis zum Vollzug akkumuliert, und da sind Stremmers bezahlte Erholungs-Kopulationen nicht einmal eingerechnet.
Unverkennbar orientiert sich Höhtker damit an Michel Houellebecq, allerdings abgelenkt ins Lottmannsche. Und doch fehlt sowohl die politisch dringliche Kaputtheit der Helden Houellebecqs als auch die programmatische Verlogenheit, die Joachim Lottmanns Bücher auszeichnet. Unser Womanizer aus Genf ist weder subversiver Menschenfeind noch altersgeiler Pop-Onkel, sondern lediglich ein deprimierter Pick-up-Artist mit echter Schwäche für Frauen. Ein koketter Sexismus ist quasi konstitutiv: Der selbst waidwunde Frank inszeniert sich als alles Weibliche taxierender Jäger-Mann im Sinne der Evolution, der sich um hysterische Gender-Debatten nicht weiter schert und gerade damit beim anderen Geschlecht beeindruckende Erfolge einfährt. Das kann man schmierig finden (die hysterische Fraktion), frech oder glaubhaft (offenbar soll Frank ziemlich schnuckelig aussehen), doch all das ändert nichts an der Tatsache, dass dies als Romangrundlage allzu dürftig ist.
Auch der flotte, pointierte Werbetexter-Stil ist nicht elaboriert oder gar literarisch genug, um das Interesse wachzuhalten, zumal das Lektorat eine Reihe von orthographischen und grammatischen Fehlern durchgehen ließ. Den selbstgefälligen Ton interner (E-Mail-)Unternehmenskommunikation imitiert Höhtker zwar ziemlich treffend, ebenso den kläglichen Yuppie-Smalltalk von Karrieristen, aber beides wirkt allenfalls mittellustig und weitgehend ziellos. Weil sich der Erzähler für einen hochkreativen und gewitzten Kopf hält, sind zudem ständig kursive Passagen eingestreut, in denen ohne weitere Bedeutung ulkige Biographien von Nebenfiguren im gerafften Lexikonstil imaginiert werden - auch das eher aufdringlich. Und spätestens die zehnte platte Hommage an Brüste, Hintern oder "Tight Gaps" dürfte nicht einmal mehr verhuschte Erotika-Liebhaber antörnen.
Übrig bleiben einige gute Dialoge mit dem Therapeuten, manches gelungene Bild (meist verschüttet unter berghoch aufgetürmten Metaphern) und hier und da ein schöner Satz: "Der See verarbeitete die Abendsonne." Man kann sich ein wenig amüsieren bei dieser Farce über die eitle Gutmenschen-Industrie. Was das Buch aber auf der Longlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis zu suchen hatte, bleibt ein Geheimnis.
OLIVER JUNGEN
Christoph Höhtker: "Das Jahr der Frauen". Roman.
Weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2017. 252 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schon die Erzählsituation, sieht man von der schwülstigen Sexbesessenheit des Erzählers ab, ist eine pikarische. Frank Stremmer, in einem früheren Leben (und Roman) gutbezahlter, schlagfertiger und sarkastisch die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns zelebrierender Hochfinanzmauscheleienschönredner, ist inzwischen - immer noch schlagfertig, neurotisch und verzweifelt, immer noch in Genf - für die gelungene Karikatur einer überheblichen, ja neokolonialistischen Nichtregierungsorganisation namens "Global Enhancement Foundation (GEF)" tätig: ein Schelm im System, der für selbiges (und sich) wieder nur Verachtung übrig hat. Alle anderen GEF-Mitarbeiter hingegen sind von der eigenen vermeintlichen Relevanz geblendet, am stärksten der Executive Chairman Raphael Gonzales-Blanco, den man intern nur "RGB" nennt: "Nächstes Jahr geht der Trottel in Rente, es zieht ihn zurück auf seine Landgüter, aber vorher wurde noch genügend Geld vom Communications-Etat abgezweigt, um ein völlig irres Buchprojekt zu finanzieren." Für die Erstellung dieser RGB-Lobhudelbiographie unter dem Codenamen "Valparaiso" wurden Stremmer und sein Kollege Erik Lynberg eingestellt. Die beiden PR-Strategen begleiten den absolutistischen Boss auf diverse Reisen, zuletzt eben nach Afrika.
Für das Memoirenbuch tun sie jedoch einfach gar nichts, weil es offenbar genügt, alle Beteiligten mit improvisierten Schmeicheleien bei Laune zu halten. Stremmer feilt stattdessen an einer nachgerade blödsinnigen Zwiebel-Novelle herum und wirft sich mit Vehemenz dem Taedium vitae in die Arme. Das Einzige, was dem so wattiert vor sich hinlebenden Zyniker, der irgendwann überrascht feststellt, dass man ihm auch noch mehrere Wochen Urlaub aufnötigt ("Wovon?"), einen Rest von Lebenskitzel verschafft, ist - leider - Geschlechtsverkehr. "Leider" muss man sagen, denn dieser zweite Handlungsstrang, der sich schnell in den Vordergrund spielt, hat anders als der parodistische Entwicklungshilfe-Plot gar keine Richtung mehr und erstaunlich wenig Pep.
Die Struktur des Buches ergibt sich denn auch schlicht durch die alberne, dem Therapeuten aufgenötigte Wette Frank Stremmers, sich umbringen zu dürfen, wenn er ein Jahr lang jeden Monat eine andere Frau ins Bett bekommt ("verbraucht"), ohne dafür zu zahlen. Mit einem Rachefeldzug habe das nichts zu tun, eher mit gesteigerter Aufwartung: eine "Abschiedstournee". Was sich hier verabschiedet, ist aber vor allem die Handlung. In überraschungsarmen Wiederholungsschleifen werden nun tatsächlich alle zwölf Eroberungen von der Anbahnung bis zum Vollzug akkumuliert, und da sind Stremmers bezahlte Erholungs-Kopulationen nicht einmal eingerechnet.
Unverkennbar orientiert sich Höhtker damit an Michel Houellebecq, allerdings abgelenkt ins Lottmannsche. Und doch fehlt sowohl die politisch dringliche Kaputtheit der Helden Houellebecqs als auch die programmatische Verlogenheit, die Joachim Lottmanns Bücher auszeichnet. Unser Womanizer aus Genf ist weder subversiver Menschenfeind noch altersgeiler Pop-Onkel, sondern lediglich ein deprimierter Pick-up-Artist mit echter Schwäche für Frauen. Ein koketter Sexismus ist quasi konstitutiv: Der selbst waidwunde Frank inszeniert sich als alles Weibliche taxierender Jäger-Mann im Sinne der Evolution, der sich um hysterische Gender-Debatten nicht weiter schert und gerade damit beim anderen Geschlecht beeindruckende Erfolge einfährt. Das kann man schmierig finden (die hysterische Fraktion), frech oder glaubhaft (offenbar soll Frank ziemlich schnuckelig aussehen), doch all das ändert nichts an der Tatsache, dass dies als Romangrundlage allzu dürftig ist.
Auch der flotte, pointierte Werbetexter-Stil ist nicht elaboriert oder gar literarisch genug, um das Interesse wachzuhalten, zumal das Lektorat eine Reihe von orthographischen und grammatischen Fehlern durchgehen ließ. Den selbstgefälligen Ton interner (E-Mail-)Unternehmenskommunikation imitiert Höhtker zwar ziemlich treffend, ebenso den kläglichen Yuppie-Smalltalk von Karrieristen, aber beides wirkt allenfalls mittellustig und weitgehend ziellos. Weil sich der Erzähler für einen hochkreativen und gewitzten Kopf hält, sind zudem ständig kursive Passagen eingestreut, in denen ohne weitere Bedeutung ulkige Biographien von Nebenfiguren im gerafften Lexikonstil imaginiert werden - auch das eher aufdringlich. Und spätestens die zehnte platte Hommage an Brüste, Hintern oder "Tight Gaps" dürfte nicht einmal mehr verhuschte Erotika-Liebhaber antörnen.
Übrig bleiben einige gute Dialoge mit dem Therapeuten, manches gelungene Bild (meist verschüttet unter berghoch aufgetürmten Metaphern) und hier und da ein schöner Satz: "Der See verarbeitete die Abendsonne." Man kann sich ein wenig amüsieren bei dieser Farce über die eitle Gutmenschen-Industrie. Was das Buch aber auf der Longlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis zu suchen hatte, bleibt ein Geheimnis.
OLIVER JUNGEN
Christoph Höhtker: "Das Jahr der Frauen". Roman.
Weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2017. 252 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Romanfiguren müssen nicht sympathisch sein, daran erinnert Rainer Moritz noch einmal angesichts des misogynen, suizidalen Protagonisten in Christoph Höhtkers "Das Jahr der Frauen". Der geht mit seinem Therapeuten die geschmacklose Wette ein, dass er seinem Leben nur dann ein Ende bereiten wird dürfen, wenn er innerhalb eines Jahres zwölf Frauen "verbrauche", fasst der Rezensent zusammen. Angesichts der Thematik und des Vokabulars darf man während der Lektüre weder realistische noch politisch korrekte Erwartungen haben, warnt Moritz. Der zynische Witz und die "schrägen" Einfälle dieser bösen Abrechnung mit Psychotherapeuten und ruhmsüchtigen Philanthropen macht dem Kritiker, der bisweilen an Houellebecq denken muss, aber so viel Spaß, dass er sogar dem äußerst unaufmerksamen Lektorat verzeiht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Von Autor Christoph Höhtker stammen „Die schreckliche Wirklichkeit des Lebens an meiner Seite“ und „Alles sehen“. In „Das Jahr der Frauen“ hat Frank Stremmer ein neues Ziel vor Augen.
Frank schlägt seinem Psychotherapeuten Dr. Niederegger eine …
Mehr
Von Autor Christoph Höhtker stammen „Die schreckliche Wirklichkeit des Lebens an meiner Seite“ und „Alles sehen“. In „Das Jahr der Frauen“ hat Frank Stremmer ein neues Ziel vor Augen.
Frank schlägt seinem Psychotherapeuten Dr. Niederegger eine skurrile Wette vor. Wird er es schaffen, ein Jahr lang jeden Monat eine Frau ins Bett zu kriegen? An gewisse Regeln will er sich halten. Das Unterfangen erweist sich nicht immer als leicht. Wenn Frank gewinnt, ist der Preis hoch.
Die Geschichte beginnt mit einem Therapeutengespräch und der Wette. Frank hat mit einer Trennung zu kämpfen. Ist Mari der Grund für die Wette und alles was folgt? Das Lesevergnügen wird durch eine kleine Schrift und lange Passagen eingeschränkt. Es fehlt eine Leerzeile zwischen den Absätzen, die alles übersichtlicher gestaltet hätte. So entsteht der Eindruck, im Endlostext gefangen zu sein. Gut, dass die Kapitel relativ kurz sind. Ermüdungserscheinungen machen sich nicht nur wegen der Gestaltung breit. Die Frauengeschichten wiederholen sich in abgewandelter Form. Wo ist der Kern der Geschichte? Wo bleibt der Sinn? Geht es nur darum, Frank in seinen Phasen zu erleben, wie er Frauen aufreißt, sich den Job so angenehm wie möglich gestaltet? Die Hauptfigur ist alles andere als sympathisch. Der Umgang mit Frauen, die Sehnsucht nach dem Tod. Es kommt wenig Verständnis für ihn auf. Ausgedachte Lebensläufe für Menschen, denen er begegnet und das nie enden wollende Zwiebelkurzgeschichten-Problem lassen ihn nicht interessanter erscheinen. Die Unterhaltungsmittel nutzen sich schnell ab. Was bleibt ist ein verstörender Mensch, der sein Glück nicht findet, Frauen wie Wegwerfware benutzt und sich ständig selbst im Wege steht. Eine große Portion Humor hätte der Geschichte gut getan. Ein paar Pannen und schräge Momente. Einziges Highlight ist Freizeitmann, der immer wieder am selben Ort auftaucht. Die Nebenfigur hätte mehr Gewicht verdient gehabt. Schade, so können nicht einmal Handlungsorte wie Genf und Mallorca helfen, den Unterhaltungswert zu steigern. Steuert Frank auf den Abgrund zu oder kriegt er die Kurve? Die Frage, wie die ganze Sache ausgeht, beschäftigt. Er hat auch gute Momente. Warum spielt seine Arbeit eine so große Rolle? Wird Frank Mari wiedersehen? Das Ende ist völlig anders als erwartet. Zum Schluss kommt Spannung auf. So richtig anpassen an den Rest der Geschichte will sich das Ganze nicht. Die Überraschung ist aber gelungen. Ein gutes Stilmittel ist der Anhang.
Der Titel lässt Anderes erwarten als den Inhalt. Es ist nicht das Jahr der Frauen, sondern Franks Jahr. Das Cover ist wenig auffällig. Eine größere zersprengte Wassermelone, eine andere Hintergrundfarbe und ein kreativ platzierter Titel, schon wäre das Buch ins Auge gefallen. „Das Jahr der Frauen“ enttäuscht. Es fällt schwer, bis zum Ende durchzuhalten. Zu langatmig und blass, Frank reißt einfach nicht mit. Auch die Frauen sind austauschbar.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
4. Januar 2013. Ein neues Jahr, erster Termin bei seinem Psychotherapeuten Yves Niederegger. Die unvermeidliche Frage danach, welche Pläne er für das neue Jahr habe, mündet für Frank Stremmer in einer Wette: wenn es ihm gelingt, in jedem Monat des neuen Jahres eine Frau zu …
Mehr
4. Januar 2013. Ein neues Jahr, erster Termin bei seinem Psychotherapeuten Yves Niederegger. Die unvermeidliche Frage danach, welche Pläne er für das neue Jahr habe, mündet für Frank Stremmer in einer Wette: wenn es ihm gelingt, in jedem Monat des neuen Jahres eine Frau zu „verbrauchen“ ohne dafür Geld auszugeben, darf er sich am Ende des Jahres umbringen. Ein durchaus ambitionierter Plan, aber er wird in Angriff genommen, so hat Frank wenigstens etwas zu tun, denn sein Job in der Kommunikationsabteilung von GEF in Genf ist wenig spannend und sicher nicht arbeitszeitfüllend. Im Projekt „Valparaiso“ arbeitet er an der fiktiven Biographie von Raphael Gonzales-Blanco, dem Executive Chairman (EC) der Firma mit politischen Ambitionen. Dies ist nicht nur eine sehr kreative Arbeit, da die Faktenlage eher dünn ist und so vieles aus dem Leben des EC aus der Feder von Frank und seinen Kollegen stammt, sondern auch noch mit regelmäßigen Reisen verbunden, was wenigstens die Chance auf Frauenkontakte erhöht.
Der Grundansatz des Buches birgt zweifellos die Gefahr des Abdriftens in sehr flache Gefilde bei der Suche nach Frauen, um die Wette mit dem Therapeuten zu gewinnen. Christoph Höhtker gelingt es jedoch problemlos diese Gefahr zu umschiffen und völlig zurecht wurde er dafür auf der Longlist des Deutschen Buchpreis 2017 nominiert.
Wer sind sie nun, die Bekanntschaften, die Frank durch das Jahr 2013 begleiten? Die schwedische Künstlerin Malin Nordström; die Brasilianerin Adela, die in Europa ein besseres Leben sucht; eine Flughafenbekanntschaft; eine Bedienung einer mallorkinischen Bar; eine Internetbekanntschaft – der Autor lässt sich einiges einfallen für seinen Protagonisten, wobei keine der Begegnungen unmotiviert und nicht nachvollziehbar wäre und Frank Stremmer ebenfalls nicht plötzlich zum begehrten Frauenhelden mutiert. Die Partnerinnen für das jeweils recht kurze Intermezzo ergeben sich ihm nicht einfach, bisweilen muss er sogar sehr kämpfen, um seinen Plan zu realisieren und sie behalten nicht selten auch die Oberhand in ihrer Zweisamkeit.
Auch wenn die titelgebenden Frauen sicher das Leitmotiv des Romans sind, der wie das Jahr in zwölf Kapitel untergliedert ist, so bleibt doch noch genug Raum für das zwei Thema: Franks Arbeitsplatz. Mit viel Ironie, die bisweilen in Sarkasmus driftet, wird das äußert wichtige Dasein in einer Genfer Agentur geschildert. Eigentlich scheint niemand so genau zu wissen, was sie eigentlich tun, wenn sie nichts tun, hat dies auch keine weiteren Folgen. Zwischen Kaffeetrinken und Schwätzchen auf dem Flur gibt es nur kurze Momente der Tätigkeit, die sich in Frank Stremmers Fall auf das Erfinden der Biographie des Firmenchefs beschränkt. Allein dieser Umstand ist schon grotesk genug und wird hier und da detailreich völlig ad absurdum geführt – beispielsweise in Form das erfundenen BBC Interviews oder den globalen Wohltaten des Herren.
Zwischen der Suche nach Frauen und dem kreativen Schaffen liegen immer wieder Besuche beim Psychologen, der an seinem Patienten bisweilen zu verzweifeln droht, wobei die Besuche oftmals weniger dem therapeutischen Bedürfnis geschuldet zu sein schein als der Tatsache, dass einen Therapeuten zu haben zum Lebensstil der Genfer Expat-Community gehört.
Der Roman lebt jedoch nicht nur von seinen zwei bizarren Leitgedanken, sondern vor allem von der Sprachgewandtheit Christoph Höhtkers. Er schont seinen Protagonisten nicht und findet einen Erzählton, der Absurditäten in der Agentur und die Unzulänglichkeiten Stremmers noch unterstreicht. Lebendige Dialoge wechseln sich mit herrlichen Kurzbiographien der Nebenfiguren ab, so dass das Lesen ein herrlicher Spaß ist, der in ein unerwartetes, aber vollends passendes Finale mündet.
Im Vergleich zu anderen Nominierten des Deutschen Buchpreises ein Buch, das heiter und beschwingt daherkommt ohne die darunterliegenden ernsten Aspekte zu verleugnen. Dadurch wirklich eine rundum überzeugende Lektüre.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Es hätte ein außergewöhnlich guter Roman werden können: Als Idee gleich zu Beginn eine extrem skurrile Wette, die Geschichte verpackt in Höhtkers gleichermaßen moderne wie originelle Sprache - ich freute mich auf ein ungewöhnliches Leseerlebnis.
Und ich wurde …
Mehr
Es hätte ein außergewöhnlich guter Roman werden können: Als Idee gleich zu Beginn eine extrem skurrile Wette, die Geschichte verpackt in Höhtkers gleichermaßen moderne wie originelle Sprache - ich freute mich auf ein ungewöhnliches Leseerlebnis.
Und ich wurde anfangs auch nicht enttäuscht: Protagonist Frank Stremmer, in der PR-Abteilung einer ominösen NGO in Genf tätig, schlägt seinem Therapeuten - gedrängt, aufgrund des bevorstehenden Jahreswechsels sich doch Vorsätze für das kommende neue Jahr zu nehmen - eine unkonventionelle Wette vor: Frank will in den kommenden zwölf Monaten je eine Frau "verbrauchen", sprich: mit ihr Sex haben. Einzige Bedingung: Er darf nicht dafür bezahlen. Schafft er das, darf er sich anschließend umbringen.
Die ersten Kapitel nehmen rasant an Fahrt auf, die hoffnungslose, düstere Welt, in der sich der depressive Frank eingerichtet hat, wird mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors beschrieben. Ein interessanter Kunstgriff ist auch die Fähigkeit, sich zu allen möglichen Menschen um ihn herum Biografien auszudenken.
Doch leider schafft es Höhtker nicht, mich bis zum Schluss zu fesseln. Zwar fordert die anspruchsvolle Schreibweise die ganze Aufmerksamkeit des Lesers, sonst kann man vor lauter Einschüben, Gedankensprüngen und eingefügten E-Mails schon mal den Faden verlieren. Dennoch habe ich mich ab dem vierten Kapitel (es sind derer zwölf, gemäß der Monate) zunehmend gelangweilt und war nach der Hälfte des Romans froh, dass das Jahr "nur" zwölf Monate hat.
Die Idee mit der Wette nutzt sich schnell ab, sie trägt keinen ganzen Roman. Über die Nebenfiguren erfahren wir wenig, dieses Wenige wird dafür oft wiederholt, so etwa dass Kollege Wilson fett und abhängig von Psychopharmaka ist. Auch über Frank bleiben viele Fragen offen, für meinen Geschmack zu viel Interpretationsspielraum: Wieso ist er so depressiv, was hat ihn - außer gemeinsamen Drogenkonsums - mit seiner Ex-Freundin verbunden, wieso arbeitet er, der Kommunikation völlig ablehnt, als PRler für eine Organisation, deren Motto lautet "Communicating for a better tomorrow"?
Als Pluspunkte des Romans verbuche ich die unverhohlene Kritik an manchen undurchsichtigen, selbsternannten Hilfsorganisationen, an der PR-Maschinerie an sich und vor allem das überraschende, offene Ende, das auch durch das gewählte Stilmittel des Gesprächsprotokolls sehr eindringlich nachwirkt.
Leider tröstet dies nur bedingt über die vielen, langatmigen Wiederholungen hinweg. Es bleibt: Ein außergewöhnlicher, jedoch außergewöhnlich langweiliger Roman, mit dem Höhtker weit hinter seinen Möglichkeiten zurück bleibt. Schade.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
"Das Jahr der Frauen" von Christoph Höhtker, ist eine absurde, deprimierende und Atmosphärisch irritierende Provokation eines Besessenen, der in 12 Monaten 12 Frauen verbraucht und sich dabei durch Online-Portale, Bars und Schlafzimmer führt und im blutigen Staub eines …
Mehr
"Das Jahr der Frauen" von Christoph Höhtker, ist eine absurde, deprimierende und Atmosphärisch irritierende Provokation eines Besessenen, der in 12 Monaten 12 Frauen verbraucht und sich dabei durch Online-Portale, Bars und Schlafzimmer führt und im blutigen Staub eines afrikanischen Bürgerkriegsstaates endet.
Alles Beginnt mit einer müden Provokation, einer Wette die Frank Stremmer, Anfang 40, ausgebrannter deutscher Expat, mit seinem Psychotherapeuten eingeht. Er rafft sich zu einem letzten Kraftakt auf und die absurde Provokation gegenüber seinem Psychotherapeuten wird schon bald zu einer fixen Idee.
12 Frauen in 12 Monaten ohne Geld, ohne Versprechen und ohne Perspektiven, will Frank Stremmer verbrauchen und begibt sich dabei auf die Jagd durch Online Portale, Bars und Schlafzimmer. Doch immer verbissener verfolgt er sein Projekt und auch seine Annäherungsversuche werden immer absurder und grotesker die, so hat er es sich vorgenommen mit der Erlösung enden sollen.
Doch es wird immer Frauenverachtender, deprimierender und endet im blutigen Staub eines afrikanischen Bürgerkriegsstaates.
Es ist der dritte Band der Stremmer-Triologie und obwohl ich Frank Stremmer erst in seinem persönlich und absurden 12 Frauen Projekt fürs neue Jahr, kennen gelernt habe, ist er mir mit jeder Hörminute gänzlich unsympathischer geworden. Frank Stremmer ist ausgebrannt, sein Verhalten Frauenverachtend, und unverschämt und sein Charakter, düster, wirr und deprimierend. Das er dabei eine Wette mit seinem Psychotherapeuten eingeht, um sich nicht gleich dem Freitod hinzugeben, war mir nicht ganz einleuchtend und wirkte auf mich fernab der Realität. Es folgt ein Roadtrip den Frank Stremmer durch Ortschaften führt, in denen er seine oftmals auch sehr unterschiedlich und unzähligen Frauenbekanntschaften stösst und kennen lernt. Es führt ihn dabei von der Schweiz über Frankfurt, nach Mallorca, Hokkaido, weiter nach Berlin, ins winterliche Büsum bishin zum exotischen Ort des Finales. Dabei tauch er immer wieder in Parallelwelten ab, die der Autor zwar immer wieder gut auffangen konnte, aber trotzdem ziemlich langatmig und verwirrend für mich waren. Da Frank Stremmer von Berufswegen zu einer internationalen Genfer Organisation gehört, kommen auch viele englisch- und auch französischsprachige Abschnitte vor, die nicht übersetzt sondern so in die Handlung mit einfliessen. Für diejenigen, die sowohl der Englischen als auch der Französischen Sprache nicht mächtig sind, wird der Handlungsverlauf dadurch, nochmals erschwert.
Um mich für die Geschichte von Frank Stremmer begeistern zu können, hat auch die Erzählstimme von Erich Wittenberg nichts rausreißen können, sodass mich der Handlungsverlauf irgendwann nur noch gelangweilt und weder mitreisen noch faszinieren konnte. Auch konnte ich der Handlung und dem 12 Frauen Projekt nichts abgewinnen und bin sogar mit dem abrupten Ende ziemlich ratlos zurück geblieben. Wobei die Grundidee eigentlich nicht die schlechteste ist, mich anfangs sogar fasziniert hat, doch für meinen Geschmack einfach sehr plump, Atmosphärisch irritierende und verwirrend umgesetzt wurde, die mir so überhaupt nicht zugesagt hat. Schade eigentlich, denn das Hörbuch hatte mich anfangs sehr fasziniert, war aber dann doch ziemlich enttäuscht über die Umsetzung, der Umgang und das offene und überraschende Ende. Vielleicht bin ich mit vollkommen falschen Voraussetzungen an das Hörbuch gegangen, das mich schlussendlich jedoch nicht für sich begeistern konnte.
Der Dritte Teil der Stremmer-Triologie "Das Jahr der Frauen", beginnt vielversprechend, der jedoch zunehmen absurder, irritierender und düster wird. Ein Frauenverachtendes 12 Frauen Projekt, der so gar nicht nach meinem Geschmack war.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für