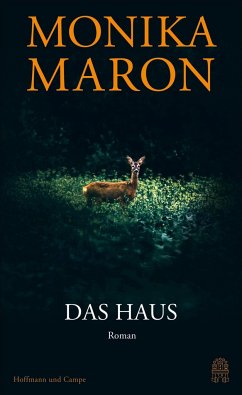Der neue Roman von Monika Maron!
Katharina, Tierärztin im Ruhestand, erbt ein abgelegenes Gutshaus nordöstlich von Berlin. Schnell ist die Idee geboren, dort eine Kommune mit Freunden einzurichten, um den steigenden Mietpreisen in Berlin zu entfliehen und im Alter nicht allein zu sein. Bei Eva, Katharinas Freundin, sträubt sich zunächst alles gegen die Vorstellung, mit Menschen jenseits der Sechzig zusammenzuziehen. Doch dann lässt sie sich notgedrungen auf das Experiment ein und akzeptiert einen Neuanfang.
Das Haus ist ein ebenso ergreifender wie weiser Gesellschaftsroman, in dem Monika Maron universelle Themen des Lebens, der Liebe und des Alters neu verhandelt.
Katharina, Tierärztin im Ruhestand, erbt ein abgelegenes Gutshaus nordöstlich von Berlin. Schnell ist die Idee geboren, dort eine Kommune mit Freunden einzurichten, um den steigenden Mietpreisen in Berlin zu entfliehen und im Alter nicht allein zu sein. Bei Eva, Katharinas Freundin, sträubt sich zunächst alles gegen die Vorstellung, mit Menschen jenseits der Sechzig zusammenzuziehen. Doch dann lässt sie sich notgedrungen auf das Experiment ein und akzeptiert einen Neuanfang.
Das Haus ist ein ebenso ergreifender wie weiser Gesellschaftsroman, in dem Monika Maron universelle Themen des Lebens, der Liebe und des Alters neu verhandelt.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Cornelia Geißler liest interessiert den neuen Roman von Monika Maron. Hier bezieht eine ehemalige Kulturjournalistin aus Berlin im fiktiven Bossin in Mecklenburg-Vorpommern ein Zimmer in einer Alten-WG, resümiert Geißler. Die anderen Charaktere werden abhängig von ihrer Beziehung zur "für Melancholie viel zu abgebrühten" Ich-Erzählerin mal mehr, mal weniger ausführlich beschrieben, erfahren wir. Das gemeinschaftliches Wohnen kommt dabei weniger vor, so Geißler, nur für Diskussionen am Küchentisch kommt über alle möglichen politischen Themen kommen die Bewohner zusammen, die Meinungen scheiden sich aber, als ein Hund adoptiert werde soll. Dabei fällt Geißler die Zurückhaltung der Autorin auf, etwas Streitbares in ihrem Roman zu vertreten. Durch den Brand von Notre-Dame und den Brand eines lokalen Waldes, lesen wir, verzweifeln Marons Charaktere schließlich. Wie Menschen ihre einstigen Gewissheiten verlieren: Das zeigt Maron hier "eindrücklich", schließt Geißler.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Altersroman im besten Sinne: "Das Haus" profitiert von seinem Thema ebenso wie von der Erfahrung der Autorin Monika Maron.
Von Andreas Platthaus
Von Andreas Platthaus
Auf Seite 112 von Monika Marons neuem Roman "Das Haus" wird ein anderer Roman erwähnt: "Unterleuten" von Juli Zeh. Erschienen 2016, wurde der so etwas wie das literarische Manifest des Stadt-Land- und des Ost-West-Gegensatzes, gelesen hier wie da. Vor allem aber dort, wo er spielt, im ländlichen Brandenburg, und deshalb muss Monika Maron den von Juli Zeh nach deren fiktivem Handlungsort gewählten Buchtitel gar nicht mehr nennen, wenn es um die Verdrossenheit der Bürger jenes Dorfes nahe der polnischen Grenze geht, das nun wiederum sie sich ausgedacht hat: "Die machen ja doch, was sie wollen, sagte sie und wischte mit einer resignierten Handbewegung ein paar Staubkörner vom Tisch. Sie klärte uns über die unterschiedlichen Interessenlagen im Dorf auf. Wer Land hat, ist natürlich für die Windräder, weil er jedes Jahr eine Menge Geld für die Pacht kassiert. Es gibt sogar einen Roman darüber, den haben hier alle gelesen, genau so ist es. Aber was soll man machen."
Monika Marons Unterleuten heißt Bossin, und das bei ihr titelgebende Haus ist ein renovierter Herrensitz, in dem sich die bereits über siebzigjährige Icherzählerin Eva im Frühjahr 2019 einer erst kürzlich begründeten Alters-WG zugesellt. Acht Menschen finden sich zusammen: neben Eva noch deren beste Freundin Katharina, die das Haus geerbt und den anderen mietfrei zur Verfügung gestellt hat, dann Evas älteste (aber eben nicht beste) Freundin Sylvie, das Akademikerehepaar Müller, die ehemalige Buchhändlerin Mary, der verwitwete homosexuelle Galerist Michael und der von seiner zwanzig Jahre jüngeren Gattin verlassene Physiker Johannes. Bis auf Letzteren, der zuvor in Dresden lebte, sind alle aus Berlin nach Bossin aufs Land gezogen.
Dieses Modell der Lebensführung hat Konjunktur, nicht nur in der Realität, sondern längst auch literarisch. Nicht nur "Unterleuten" lässt grüßen (und wird gegrüßt), auch Daniela Krien hat vor zwei Jahren einen thematisch eng verwandten Roman herausgebracht, der zum Bestseller avanciert ist: "Der Brand", in dem es allerdings um ein Urlaubshaus ging, also eine temporäre Bleibe, in die sich ein mittelaltes Paar aus Dresden während der Corona-Pandemie für gerade einmal drei Wochen zurückzieht. Aber Setting und Motivation sind die gleichen, und auch die splendid isolation der Hausbewohner beider Bücher entsprechen einander. Mit den einheimischen Dörflern gibt es jeweils kaum Berührung; das eingangs zitierte Gespräch von Eva mit einer Frau aus Bossin gehört schon zu den intensivsten Kontakten zwischen Haus und Ort in Monika Marons Roman. Man genügt sich selbst in der Alters-WG, bleibt auswärtig, ist wie im Dauerurlaub, weil die ganzen Zumutungen des Alltags zurückgeblieben sind - "ich begann mich nach Bossin zu sehnen, nach der Stille, nach dem Haus mit seinen Bewohnern, die nicht zueinander passen, aber auf eine gewisse Weise doch", stellt Johannes nach seiner Rückkehr von einem zwischenzeitlichen Besuch in Dresden fest, "ich sehnte mich nach der Neutralität des Ortes, in der man nicht Partei sein musste, wo man schweigen durfte, wenn man nicht reden wollte". Mag sich die Welt doch wandeln, solange sie nur den Weg nach Bossin nicht findet.
Der Konflikt mit dem übrigen Ort, der sich nicht in herrschaftlichem Ambiente vor der Wirklichkeit verschanzen kann, wäre programmiert, so könnte man meinen, doch er tritt nicht ein. Das unterscheidet Monika Marons Buch von Juli Zehs, und man darf deshalb gespannt sein, ob auch "Das Haus" zur Standardlektüre im realen Handlungsumfeld werden wird. Zu wünschen wäre es, denn Maron hat nach einigen gesellschaftspolitisch erregten Büchern wieder zur kühlen Abgeklärtheit jener Analysen zurückgefunden, die ihr Schreiben vom legendären Debüt "Flugasche" (1981, noch als DDR-Autorin geschrieben, aber nur im Westen erschienen) über den Roman "Animal triste" (1996) bis zum Großessay "Bitterfelder Bogen" (2009) auszeichnete. Natürlich spielt dabei eine Rolle, dass Maron selbst sogar schon die achtzig hinter sich gelassen hat und sich also in die Müdigkeit ihres neuen Romanpersonals angesichts der Zumutungen eines sich verändernden Umfelds hineindenken kann, aber wie sie das ohne jeden billigen Zorn über diese Entwicklungen tut, das kann man resignativ oder altersweise nennen - es ist jedenfalls das Psychogramm einer Generation, die in den kommenden Jahrzehnten einen immer größeren Anteil an der Gesellschaft einnehmen wird. Und noch einen sehr kleinen Anteil an dem hat, was in deutscher Prosa erzählt wird. Aber es ist ja auch noch ein relativ junges Phänomen, dass Schriftsteller so alt werden und dabei nicht nur aktiv bleiben, sondern sich auch dem widmen, was ihnen beim Altwerden widerfährt.
Monika Marons Icherzählerin hat dabei jenen Außenseiterstatus inne, den die Autorin selbst gerne kultiviert. Eva ist wider Willen in Bossin, denn man hat sie aus der Berliner Wohnung getrieben, und städtischer Ersatz ist unfinanzierbar für eine ehemalige Rundfunkredakteurin (so gut scheinen die Altersbezüge der Öffentlich-Rechtlichen nicht zu sein). Nach Bossin geht Eva nach eigener Überzeugung jedoch nur als Notlösung, zum Übergang, und als zuletzt Angekommene und eigentlich bereits wieder Absprungbereite schaut sie auf die noch locker etablierten Strukturen und Psychodynamiken des noblen Ruhesitzes wie eine Ethnologin in teilnehmender Beobachtung. Dass sich die im Haus versammelte Gemeinschaft nicht nur aus Schöngeistern rekrutiert - Galerist und Physiker sind praktisch veranlagt, Frau Müller agiert als durchaus subtile Manipulatorin -, macht das Ganze beim Lesen nur noch interessanter. Wie auch die Tatsache, dass die Handlung im Jahr 2019 angesiedelt ist, also gerade noch vor der Pandemie. Unser Wissen um sie aber setzt alle Erwägungen des Romanpersonals betreffs erwünschter Isolation in ein grelles Licht.
Dass es Schwächen gibt in "Das Haus" - es ist unbenommen. Bisweilen verliert Maron den Überblick über ihr Konstrukt (so feiert Sophie zum Beispiel früh im Buch ihren achtundsechzigsten Geburtstag, der achtzig Seiten später dann als siebenundsechzigster bezeichnet wird), und das Fanal des Brandes von Notre-Dame zu Beginn des Geschehens wird über die Schilderung des folgenden Glutsommers von 2019 zur plakativen Feuermetapher, die schließlich konkrete Gestalt annimmt - was mittlerweile jedoch keine Originalität mehr für sich beanspruchen kann. Kriens Roman trug das Thema ja schon im Titel, Christian Petzold hat in seinem jüngsten Spielfilm "Roter Himmel" mit dem Feuer mehr als nur gespielt, und in Marion Poschmanns neuem Roman, "Chor der Erinnyen" (F.A.Z. vom 10. Oktober), ist die Gefahr von Waldbränden ebenfalls präsent. Aber wer Marons "Das Haus" als Roman einer Gesellschaft liest, in der es brennt, begeht einen Fehler. Die Illusionen, die er in Rauch aufgehen lässt, sind höchst private. Und das wahre Risiko ist der Rückzug.
Monika Maron: "Das Haus" Roman.
Hoffmann und Campe, Hamburg 2023.
237 S., geb., 25,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Wer Marons Roman als Roman einer Gesellschaft liest, in der es brennt, begeht einen Fehler. Die Illusionen, die er in Rauch aufgehen lässt, sind höchst private.« Andreas Platthaus Frankfurter Allgemeine Zeitung

In Monika Marons Roman „Das Haus“ zieht eine Gruppe Senioren aufs Land. Ihre Lebensrückblicke sind oft bitter, aber der Ton der Erzählung ist sanft.
Auf dem offenen Land irgendwo im Norden Berlins, erzählt Monika Maron, nicht weit von der polnischen Grenze, habe bis vor einigen Jahren ein Gutshof gelegen, ein herrschaftliches Gebäude mit einem säulengeschmückten Portal, mit einem Park und einem weiten Blick auf die Landschaft. Durch eine unerwartete Erbschaft sei dieses Gebäude, frisch renoviert, in die Hände Katharinas gelangt, einer pensionierten Tierärztin aus der Stadt.
Da diese weder allein auf dem Gutshof leben noch es verkaufen wollte, habe Katharina einige Freunde und Bekannte eingeladen, mit ihr zusammen als Alterskollektiv auf das Gut – von einem Spötter auch „Gnadenhof“ genannt – zu ziehen. Und weil die ehemalige Kulturredakteurin Eva, die Erzählerin, zu eben dieser Zeit ihre Wohnung in Berlin verlor, sei auch sie eingezogen, allen persönlichen Widerständen und Vorbehalten zum Trotz. Ihre Zigaretten nahm sie mit.
Einsamkeit ist das Schicksal vieler älterer Menschen, vor allem wenn sie alleinstehend sind. Diese Einsamkeit ist nicht nur das Ergebnis einer Abwertung des Alters in einer Gesellschaft, die an die Jugend glauben, dem Fortschritt huldigen und von vergangenen Leistungen nichts mehr wissen will. Sie ist auch die andere Seite einer individuellen Freiheit, die man in jungen Jahren erwarb und als Errungenschaft wahrnahm: auf niemanden mehr Rücksicht nehmen zu müssen, sich den eigenen Anliegen widmen können, wider die Familie, wider die heimatliche Umgebung, wider die Klassenzugehörigkeit, war ein seltenes Privileg gewesen, bevor es in den Sechziger- oder Siebzigerjahren zu einer Möglichkeit wurde, die Männern und Frauen offenstand. Die sieben Menschen, die Monika Maron auf den Gutshof Bossin ziehen lässt, gehören dieser Altersgruppe an. Die Erfahrungen, die sie in einem weitgehend selbstbestimmten Leben gemacht haben, bringen sie mit, und sie scheinen nicht zuletzt bitterer Natur gewesen zu sein.
Da ist Eva selbst, eine Einzelgängerin, die einst dennoch liebte. Doch der Mann trank sich um den Verstand und in den Tod. Da ist Katharina, die nun in Jeans und Lederjacke auftritt und einst einen Geliebten zwang, seine Frau zu verlassen und sie zu heiraten, woran die neue Ehe bald scheiterte. Da ist Sylvie, die Übersetzerin, die immer allein lebte und sich im Alter eine Gemeinschaft wünscht, wie sie diese vor vierzig, fünfzig Jahren vielleicht in einer Wohngemeinschaft erlebte – oder nunmehr glaubt, damals erlebt zu haben.
Und da ist das Ehepaar Müller, sie gewesene Deutschlehrerin, er ein von einem Schlaganfall nur halb genesener emeritierter Althistoriker. Die beiden erhoffen sich vom Leben auf dem Gutshof eine Versicherung, im Fall einer kommenden Gehirnblutung nicht allein zu sein. Monika Maron erzählt von diesen Menschen und ihrem Zusammenleben in einem ruhigen, gelassenen Tonfall, der über die allfälligen Konflikte und Katastrophen des Zusammenlebens hinwegreicht und doch keinen Zweifel daran lässt, dass man es hier mit nicht immer angenehmen Menschen zu tun hat. Im Zweifel hilft offenbar der Wein, der, mehr noch als der Gutshof, das Bindeglied der Gemeinschaft zu sein scheint.
Vertraut sind diese Gestalten und ihre Erlebnisse, vor allem für Menschen desselben Alters. Ein Buch für junge Leute ist „Das Haus“ kaum, für Ältere wird das Wiedererkennen groß sein, so wie es in allen späten Büchern Monika Marons der Fall ist. Ihr jüngstes Werk ist einer immer länger werdenden Lebensphase gewidmet, in der es keine Karriere und keinen Aufstieg mehr gibt, in dem die Verantwortung für andere Menschen klein und die finanziellen Verhältnisse halbwegs gesichert sind. In diesen Jahren ist man alt und fürchtet sich doch vor dem Alter, man ist noch einigermaßen beieinander, körperlich und geistig, und weiß doch, dass es bald mit schnellen Schritten dem Tod entgegengehen wird.
So ausgedehnt und auch: so widersprüchlich ist diese Lebensphase mittlerweile, dass sie sich mit Ideen von einem neuen Leben verbindet, während Großmutter und Großvater als Möglichkeiten des Daseins verblassen. Das milde Licht, das Monika Maron zumindest zu Beginn der Geschichte über ihre Gestalten ausgießt, ist daher einerseits den Umständen angemessen, andererseits ein Abwehrzauber: Denn jeder in dieser Gruppe weiß (und die Leser wissen es auch), dass der Pflegefall womöglich schon wartet. Man rückt zusammen, weil man zu ahnen glaubt, was kommen wird. Am Ende des Buches wird der Beginn eines neuen Jahres gefeiert. Es ist das Jahr 2020. Was dann kommt, nämlich die Pandemie, ahnt man allerdings nicht, weder auf Gut Bossin noch anderswo.
Das Buch hat noch kaum begonnen, da brennt die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Das Datum ist also der 15. April 2019. Große Aufregung herrscht im Wohnkollektiv, alle Mitglieder sitzen vor dem Fernseher (überhaupt fällt auf, dass auf dem Gut noch die „Tagesschau“ gesehen wird), aus dem Raucherzimmer wird Wein geholt. Die Kommentare sind erwartbar und abgenutzt: Von einem „Wahrzeichen des europäischen Christentums“ ist die Rede, von der „Nation“, mit und ohne Anführungszeichen, von „unserem Schicksal“.
Es wird noch zweimal brennen in diesem Buch, und jedes Mal rückt das Schicksal näher. Hinter dem Geplapper über die kulturelle oder historische Bedeutung der brennenden Kirche verbirgt sich denn auch etwas Größeres: eine vage Erinnerung daran, dass eine gotische Kathedrale einst der ins Gigantische getriebene Ausdruck eines Verlangens nach Erlösung war, ein metaphysisches Bauwerk, wenn es denn je eines gab.
Es hieße, den kleinen Roman zu überfordern, wollte man den geläufigen Redensarten eine tiefere, womöglich sogar abgründige Absicht unterstellen. Aber das bedeutet nicht, dass es die Erinnerung nicht gäbe. Im Gegenteil, es mag sich mit ihr verhalten wie mit dem Rauch der Zigaretten. Er zieht dahin, ein triviales Zeichen für etwas sicherlich Ungesundes. Ein Vorbote der Katastrophe. Und doch ein Ausdruck für eine Hoffnung, die es nach wie vor gibt, obwohl man weiß, dass sie nicht eingelöst werden kann.
THOMAS STEINFELD
Die vage Erinnerung, dass es einmal eine Sehnsucht nach Erlösung gab: Die Schriftstellerin Monika Maron.
Foto: Jonas Maron
Monika Maron:
Das Haus. Roman.
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2023. 240 Seiten, 25 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de