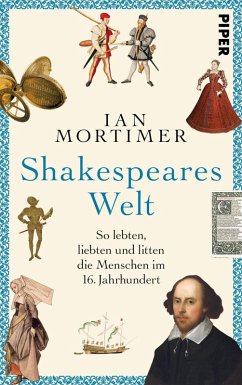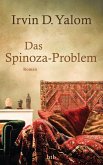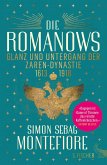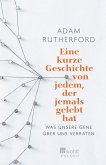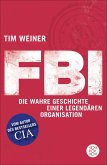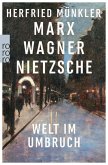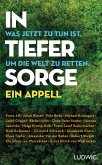Shakespeare lebte in einem Zeitalter neuer Horizonte und großer Umbrüche. Bestsellerautor Ian Mortimer betrachtet das späte 16. Jahrhundert aus einer völlig neuen Perspektiven. Königin Elisabeth I., William Shakespeare, Sir Francis Bacon: Diese historischen Figuren sind zwar bestens bekannt, doch Ian Mortimer gelingt es auf besondere Weise, ihnen Leben einzuhauchen und das »Goldene Zeitalter« Englands so schillernd und greifbar darzustellen, als wäre er selbst durch die Straßen von London und Stratford gezogen. »Shakespeares Welt« untermalt Wissen nicht nur mit wundervollen Anekdoten, dieses Buch zeigt auch die Widersprüche und Abgründe dieser Zeit. Während die Königin ihre Flotte in neue Welten schickte, herrschten Krankheiten, Hungersnöte und Gewalt in den Straßen Englands. »Ein amüsanter und verständlicher Reiseführer durch vergangene Zeiten.« – Sunday Times Wer Geschichte verstehen will, muss in sie eintauchen und sie erleben. Geht es um das England des 16. Jahrhunderts, schafft dies kaum jemand besser als Ian Mortimer. »Shakespeares Welt« ist Reiseführer und Zeitmaschine, Nachschlagewerk und ein echter Spaß. Das neue Buch des Erfolgsautors von »Im Mittelalter« und »Zeiten der Erkenntnis« Ian Mortimer hat seinen Blick für alle Aspekte von Geschichte geschärft, die Menschen der heutigen Zeit begeistern und mitreißen. Er recherchiert genau, liebt die Details und nimmt sich als Erzähler dennoch zurück. Das macht seine Geschichtsbücher zu den unterschiedlichsten Epochen und Themen zu einem echten Lesevergnügen für Einsteiger und erfahrene Leserinnen und Leser.