Insgesamt 210 Bewertungen
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



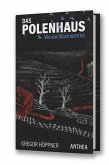
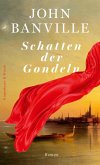


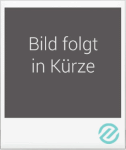

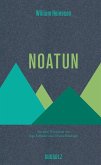
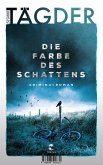
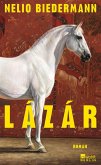
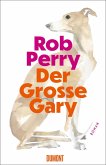
Benutzer