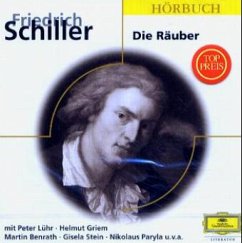Schillers 'Räuber' von 1781 galten schon zu ihrer Entstehungszeit als unerhörte Radikaldramatik. Allein die Rahmenhandlung: Bruderzwist im Hause Moor. Franz, ein intellektuelles Scheusal sondergleichen, intrigiert gegen Karl, den vom Glück verwöhnten Lieblingssohn des Vaters. Ein gefälschter Brief genügt, und aus dem rousseauistisch angehauchten Sympathieträger Karl wird ein 'schäumend auf die Erde stampfender' angry young man, der sich auf ein verklärtes Räuberleben im böhmischen Wald einlässt. Von der Uraufführung 1782 an feierte dieses früheste Schiller-Stück mit seinen kraftstrotzenden Monologen sensationelle Erfolge auf der Bühne und riss immer wieder vor allem junge Zuschauer mit. Eine besonders mehrheitsfähige Inszenierung gelang 1968 Hans Lietzau im Münchner Residenztheater. Sie wurde 1969 zum Berliner Theatertreffen eingeladen, ging anschließend auf gefeierte Tournee nach Moskau und St. Petersburg und ist für die Deutsche Grammophon ungekürzt mitgeschnitten worden. Die Kritik lobte einmütig die stimmige Regie und die geschlossene Ensembleleistung. Der Karl Moor von Helmut Griem wurde als 'ungeheuerlich' bezeichnet.

Lauter große Worte, wie aus einem Literaturfilm. Alte Aufnahmen der Dramen Schillers schwanken zwischen Pathos, Prätension und Extremismus.
Auf diese Frau war Don Carlos nicht gefasst. Er hört die Laute spielen, der Vorsaal ist offen, unversehens steht er vor ihr: „Gott, wo bin ich. Sie? Prinzessin Eboli?” - „Prinz Carlos”. In einer Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1953 sprechen Hans Quest und Hilde Krahl diesen Dialog (nicht ganz von Schiller) sehr gediegen, in der Manier der alten Schule. Der Hörer wäre nicht überrascht, käme im nächsten Augenblick Hans Moser herein, um Tee zu servieren. Schiller klingt in diesem Fall keineswegs verstaubt, vielmehr auf unglückliche Weise zeitlos. Der hohe Ton, die „Heute-geben-wir-Klassiker”-Art des Sprechens wirken so überzeugend wie Stilmöbel mit eigens angebrachter Patina. Es gibt auf den sechs Hörbüchern mit Aufnahmen aus den fünfziger und sechziger immer wieder Augenblicke, in denen die Figuren wie aus einem Literaturfilm zu uns zu sprechen scheinen. Und dass ist nur zum Teil damit erklärt, dass man die großen Schauspieler, die hier versammelt sind, auch vom Abspann kennt. Das ungewollt Prätentiöse scheint eine Schwundstufe des Pathetischen, das nun einmal zu diesem Dichter gehört; man mag sich noch so bemühen, ihn gegen seine früheren Verwalter und Verehrer zu verteidigen und ihn dem 19. Jahrhundert zu entreißen.
Die Begegnung zwischen Don Carlos und der Prinzessin Eboli ist für die Rundfunkaufzeichnung aufs Nötigste zusammengestrichen worden. Schon die Textkürzungen zeigen, dass man der komplizierten, zwischen Extremen schwankenden Gefühlsmechanik dieser Szene nicht recht traute. Aber verdrängtes, verkleinertes Pathos rächt sich unverzüglich. Werden die großen Worte naiv oder verschämt gesprochen, klingen sie, das Hörbuch ist hier grausamer als die Bühne, immer nach Stilmöbel und Samtvorhang.
Dabei ist Schillers Pathos, auch das kann man an diesen Aufnahmen studieren, alles andere als Ausdruck eines schlichten, zum idealischen Schwung geneigten Gemüts. Es ist vielmehr das Handwerkszeug eines kühl kalkulierenden Extremisten. Der Schlachtruf „Freiheit!”, auf den Schiller in diesem Jahr verkürzt wird, kann ja nicht verdecken, dass zumindest seine Dramen von inniger Vertrautheit mit dem Fundamentalismus zeugen. Gewiss, es gibt Momente der Befreiung, aber keine selbstgewisse Freiheit. Im Gegenteil, gerade die Helden, die wie Carlos, Karl Moor oder Ferdinand am lautesten von Freiheit und Ungebundenheit schwärmen, stolpern über ihre eigenen Füße, erliegen weniger den bösen Umständen als sich selbst. Der Dramatiker Schiller scheint eine Lust daran zu haben, nicht nur immer neue Hindernisse auf seine Helden zu türmen, sondern zu zeigen, wie gebunden, abhängig, letztlich Zufällen anheim gegeben sie sind, wie unsicher der Ausgang ihrer souveränen Handlungen.
Das Pathos ist das Instrument, mit dem dieser Extremist seine Figuren zum Äußersten treibt. Sie reihen Wort an Wort - und schon hängt ihr Kopf in der Schlinge. Schiller tut, was sein Schüler Kleist später beschrieb: Er führt vor, wie Gefühle und Gedanken beim Reden allmählich entstehen.
Man hört es in der berühmten Szene III,4 aus „Maria Stuart” - dem Treffen der Rivalinnen, die beide daran scheitern, Königin und Frau zugleich zu sein. In der Aufnahme aus dem Jahr 1954 spricht Paul Wessely die Maria. Trotz des „Ich-bin-Schauspielerin”-R wirkt ihr Pathos vollendet natürlich. Wenn Maria versucht, ihre Gegnerin davon zu überreden, dass ein ungreifbarer Dritter, „ein böser Geist”, Schuld an der Entzweiung trage, dann gewinnt Paula Wesselys Stimme Wärme und Biegsamkeit. Sie scheint die kalte Elisabeth gleichsam umarmen zu wollen oder einzulullen, als brächte sie ein Kind ins Bett. Trotz der Nachgiebigkeit, zu der Maria sich zwingt, bleibt ihre Stimme hart und fest, bestimmt wie die eines Hypnotiseurs. Dass Edith Heerdegen darauf wie eine frustrierte Räubertochter antwortet, mag den Konventionen der Regie geschuldet sein, die nicht wahrhaben will, dass Maria und Elisabeth spiegelbildliche Charaktere sind.
Paula Wessely folgt bedacht und ihrer Mittel sehr bewusst dem Gang der Worte - und steht, weil sie ganz die Figur verkörpert, neben ihrer Rolle, als hätte sie den Schiller-Schüler Brecht gelesen. Die Leidenschaft zur Selbstbeobachtung teilen ja viele Schiller-Helden.
Im zweiten Glücksfall unter diesen Aufnahmen ist zu erleben, wie einer die Distanz zum eigenen Tun und Reden aufgibt. Karl Moor hat den Brief aus der Hand seines Bruders Franz erhalten und zerreißt, Worte von sich stoßend, Metaphern häufend, das Band zwischen sich und seiner Vergangenheit. In der Aufführung des Bayerischen Staatsschauspiels aus dem Jahr 1969 gibt Helmut Griem den Karl. Dessen Fluch auf die Welt zu sprechen, ohne das Publikum zum Lachen zu bringen, dürfte zum schwersten gehören. Hier gelingt es. Griem besitzt eine jugendliche Stimme, der man vieles glaubt und vollendet das Meisterstück dadurch, dass er rast, ohne zu brüllen, atemlos immer rascher wird, stolpert fast, bis er erschöpft pausiert - und für die Sache der Räuber gewonnen ist. Er hat sich den Boden unter den Füßen fortgeredet.
Heute werden Schillers pathetische Wort gern ungläubig, ironisierend oder beiläufig verschämt gesprochen. Das gibt dann Stilmöbel anderen Zuschnitts. Man sollte Paula Wessely, Helmut Griem und vielleicht noch Fritz Benscher als Gessler hören und wird merken, dass die großen Worte nicht peinigen müssen, sondern zwingend klingen können, wenn sie nicht als Botschaft, sondern als Lebensluft der Figuren erscheinen dürfen. Wer dagegen Schillers Pathos umgehen will, so oder so, hat allen Grund, sich vor ihm zu fürchten.
Friedrich Schiller
Die Räuber. Kabale und Liebe. Don Karlos. Wallensteins Tod. Maria Stuart. Wilhelm Tell
Deutsche Grammophon. Berlin 2005. je 8 Euro.
Fritz Kortner in „Don Carlos” am Berliner Hebbel-Theater, 1950.
Foto: SV
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Ironische Selbstporträts, Selbstrezensensionen sowie Bitt- und Bettelbriefe: Die Trouvaillen zum zweihundertfünfzigsten Geburtstag von Friedrich Schiller.
Schon wieder ein Schiller-Jubiläum! Der zweihundertste Todestag wurde vor vier Jahren aufwendig zelebriert, jetzt steht schon der 250. Geburtstag an. Die Kalendersklaven schwächeln, auf dem Buchmarkt scheint das Pulver weitgehend verschossen. Was will man nach der Springflut an Biographien, den großen Editionen und kleinen Textausgaben, den Brevieren und Zitatschätzen noch bieten, von Heimatkundlichem und unvermeidlichen Konferenzbänden ganz abgesehen? Entdeckungen sind gleichwohl in einigen Nischen zu machen, die man sich durch Rüdiger Safranskis glänzendes Doppelporträt der Dioskuren (F.A.Z. vom 14. Oktober) nicht verschatten lassen möchte.
Zum dreißigsten Geburtstag seines Freundes Gottfried Körner zeichnete Schiller 1786 mit farbiger Tusche einen frechen Comic, versehen mit Erläuterungen von Ludwig Ferdinand Huber. Da sieht man etwa Körner, wie er über seiner Kant-Lektüre einschläft, einigen Damen den Hintern zukehrt, seinem verständnislosen Vater die "Räuber" vorbuchstabiert, sich ohne Glück für eine Ägypten-Expedition engagiert oder als Schriftsteller erbärmlich unproduktiv ist. Schiller fügt sich selbst in den Zyklus ein, mit fliegenden Rockschößen steht er hier auf dem Kopf, also so, "wie ihn verschiedne vernünftige Leute gesehen haben". Erstmals 1862 erschien diese kecke Bildgeschichte, die bislang in allen Schiller-Ausgaben fehlt und als Taschenbuch (Insel Verlag, 1987) längst vergriffen ist. Ein von Rose Unterberger zusammengestelltes "biographisches Bilderbuch" zeigt jetzt wenigstens das ironische Selbstporträt neben anderen selten gesehenen Illustrationen, etwa Johann Adolf Rossmäslers Stich "Die Xenienritter": Sekundiert von Athene, schlägt dort Schiller mit der Faust ins Gesicht des Kritikers Friedrich Nicolai, während Herder sich bereits am Boden wälzt und Goethe feige im Busch lauert.
Auch in anderen Neuerscheinungen übt Schiller seinen Kopfstand. Dieter Hildebrandts hübsch illustrierte Sammlung von Parodien zeigt, dass es durchaus Raffinierteres gibt als das bekannte Kurzgedicht: "Loch in Erde, / Bronze rin, / Glocke fertig, / Bimm, bimm, bimm." Schillers Gedichte über Glocken und Taucher, über Freiheit, Frauen und die Freude lockten den Spott von August Wilhelm Schlegel bis Bertolt Brecht am stärksten an. Daraus folgt keineswegs das beliebte Vorurteil, Schillers Lyrik habe wenig Wert. Anhand der "Anthologie auf das Jahr 1782", die jetzt - nach einem Reprint aus dem Jahr 1973 - wieder als gediegener Nachdruck vorliegt, kann man solche Verdikte leicht auf den Kopf stellen. Die "Anthologie", die sich als geschlossenes Gemeinschaftswerk der Freunde um Abel, von Hoven oder Petersen in keiner der großen Ausgaben findet, enthält nämlich den jungen Schiller in der Nuss: Nicht nur ist hier seine Theosophie, Liebesphilosophie und Anthropologie in Gedichten wie "Die Freundschaft" oder den Laura-Oden lyrisch verdichtet, sondern es zeigt auch den Kritiker im Kampf mit dem schwäbischen Almanach-Herausgeber Gotthold Friedrich Stäudlin. In einer anonymen Selbstrezension setzt Schiller noch eins drauf und fordert weniger "Stinkrosen und Gänseblumen" sowie eine "strengere Feile" in der eigenen Sammlung.
Eine weitere editorische Lücke schließt das Soufflierbuch der legendären "Räuber"-Uraufführung in Mannheim. Bodo Plachta ediert jetzt, was sich bisher in keiner Gesamtausgabe findet: Es ist die vom Intendanten Dalberg veranlasste und ohne Schillers Zutun entstandene Bühnenbearbeitung des zuvor erschienenen "Schauspiels" (1781). Viele Änderungen der "Trauerspiel"-Fassung (1782) bereitet sie vor. Plachtas "Studienausgabe" stellt erstmals alle drei Versionen nebeneinander. Nur so begreift man Unterschiede zwischen dem gelesenen und dem inszenierten Stück - etwa die Selbsterdrosselung von Franz Moor. Sie findet auf der Bühne gar nicht statt, und auch andere Unschicklichkeiten entfallen. Bevor sein Bruder Karl sich für "tausend Louisdore" (Erstausgabe) oder "hundert Dukaten" (Trauerspiel) selbst an die Justiz ausliefert, verkündet er nur in Mannheim: "Auch ich bin ein guter Bürger, erfüll ich nicht das entsezliche Gesetz, Ehr ich es nicht, räch ich es nicht?" So manches rasche Urteil von Germanisten über dieses Theaterdebüt dürfte mit Blick auf die jetzt endlich leicht verfügbaren drei Varianten ins Wanken geraten.
Finanziell waren die "Anthologie" und die "Räuber" eine Pleite. Auch spätere Werke konnten das relativ schmale Salär als Geschichtsprofessor in Jena und Hofrat in Weimar nicht in erforderlicher Höhe aufbessern: Vierhundert Taler im Jahr, das markierte für eine bürgerliche Familie eher die Untergrenze. Gegenüber Goethes Ministergehalt von 3100 Talern und einem zuletzt viermal so hohen Haushaltsvolumen wirkt es gar bescheiden. Auch in dieser Hinsicht stellte sich Schiller gern protestierend auf den Kopf: Christiana Engelmann verschafft mit einer - auch für jugendliche Leser - charmanten Sammlung von Schillers Bitt- und Bettelbriefen einem wenig beachteten Genre Geltung. In vielfältigen Tonlagen umgarnt der Dichter alle, die im Besitz des "allgewaltigen Mammons" sind: Stets fordert er mit zwingenden Gründen, wirbt unwiderstehlich um Wohlwollen, versichert jede kleine Verlegenheit als bloß vorübergehend, rückt den drohenden "Würgengel" effektvoll ins Licht. "Zum Kaufmann schicke ich mich überhaupt so wenig als zum Kapuziner", heißt es da einmal. Sicher aber zum wortgewandten Rhetoriker.
Das persönlichste Buch über Schiller legt in diesem Herbst Rüdiger Görner vor. Es sind kritische Reflexionen, Aphorismen, Szenen und zum Glänzen gebrachte Lesefrüchte. Görner gruppiert sie um den von Eckermann gestifteten Mythos von Schillers faulen Äpfeln. Angeblich sollen diese dem Dichter "als Urfrucht, als verfallende Versuchung" zur sinnlichen Stimulation des Geistes gedient haben oder umgekehrt als Anker und Erdung beim erhabenen Höhenflug ins Intelligible. Görner versteht sich auf die geistige so gut wie auf die ästhetische Schätzung: Feinsinnig durchstreift er als professioneller Deuter das Werk, von den "Räubern" bis zum "Wallenstein", vom Grammont-Bericht bis zu den Kallias-Briefen.
Als schreibender Leser beantwortet er einzelne Wendungen und Ideen Schillers hingegen poetisch, lauscht dem Chor der Nachwelt und verhehlt nicht die eigene Passion. Manches wirkt dabei intim und berührend - etwa das Nachdenken über Schillers Verständnis von Würde als "Ruhe im Leiden". Görner befällt es am Bett seines sterbenden Vaters, dem der Band gewidmet ist. Seiner eigenen Frage, ob "Schillers Werk der faule Apfel in der Schublade der Moderne" sein könnte, also unser aller Stimulans, haftet keine bemühte Aktualisierung an. Vielmehr lädt sie zu einer unbelasteten Lektüre ein, die keine Angst vor einem kopfstehenden Klassiker hat.
ALEXANDER KOSENINA.
Rüdiger Görner: "Schillers Apfel". Szenen, Gedanken und Bilder. Zu Schillers 250. Geburtstag. Berlin University Press, Berlin 2009. 144 S., 900 numerierte Expl., geb., 64,- [Euro].
"Loch in Erde, Bronze rin . . ." Schiller-Parodien oder der Spottpreis der Erhabenheit. Hrsg. von Dieter Hildebrandt. Hanser Verlag, München 2009. 96 S., geb., 6,90 [Euro].
Friedrich Schiller: "Anthologie auf das Jahr 1782". Hrsg. von Matthias Luserke-Jaqui. Conte Verlag, Saarbrücken 2009. 291 S., geb., 29,90 [Euro].
Friedrich Schiller: "Die Räuber". Studienausgabe. Hrsg. von Bodo Plachta. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 2009. 368 S., br., 8,80 [Euro].
"Gnädigster Herr, ich habe Familie". Schillers Bitt- und Bettelbriefe. Hrsg. und kommentiert von Christiana Engelmann. Sanssouci im Hanser Verlag, München 2009. 80 S., geb., 12,90 [Euro].
Rose Unterberger: "Friedrich Schiller". Orte und Bildnisse. Ein biographisches Bilderbuch. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2008. 240 S., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main