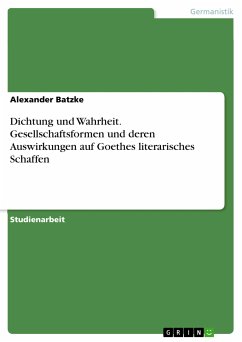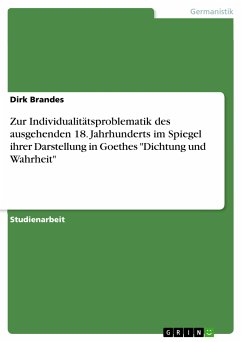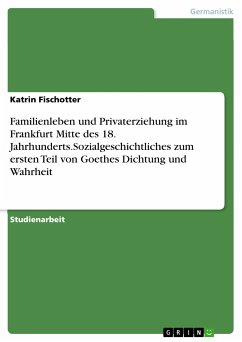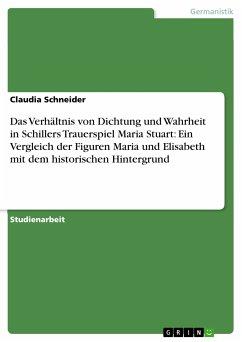Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 2,3, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Hauptseminar: Goethes 'Dichtung und Wahrheit' in komparatistischer Sicht, Sprache: Deutsch, Abstract: Schon oft ist darüber gerätselt worden, inwiefern die Ereignisse in Goethes Dichtung und Wahrheit1 autobiographisch oder doch mehr dichterisch sind. Auch in bezug auf die Sesenheim2-Periode Goethes – die Zeit, in welcher Goethe Friederike Elisabetha Brion kennenlernte und eine Liebschaft mit ihr hatte – sind immer wieder Nachforschungen angestellt worden. In der nun folgenden Arbeit geht es darum, die Darstellung der Sesenheimer Zeit im neunten und zehnten Buch vorwiegend unter den dichterischen Aspekten zu betrachten. Im Gegensatz zu anderen Sekundärtexten ist es nicht das Ziel, möglichst viele biographische Begebenheiten aus dem Text abzuleiten. Somit wird Goethe hier mehr als Romanschreiber anstatt als Autobiograph gesehen. Es soll eine Darstellung der Komposition der entsprechenden Episode gegeben werden. Hierzu wird die Episode unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet; vor allem aber auf dem Hintergrund idyllischer Grundlagen und in diesem Zusammenhang auch im Hinblick auf Oliver Goldsmiths Vicar of Wakefield3. Goethe schreibt in einem Brief an Eckermann4 bezüglich der Sesenheim- Episode: „Daß darin kein Strich enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strich so wie er erlebt worden“5. Insofern hat es seine Berechtigung, die Sesenheim- Episode auch unter dichterischen Gesichtspunkte zu betrachten. Bereits die Schilderung der Zeit vor Goethes Sesenheim Besuch zeigt, daß Goethe es in diesem Teil mit den biographischen Fakten nicht so genau nimmt und statt dessen der dichterischen Konstruktion den Vorzug gibt. [...] 1 Veröffentlichung vgl.: Goethe Handbuch: Goethe seine Welt und Zeit in Werk und Wirkung, Bd. 1, Stuttgart 1961, S.1815 „...die Ausführung der drei ersten Teile [erfolgte] in raschem Zuge von Ende Januar 1811 bis November 1813 (Veröffentlichung 1811, 1812, 1814), während die Arbeit am vierten Teil sich auf die Jahre 1812, 1813, 1816, 1821, 1824, 1825, 1830, 1831 zersplitterte“, Veröffentlichung des vierten Teils 1833 2 Eigentlich Sessenheim; Goethes Schreibweise wird jedoch in der Arbeit beibehalten 3 Oliver Goldsmith: Vicar of Wakefield; Erstveröffentlichung 1766 4 Johann Peter Eckermann (1792-1854) 5 Vgl.: Lawrence Marsden Price: Goldsmith, Sesenheim, and Goethe, in: The Germanic Review 4 (1929), S.237-247, hier: S.241