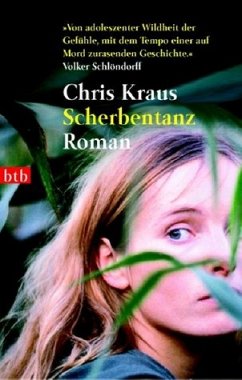Jesko ist sterbenskrank. Aber lieber stirbt Jesko, als dass er von seiner Mutter, einer geistesgestörten und heruntergekommenen Alkoholikerin, Hilfe erbittet. Seine wohlhabende Familie will ihn zu seinem Glück zwingen und sperrt ihn eine Woche mit der verhassten Mutter zusammen. Eine Woche Familiendrama. Eine Woche dunkler Geheimnisse, seelischer Verwüstungen und unlösbarer Familienbande. Für alle LeserInnen von Peter Stamm und Arnold Stadler.

Chris Kraus trägt keine Hosen:
Der Roman „Scherbentanz”
Sind Tod und Kleidung nur zwei verschiedene Arten, den Leib zu verwandeln? Jesko von Solm, der 33-jährige Sohn des Zementfabrikbesitzers Gebhard Hyronimus von Solm, würde ob dieser Frage mit den Achseln zucken und, wie so oft, Seneca zitieren, doch Jeskos Lebensgeschichte beweist den engen Zusammenhang von Tod und Tuch, von Mode und Mortalität aufs Schönste, aufs Traurigste. Jesko lebt aus Selbstschutz in den Tag hinein, weil dessen Zumutungen ihn früh genug erreichen. Modedesigner nennt er sich, Röcke trägt er, denn „ich glaube nicht mehr an Hosen.” Kein Requisit, kein Accessoire und um Himmels willen keine Notwendigkeit soll den Menschen sein, was sie am Körper tragen. Hosen, Röcke, Blusen sind hartnäckige Vorboten des Jenseits, dem das Leben entgegen schlittert. Jesko trägt Röcke, weil er weiß, dass der Tod in ihm haust, und weil er ahnt, „wie knapp unser Dasein ins Sichtbare ragt”.
Jürgen Vogel spielt den leukämiekranken Jesko im erstaunlichsten deutschen Film des Jahres 2002. „Scherbentanz”, beim Münchner Filmfest im Juli mit dem Preis für das beste Drehbuch bedacht und vom 31. Oktober an bundesweit zu sehen, ist nicht das Buch zum Film, sondern der Roman, der als Film sich entpuppte. Der 39-jährige Regisseur und Autor Chris Kraus führt – entgegen dem Klappentext – keineswegs vor, „welche Anstrengungen das Leben bereitet, wenn es nicht echt ist”; Authentizität ist kein Kriterium für Glück, sie verhindert auch nicht Mühsal. Kraus umkreist in seinem Debüt vielmehr das Scheitern illusionärer Lebensentwürfe, die an der Wirklichkeit des Gegenübers zerschellen.
Ich-Erzähler Jesko möchte die Nemesis über seine Familie bringen, über Vater und Bruder vor allem, will ihnen „das Glück aus den Knochen saugen, das sie sich anmaßen, erschleichen, rauben, unredlich erwerben”, will langsam zerschmelzen „wie eine Polkappe, um Unglück über die Menschheit zu bringen”. Hinter großen Worten verbirgt sich eine kleine Sehnsucht: nicht mittun beim Lügen und Verheimlichen will er, damit er sich das Recht auf Leben verdient. Einen Widerpart aber, mit dem er rechten könnte, findet er nicht, die Mutter ist alkoholkrank und verwahrlost, der Vater nimmt ihn nicht ernst, Bruder Ansgar will im beruflichen wie sexuellen Fortkommen nicht gestört werden. Also klagt Jesko sich selbst an, richtet Reden und Predigten an sein eigenes Ich: „Alles, worauf du jemals stolz sein könntest, endet im Abfall. Du verschwindest. Und wenn du verschwunden bist, wird es sein, als wärst du niemals dagewesen.”
Ein Hiob und ein Kohelet will er sein, ein Robin Hood und ein Künstler: zu viele Ansprüche für ein lädiertes Selbstbewusstsein, das nach innen wütet, sich nach außen abschottet. Umgekehrt verhält es sich bei seiner Mutter, die er Käthe nennt. Sie tobt, bis sie erschöpft ist, und fällt dann weich in ihre Phantasmen zurück. Vor 23 Jahren sahen Jesko und Ansgar sie zum letzten Mal. Sie hielt ein Beil in Händen und ging auf ihre Söhne los. Irre war sie geworden an der Untreue des Gatten. Nach der Entlassung aus der Psychiatrie verloren sich ihre Spuren. Ein Privatdetektiv stöberte sie auf, im Pulk der Obdachlosen. Ihr Knochenmark soll Jesko retten. Käthe aber hält sich für eine Schatzsucherin und Geheimagentin, gräbt Gebhards Garten um auf der Suche nach spanischen Galeonen, mäht ein riesiges Hakenkreuz in den Rasen, überfällt die Hausbank der Familie und will von einer Transplantation nichts wissen. Alles wird ihr zum Rätsel: „Reichwerden! Altwerden! Wo ist da der Unterschied?”
Am Ende des Staubsaugerlochs
Wenn Jesko sich selbst zu deuten versucht, entgleitet ihm die Sprache. Dann bleiben ihm Phrasen, wie jene vom „wankelmütigen, unsicheren, unzuverlässigen Schneiderlein, das die unmittelbar einleuchtende Richtigkeit, die Kleidung im Idealfall transzendiert, immer knapp verfehlt.” Wenn Jesko sich bemitleidet, gelingen ihm nur schiefe Bilder, wie jenes von der „geflügelten Bitterkeit, die im Rhythmus der Zugvögel verlässlich entkommt”. Wenn Jesko die Innensicht verlässt, stellen Poesie und Erkenntnis sich ein: An der Seite Simones, der ehemaligen Braut von Ansgar, gewinnt er die Zukunft zurück; sie legten sich „eng ineinander, umschlangen sich trostlos, einer dem anderen ein Halt am Ende dieses Staubsaugerlochs, das die Welt war”.
Obwohl Jesko einen Knochenmarkspender findet und obwohl Familie Solm aus Nazis und Angebern besteht, ist der Roman weder kitschig noch klischeehaft geraten. Die teils expressionistisch knappe, teils barock ausschweifende Sprache lässt gerade so viel Welt in sich ein, wie nötig ist, um dem Autismus zu entgehen. Nicht jede Wendung ist gelungen, von der „Schwachmatenmeute” führt ein abschüssiger Weg zum „Fass voller Jahre, das niemand aufschlagen konnte”. Meist aber hält Chris Kraus die Balance zwischen Pathos und Lakonie. Und dass die junge wie die alte Frau Mama, der im Film erst Andrea Sawatzki, dann Margit Carstensen Profil verleiht, ansatzlos vom Delirium in die Bauernschläue, von der Pfiffigkeit in den Hass überwechselt, sorgt auf der Leinwand wie im Buch für emotionale Unwetter. „Scherbentanz” ist eine mutige Irrfahrt in die menschliche Seele, die ihre Geheimnisse zu offenbaren beginnt, sobald sie das „keusche Sakko” der Selbstbezüglichkeit von sich wirft. ALEXANDER KISSLER
CHRIS KRAUS: Scherbentanz. Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2002. 200 Seiten, 17,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
»Chris Kraus ist ein besessener Erzähler.« Martina Knoben / Süddeutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung