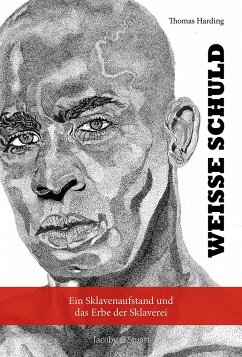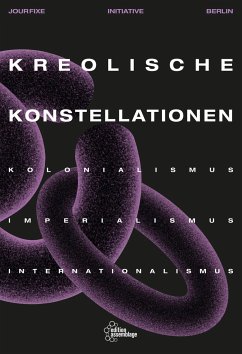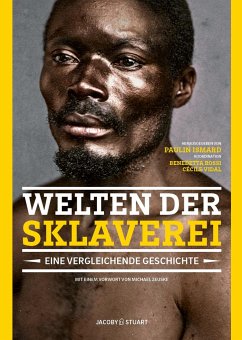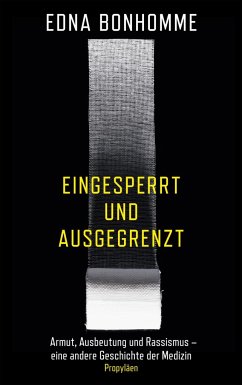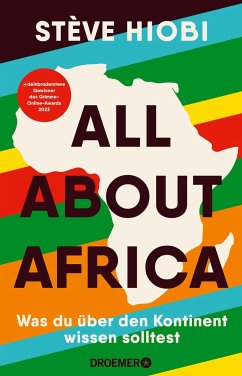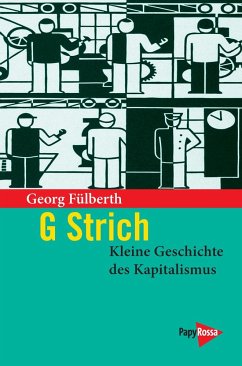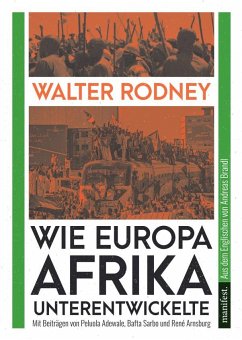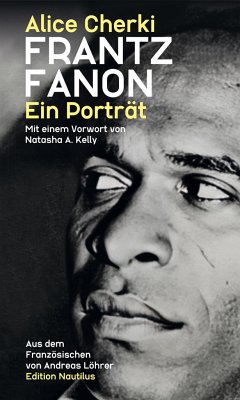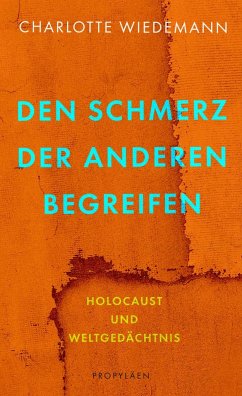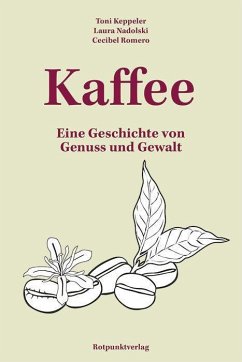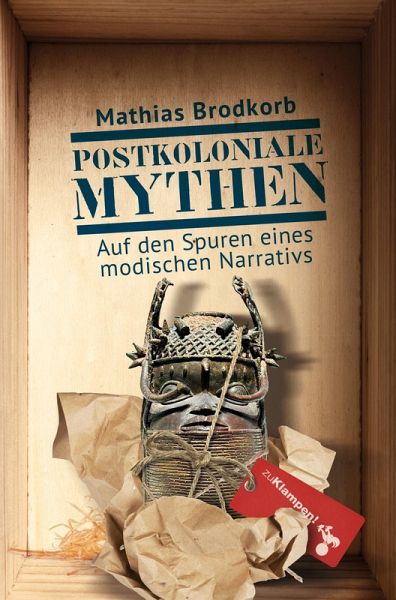
Postkoloniale Mythen
Auf den Spuren eines modischen Narrativs. Eine Reise nach Hamburg und Berlin, Leipzig, Wien und Venedig

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die deutsche Kolonialgeschichte währte ganze 35 Jahre. Erst 1884 begann das Deutsche Kaiserreich, auf dem afrikanischen Kontinent sogenannte Schutzgebiete zu errichten, verlor diese aber bereits 1919 an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Mit dem Ende des Kolonialismus jedoch, so wollen uns postkoloniale Aktivisten und ihre universitären oder musealen Stichwortgeber weismachen, kamen Ausbeutung, Kunstraub, Versklavung und Rassismus keineswegs zu einem Ende. Sie leben angeblich im postkolonialen Zeitalter fort, nur raffinierter. Da gibt es viel wiedergutzumachen.Mathias Brodkorb hat sich...
Die deutsche Kolonialgeschichte währte ganze 35 Jahre. Erst 1884 begann das Deutsche Kaiserreich, auf dem afrikanischen Kontinent sogenannte Schutzgebiete zu errichten, verlor diese aber bereits 1919 an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Mit dem Ende des Kolonialismus jedoch, so wollen uns postkoloniale Aktivisten und ihre universitären oder musealen Stichwortgeber weismachen, kamen Ausbeutung, Kunstraub, Versklavung und Rassismus keineswegs zu einem Ende. Sie leben angeblich im postkolonialen Zeitalter fort, nur raffinierter. Da gibt es viel wiedergutzumachen.Mathias Brodkorb hat sich auf den Weg begeben und die Hotspots der postkolonialen Wiedergutmachung im deutschsprachigen Raum aufgesucht, die ehemaligen Völkerkundemuseen. Statt ihrer Aufgabe des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Ausstellens nachzugehen, sind sie vorrangig mit der Verfertigung des eigenen guten Gewissens beschäftigt. Zu diesem Zweck werden nicht nur Fakten verschwiegen, die nicht ins Bild passen, sondern mitunter auch historische Dokumente verfälscht. Viele Museen sind zu »Ideologiemaschinen« geworden um den weißen Westen einer ewigen Schuld zu überführen.