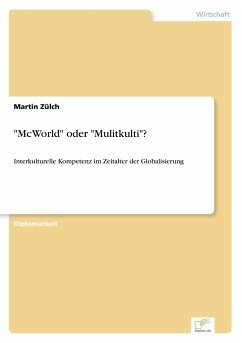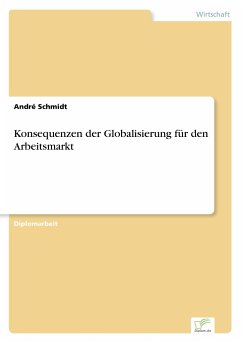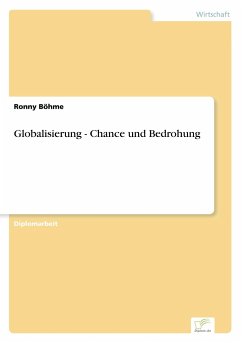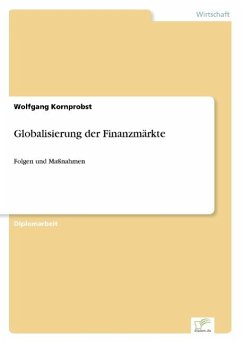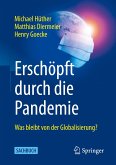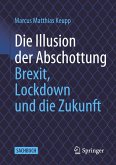Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 1,7, Universität Trier (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Ein Klempner wird zu einem Reparaturauftrag zu einer türkischen Familie geschickt. Nachdem der Familienvater ihm die Haustür geöffnet hat, bittet er den Klempner höflich, sich vor dem Betreten der Wohnung die Schuhe auszuziehen. Dieser ist darüber verwundert, empfindet das Anliegen als erniedrigend und schläft deshalb die Bitte ab. Es kommt zu einer Auseinandersetzung in der der Hausherr darauf hinweist, es entspreche den türkischen Gepflogenheiten, als Gast niemals ein fremdes Haus in Straßenschuhen zu betreten. Dies habe religiöse Gründe, da in seiner Religion Haus und Hof heilig seien. Der Klempner erwidert, er sei nicht als Gast, sondern zum Arbeiten gekommen und habe noch nie während der Arbeit die Schuhe ausziehen müssen. Da es zu keiner Einigung kommt, zieht der Klempner unverrichteter Dinge wieder ab und stellt der Familie seine Fahrtkosten in Rechnung. Der türkische Familienvater weigert sich, die Rechnung zu bezahlen und begründet dies damit, der Klempner habe ja keine Leistung erbracht. Der Streit hierüber geht vor Gericht und wird von Instanz zu Instanz unterschiedlich entschieden, bis in der letzten Instanz die türkische Familie Recht bekommt: Das Gericht erkennt den religiösen Hintergrund des Ansinnens des türkischen Familienvaters an und verweist in seiner Urteilsbegründung auf die in Deutschland geltende Freiheit der Religionsausübung.
Diese Begebenheit ist tatsächlich in Deutschland passiert. Der Konflikt hätte vermieden werden können, wenn beide Beteiligten, jedoch insbesondere der Klempner, sich interkulturell kompetent verhalten hätten. Interkulturelle Kompetenz als menschliche Fähigkeit und Qualifikation ist das Thema dieser Arbeit. Diese Qualifikation wird häufig im Zusammenhang mit weltweiten Phänomenen am Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts genannt, die mit dem Begriff Globalisierung umschrieben werden.
Dieser Arbeit liegen zwei Forschungsfragen zugrunde: Zum einen soll geklärt werden, welche kulturellen Auswirkungen die Globalisierung hat und welche Folgerungen sich daraus für den Stellenwert interkultureller Kompetenz ergeben. Zum anderen wird erörtert, wie interkulturelle Kompetenz erworben werden kann.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Teil dieser Arbeit (Gliederungspunkt 2) werden die konzeptionellen Grundlagen zur Klärung dieser Fragen gelegt, in dem die der Thematik innewohnenden zentralen Begriffe Kultur, interkulturelle Kompetenz und Globalisierung veranschaulicht und definiert werden.
Im darauffolgenden Teil (Gliederungspunkt 3) werden die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung anhand einer Gegenüberstellung zweier polarisierender Thesen untersucht. Die erste These wird mit dem Schlagwort McWorld belegt. Hier wird davon ausgegangen, dass infolge der Globalisierung eine kulturelle Homogenisierung stattfindet: in diesem Szenario dominiert die Kultur der westlichen Industrienationen, vor allem die der USA, weltweit lokale Kulturen. Die Folge ist eine Kulturschmelze, die in letzter Konsequenz zu einer weltweiten Einheitskultur führt. Diese kann Lokalkulturelles ersetzen oder zumindest verdrängen. Logische Konsequenz wäre ein sinkender Stellenwert interkultureller Kompetenz, da man sich in Interaktionssituationen unabhängig von der Herkunft des Gegenübers auf eine gemeinsame kulturelle Basis verlassen könnte.
Das Schlagwort Multikulti bezeichnet die entgegengesetzte These. Sie besagt, dass infolge der Globalisierung eine Diversifizierung lokaler und individueller Kulturen stattfindet. Diese geht mir einem gestiegenen Bewusstsein der eigenen kulturellen Identität einher. Dies wiederum bedeutet, dass im Zuge der Globalisierung der interkulturellen Kompetenz ein gestiegener Stelle...
Ein Klempner wird zu einem Reparaturauftrag zu einer türkischen Familie geschickt. Nachdem der Familienvater ihm die Haustür geöffnet hat, bittet er den Klempner höflich, sich vor dem Betreten der Wohnung die Schuhe auszuziehen. Dieser ist darüber verwundert, empfindet das Anliegen als erniedrigend und schläft deshalb die Bitte ab. Es kommt zu einer Auseinandersetzung in der der Hausherr darauf hinweist, es entspreche den türkischen Gepflogenheiten, als Gast niemals ein fremdes Haus in Straßenschuhen zu betreten. Dies habe religiöse Gründe, da in seiner Religion Haus und Hof heilig seien. Der Klempner erwidert, er sei nicht als Gast, sondern zum Arbeiten gekommen und habe noch nie während der Arbeit die Schuhe ausziehen müssen. Da es zu keiner Einigung kommt, zieht der Klempner unverrichteter Dinge wieder ab und stellt der Familie seine Fahrtkosten in Rechnung. Der türkische Familienvater weigert sich, die Rechnung zu bezahlen und begründet dies damit, der Klempner habe ja keine Leistung erbracht. Der Streit hierüber geht vor Gericht und wird von Instanz zu Instanz unterschiedlich entschieden, bis in der letzten Instanz die türkische Familie Recht bekommt: Das Gericht erkennt den religiösen Hintergrund des Ansinnens des türkischen Familienvaters an und verweist in seiner Urteilsbegründung auf die in Deutschland geltende Freiheit der Religionsausübung.
Diese Begebenheit ist tatsächlich in Deutschland passiert. Der Konflikt hätte vermieden werden können, wenn beide Beteiligten, jedoch insbesondere der Klempner, sich interkulturell kompetent verhalten hätten. Interkulturelle Kompetenz als menschliche Fähigkeit und Qualifikation ist das Thema dieser Arbeit. Diese Qualifikation wird häufig im Zusammenhang mit weltweiten Phänomenen am Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts genannt, die mit dem Begriff Globalisierung umschrieben werden.
Dieser Arbeit liegen zwei Forschungsfragen zugrunde: Zum einen soll geklärt werden, welche kulturellen Auswirkungen die Globalisierung hat und welche Folgerungen sich daraus für den Stellenwert interkultureller Kompetenz ergeben. Zum anderen wird erörtert, wie interkulturelle Kompetenz erworben werden kann.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Teil dieser Arbeit (Gliederungspunkt 2) werden die konzeptionellen Grundlagen zur Klärung dieser Fragen gelegt, in dem die der Thematik innewohnenden zentralen Begriffe Kultur, interkulturelle Kompetenz und Globalisierung veranschaulicht und definiert werden.
Im darauffolgenden Teil (Gliederungspunkt 3) werden die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung anhand einer Gegenüberstellung zweier polarisierender Thesen untersucht. Die erste These wird mit dem Schlagwort McWorld belegt. Hier wird davon ausgegangen, dass infolge der Globalisierung eine kulturelle Homogenisierung stattfindet: in diesem Szenario dominiert die Kultur der westlichen Industrienationen, vor allem die der USA, weltweit lokale Kulturen. Die Folge ist eine Kulturschmelze, die in letzter Konsequenz zu einer weltweiten Einheitskultur führt. Diese kann Lokalkulturelles ersetzen oder zumindest verdrängen. Logische Konsequenz wäre ein sinkender Stellenwert interkultureller Kompetenz, da man sich in Interaktionssituationen unabhängig von der Herkunft des Gegenübers auf eine gemeinsame kulturelle Basis verlassen könnte.
Das Schlagwort Multikulti bezeichnet die entgegengesetzte These. Sie besagt, dass infolge der Globalisierung eine Diversifizierung lokaler und individueller Kulturen stattfindet. Diese geht mir einem gestiegenen Bewusstsein der eigenen kulturellen Identität einher. Dies wiederum bedeutet, dass im Zuge der Globalisierung der interkulturellen Kompetenz ein gestiegener Stelle...