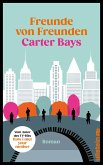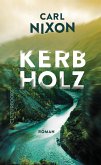Bringt eine Erbschaft den Sandmanns das Glück?
Für Tatjana, Nikolai und ihre zehnjährige Tochter Marie kommt sie fast überraschend: die Erbschaft von Tante Rose, die ihnen ein neues Leben ermöglicht. Aus der liebgewonnenen Altbauwohnung ziehen sie in Tante Roses Villa und in ein Viertel mit vermögenden Nachbarn, die alle Geheimnisse zu haben scheinen. Was zunächst anmutet wie die Erfüllung eines Traums, stellt die Familie bald auf eine schwere Probe.
Literarisch raffiniert und mit feinem Gespür für seine Figuren und ihre Lebenswelten erzählt Georg Oswald von schlummernden Sehnsüchten und platzenden Illusionen. Eine Parabel unserer Zeit.
»Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt.« SZ
»Eine ruhig und fein erzählte Geschichte mit einem bösen doppelten Boden.« Elke Heidenreich, Kölner Stadtanzeiger
»Georg M. Oswald benutzt literarisches Präzisionswerkzeug, um die Merkmale und die Unterschiedezwischen den Schichten fein herauszuarbeiten. Er zeigt auf amüsante und vor allem durch und durch wiedererkennbare Weise, dass sich ein Wechsel zwischen den Schichten auch heute noch nur mit erheblichem sozialem Getöse vollziehen lässt.« Juli Zeh, Podcast "Edle Federn"
»Zu seinen Stärken zählt die ironische Beschreibung einschlägiger Milieus sowie die Wandlung der Sandmanns von linksliberalen, engagierten Hipstern zu neuen Großbürgern.« WDR 3, Lesestoff
Für Tatjana, Nikolai und ihre zehnjährige Tochter Marie kommt sie fast überraschend: die Erbschaft von Tante Rose, die ihnen ein neues Leben ermöglicht. Aus der liebgewonnenen Altbauwohnung ziehen sie in Tante Roses Villa und in ein Viertel mit vermögenden Nachbarn, die alle Geheimnisse zu haben scheinen. Was zunächst anmutet wie die Erfüllung eines Traums, stellt die Familie bald auf eine schwere Probe.
Literarisch raffiniert und mit feinem Gespür für seine Figuren und ihre Lebenswelten erzählt Georg Oswald von schlummernden Sehnsüchten und platzenden Illusionen. Eine Parabel unserer Zeit.
»Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt.« SZ
»Eine ruhig und fein erzählte Geschichte mit einem bösen doppelten Boden.« Elke Heidenreich, Kölner Stadtanzeiger
»Georg M. Oswald benutzt literarisches Präzisionswerkzeug, um die Merkmale und die Unterschiedezwischen den Schichten fein herauszuarbeiten. Er zeigt auf amüsante und vor allem durch und durch wiedererkennbare Weise, dass sich ein Wechsel zwischen den Schichten auch heute noch nur mit erheblichem sozialem Getöse vollziehen lässt.« Juli Zeh, Podcast "Edle Federn"
»Zu seinen Stärken zählt die ironische Beschreibung einschlägiger Milieus sowie die Wandlung der Sandmanns von linksliberalen, engagierten Hipstern zu neuen Großbürgern.« WDR 3, Lesestoff
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Oliver Jungen begreift nicht, wieso Georg M. Oswald seiner Geschichte um eine Mittelschichtsfamilie, die plötzlich zu Reichtum kommt, so derart langweilig erzählt. Haut schon der Plot den Rezensenten nicht vom Hocker, auch wenn Oswald Moralfragen verhandelt und Gesellschaftskritik übt, bringen ihn eine geheimnislose Sprache, öde Dialoge, lieblos entworfene Figuren und die vielen Klischees im Text regelrecht zur Verzweiflung. Wirkt wie die vereinfachte fiktive Adaption einer Reportage von Julia Friedrichs, meint Jungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Im Roman „In unseren Kreisen“ schildert Georg M. Oswald den Versuch einer Familie, der Gewöhnlichkeit ihrer Existenz zu entkommen
Nachdem Tante Rosi im ersten Kapitel zu „gehen“ beschließt und im zweiten das Wasserglas samt Barbiturat „langsam, aber in einem Zug“ trinkt, kommt im dritten die Gemüselasagne auf den Tisch ihrer Nichte Tatjana. Gleich wird das Telefon klingeln, gleich wird sie von Rosis Tod und ihrer Erbschaft erfahren, aber noch wird über Schule diskutiert, die doofe Lehrerin, Maries gefährdeter Übertritt aufs Gymnasium, die eigentlich doch so begabte Tochter. Es ist dieser Moment, in dem man ahnt, was für Leute das sind, Tatjana, Nikolai und Marie Sandmann, oder besser: was für Leute sie beschlossen haben zu sein.
Nicolai und Tatjana Sandmann sind Kulturbetriebsmenschen. Er ist Schriftsteller, sie arbeitet für eine Galerie, ihre Eltern haben ihnen diese künstlerischen Lebenswege durch Fleiß und Sparsamkeit ermöglicht. Selbstverständlich lebt man in einer (nicht genannten) Stadt, in einer dieser viel zu kleinen, viel zu teuren Altbauwohnung, umringt von ähnlichen Familien, die sich auch permanent fragen, wie das eigene Leben möglichst geschmackvoll gelingen kann. Auch redet man sich seit Längerem erfolgreich ein, dass es im Leben nicht um Geld, sondern um Selbstverwirklichung gehe, unter Wahrung moralischer Standards natürlich, und im Fall der Sandmanns: dass ihre Tochter Marie auch ohne Abitur glücklich werden könne, ja dass diese „Bildungsbesessenheit in Wahrheit nur Statusbesessenheit“ sei, was aber nicht bedeutet, dass man es nicht trotzdem besser fände, wenn sie eines hätte.
Nach Tante Rosis letztem Willen soll Tatjana eine Villa im Philosophenviertel im Wert von 2,5 Millionen und noch mal dieselbe Summe als Geldvermögen bekommen. Laut Nachlassverwalterin genug, um die Steuern zu bezahlen, das Haus herzurichten und „ein äußerst angenehmes Leben zu führen“. Tatjana und Nikolai reagieren unterschiedlich: Während sie sich das „äußerst angenehme Leben“ gut vorstellen kann, ahnt er, dass so eine Erbschaft eine „lebensverändernde Tatsache“ sein und die Identität, die man jahrelang aufgebaut, verfeinert und schließlich akzeptiert hat, grundlegend erschüttern kann. Immerhin steht die eigene „moralische Glaubwürdigkeit“ auf dem Spiel. Auf einmal müssen Antworten auf Fragen gefunden werden, die sie sich vorher nie gestellt haben: Welches Leben ist richtiger, besser, aufrichtiger? War das frühere nur ein Arrangement? Ist das neue ein Schwindel?
Der 1963 geborene Münchner Schriftsteller Georg M. Oswald, der im Neben- oder Hauptberuf (das kann nur er wissen) als Rechtsanwalt tätig ist, hat einen typischen Oswald-Milieu-Roman geschrieben, gedankenanregend, fein beobachtetet, mit großem Identifikationspotenzial für alle, die in einem der gentrifizierten Bullerbü-Viertel in München, Hamburg, Berlin über- und nebeneinanderwohnen, als hätte ihnen jemand den Befehl dazu gegeben. Ein Roman wie eine soziologische Studie, nur dramatischer, auch verwickelter; als wäre Pierre Bourdieus Habitus-Theorie zur Erzählung geronnen, diese „strukturierte und strukturierende Struktur“, die halb bewusst, halb unbewusst die eigene Identität formt. Auch diesmal wieder streift Oswald, der bereits in früheren Romanen die Selbsttäuschungen bürgerlich-akademischer Lebensentwürfe seziert hat, juristische Fragestellungen, die von Rechts wegen nicht eindeutig erfasst oder gelöst werden können und deshalb erzählt werden müssen, denn die Villa hat eine Geschichte, eine Vergangenheit.
Einstweilen aber fügen sich die Sandmanns ihren neuen finanziellen Möglichkeiten: Der Umzug wird nicht von Freunden, sondern von einem Unternehmen erledigt, endlich kann man auch ohne schlechtes Gewissen im Nobel-Supermarkt einkaufen und die Tochter auf eine dieser elitären Privatschulen schicken und sei es nur, weil man beim Kennenlerngespräch mit der Direktorin eine mittelgroße Spende in Aussicht stellt. Mit den neuen Möglichkeiten gehen aber auch neue Zwänge einher. Man verändert sich, nein, muss sich verändern, weil man sonst hier nicht reinpasst, abgestoßen wird, nicht „ankommt“ im neuen Leben.
Nikolai sieht die Verluste, Tatjana die Möglichkeiten, er fremdelt, sie gibt ihr Bestes: „Wir müssen hierbleiben. An unserer Position arbeiten. Wir sind schließlich in der Probezeit.“ Leider entpuppt sich der neue Nachbar, ein wohlhabender „Entrepreneur und Philantropist“ als übergriffig, mochte Marie die alte Wohnung lieber als die Villa mit ihrer vornehm-bedrückenden Leere, schlittert Nikolai in eine Schreibblockade, sogar das Rauchen fängt er wieder an, heimlich, wie ein Schulbub im Garten, um sich der eigenen Nutzlosigkeit zu versichern. Wie ein Mantra dröhnt es in seinem Kopf, „hoffentlich haben wir keinen Fehler begangen, keinen nicht wiedergutzumachenden Fehler“.
Im letzten Drittel entwickelt der Roman thrillerhafte Züge. Erste Andeutungen fallen auf einer Spritztour im BMW-E-Cabrio des neuen Nachbarn; in der Nähe des Philosophenviertels befinde sich die Reichssiedlung Rudolf Heß samt opulenter Villa für Martin Bormann. Je tiefer Nikolai in die Historie seiner neuen Umgebung vordringt, desto mehr zeigt sich: Hier stimmt was nicht. Dann eskaliert ein Gartenfest, und Nikolai erfährt, dass auch ihre Villa einer jüdischen Familie gehört hat, bevor der Schwiegervater von Tante Rosi sie in einem für ihn „sehr günstigen Moment“ erworben habe. Ja, es ist nur der Schwiegervater der Tante seiner Frau, aber nicht zu leugnen: Die Sandmanns leben in einem Haus, in dem sie nicht leben sollten, auf dem eine Schuld liegt; eine Pointe, die den Roman gegen Ende auf eine historisch-philosophische Ebene hebt: Geschmacksfragen sind das eine, das andere unsere vielfältigen und oft paradoxalen Verstrickungen in das Schicksal anderer Menschen.
„In unseren Kreisen“ dreht sich um Fragen der Distinktion, Lebenslügen und den rührenden Versuch, die Gewöhnlichkeit der eigenen Existenz erträglich zu gestalten. Zumal Oswald in einem Seitenstrang eine weitere Existenzform skizziert: das aufregende Leben der Erbtante Rosi, die mit Anfang zwanzig nach Kalifornien geht, ihren späteren Mann Rudolf kennen lernt, einen exzentrischen Therapeuten und Anhänger Wilhelm Reichs, samt erfolgreicher Praxis in Berkeley. Ein Leben also, das – anders als das ihrer Nichte – wirklich frei war und dementsprechend furchtlos und selbstbestimmt endet.
Zwar ist es schade, dass Oswald seinen Stoff ganz am Ende nicht mehr auserzählt, sondern referiert – Ferdinand von Schirach macht das auch gern, eine sorgfältig aufgebaute Erzählung mit einer Art Schlussplädoyer aufzulösen, in dem die Vor- und Hintergrundgeschichte als Tatsachenbericht zusammengefasst werden – , doch handelt es sich lediglich um einen Schönheitsfehler in einem gelungenen, ja fesselnden Roman, der raffiniert vorführt, wie wenig wir unseren Geschmack, unsere Vorurteile, unser Schicksal im Griff haben, und was für eine jederzeit gefährdete Konstruktion das eigentlich ist: das eigene Leben.
TOBIAS HABERL
Ist es moralisch in Ordnung,
in eine Villa zu ziehen,
nur weil man sie geerbt hat?
Wer hier wohnt, wohnt gut – und hat womöglich geerbt: das „Treppenviertel“ in Hamburg Blankenese.
Foto: imago/Westend61
Georg M. Oswald: In unseren Kreisen. Roman. Piper, München 2023. 208 Seiten, 24 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»'In unseren Kreisen' spielt so klug wie unterhaltsam mit unseren Gewissheiten.« Madame 20230601

Schusters Leisten hat ausgedient: Georg M. Oswald erzählt von den Kalamitäten des gesellschaftlichen Zufallsaufstiegs nach einem Erbfall in München
Von Klassismus ist in jüngster Zeit wieder viel die Rede. Neu ist weder die damit angesprochene Haltung, der Dünkel gegenüber ärmeren, statusniedrigeren Gesellschaftsschichten, noch der ins neunzehnte Jahrhundert zurückreichende Begriff. Die neuerliche Konjunktur hat wohl mit einer wachsenden Aufmerksamkeit für Diskriminierungen zu tun, aber auch mit dem immer stärkeren Auseinanderklaffen der Gesellschaft in Besitzlose und Vermögende. Letztere sind oft Erben.
Erzählerisch interessant wird es natürlich immer dann, wenn die Sphären sich mischen. Unzählige Romane und Filme handeln vom Aufstieg armer Schlucker in den Kreis der Wohlhabenden, deren Codes sie oft nicht beherrschen, wahlweise als Tragödie ("Wiedersehen in Howards End"), als grelle Komödie (die "Flodder"-Filme) oder als Krimi ("Venedig sehen - und erben"). "My Fair Lady" und George Bernard Shaws "Pygmalion" als Vorlage dazu spielen umgekehrt damit, dass die Sprache der Upper Class erlernt werden kann: ohne die materielle Grundlage eine neue Form von Heimatlosigkeit.
Dass die Sphären auch in einer funktional und nicht mehr stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft noch klar getrennt sind, dass die feinen Unterschiede zwar noch feiner geworden sein mögen (etwa durch ironisches Kopieren des Unterschichtenverhaltens: die Lidl- Socken und Aldi-Tüten der Millionäre), aber genauso unübersteigbar sind wie früher, davon erzählt nun Georg M. Oswald in seinem neuen Roman. Eine Erbschaft katapultiert darin eine Münchner Familie aus dem unteren Kultur-Mittelstand - sie Museumskuratorin, er Schriftsteller mit frisierter Wikipedia-Seite, dazu eine schulisch strauchelnde Tochter - in höhere Kreise. Eine unkonventionelle Tante, leicht verstrahlte Ehefrau eines reichen Wilhelm-Reich-Schülers, hat den Sandmanns viel Geld und eine Villa vererbt. Das Anwesen liegt in einem Viertel der Gutbetuchten, das an Pullach erinnert (das Gelände des Bundesnachrichtendienstes mit seiner nationalsozialistischen Vorgeschichte wird thematisiert).
Millionäre über Nacht und ohne eigenes Zutun: Überzeugend schildert Oswald, dass sich dieser Aufstieg gegenüber den alten, materiell plötzlich abgehängten Freunden wie "Verrat" anfühlt, ein als unumgänglich angesehener freilich. Gut nachvollziehbar wirkt es auch, dass sich das Gefühl des Ungenügens und der Nichtzugehörigkeit aufseiten des Erzählers Nikolai zunächst zu Einsamkeit, dann zu Abneigung und schließlich in eine milde Form von Wahn steigert, bevor ein Todesfall Katastrophe und Rettung zugleich darstellt. Es handelt sich nämlich zugleich um eine Art Initiationsmoment.
Der leicht übergriffig inquisitorische Nachbar, ein selbst ernannter Philanthrop und Sohn eines Waffenhändlers, hatte sich zuvor des Schriftstellers Nikolai angenommen. Jede umgarnende Unterhaltung und jede Einladung entpuppt sich allerdings als manipulative Eingliederung des Neuen in die eigene Macht- und Diskursordnung. Tatjana Sandmann, die Erbin, entwickelt derweil von sich aus eine Ich-kaufe-die-Welt-Mentalität und erwirkt durch eine große Zuwendung einen Platz für die Tochter Marie an einer gefragten Privatschule: Hier scheint wenig Umerziehung nötig. Nikolai hingegen, der eben noch mit den rechtlosen Umzugshelfern gegen deren ausbeuterischen Chef fraternisiert hatte, bildet sich zumindest eine Weile lang ein, durch den neuen Reichtum moralisch nicht korrumpiert zu werden. In einer Mischung aus Neid und Verachtung blickt er auf das allzu glatte Leben des Nachbarn herab.
Als jedoch ein Versucher auftaucht, ein trinkender Kauz, der in der Rolle des Narren rücksichtslos die Wahrheit ausspricht - "das hier ist eine Versammlung von Nichtsnutzen" -, ohne deshalb ausgeschlossen zu werden, weil er selbst zur Millionärsclique gehört, da verhält sich auch Nikolai richtig im Sinne seiner neuen Nachbarschaft: Er nimmt den Ball nicht auf. Dass die Sandmanns sich schließlich entgegen dem ersten Impuls auch mit der Geschichte der Villa, die einmal einer jüdischen Familie gehört hatte, zu arrangieren wissen - immerhin gab es zwischenzeitlich eine Restitution, was die Schuldfrage zumindest ins Graue verschiebt -, ist die Probe aufs Exempel, "angekommen" zu sein. Moral, so sehen wir, steht im Kapitalismus nicht außerhalb; sie ist käuflich wie alles.
Es spricht nichts gegen eine solche, wenn auch schlichte Gesellschaftskritik aus der Innensicht. Aber warum muss das so dröge erzählt sein? Warum wirken die Dialoge dermaßen uninspiriert? Warum verzichtet der Autor zugunsten einer fast juristisch kargen, geheimnislosen Sprache auf jeden symbolisch-metaphorischen Mehrwert? Und warum werden beide Sphären - die der sich öffentlichkeitswirksam im Flüchtlingsrat engagierenden, falsche Giacomettis in ihren Garten stellenden Millionäre und die der linksbürgerlichen akademischen Kultur-Bubble inklusive Achtsamkeitsyoga und Flugscham - so klischeehaft geschildert?
Was man aus den unzähligen Berlin-Mitte-Romanen kennt, gibt es hier noch einmal im öden Erklärton: "Krabbelgruppenbekanntschaften beschränken sich aufseiten der Eltern üblicherweise auf das mehr oder weniger gequälte Beschwören angeblicher Gemeinsamkeiten." Die Sandmanns "wollten nicht nur tun, was gut für sie selbst war, sondern auch gut für andere. Dazu gehörten ein achtsamer, sorgfältiger und auch geschlechtersensibler Sprachgebrauch, fair gehandelter Kaffee, Mülltrennung, Verzicht auf Fleisch, und wenn das nicht möglich war, dann wenigstens welches vom Biometzger."
Mit einem derart standardisierten lieblosen Figurenarsenal und ohne wirkliche erzählerische Fallhöhe (es gibt dramatischere Plots als den Umzug in ein großes geschenktes Haus) wirkt das Buch eher wie eine simple fiktive Exemplifizierung der Klassengesellschaftsbestseller von Julia Friedrichs als wie ein subversiver Romanangriff auf die selbstzufriedene Oberschicht, wie das in Großbritannien etwa John Lanchester mit einiger Sprengkraft unternommen hat. Vielleicht sollte man Statusromane überhaupt den in Klassenfragen uneinholbaren Briten überlassen. OLIVER JUNGEN
Georg M. Oswald:
"In unseren Kreisen".
Roman.
Piper Verlag, München 2023. 208 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main