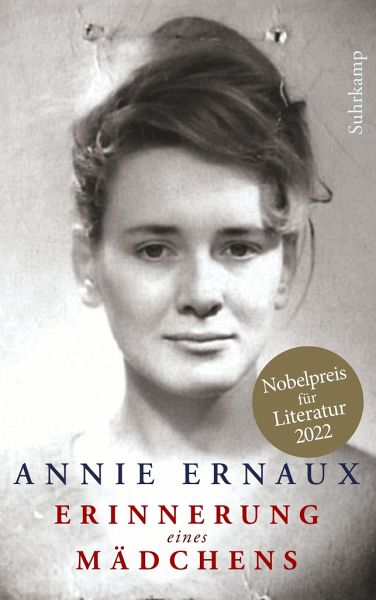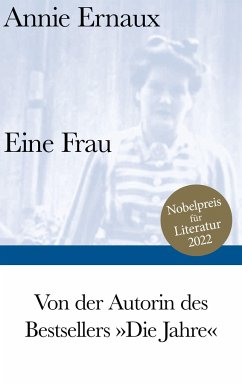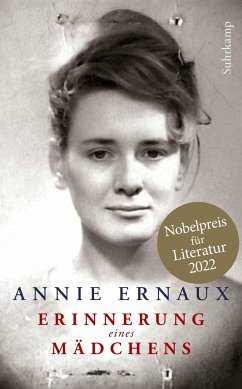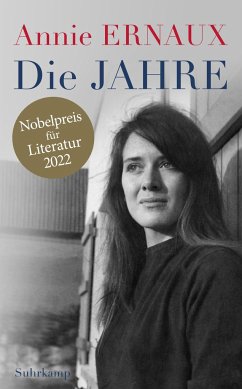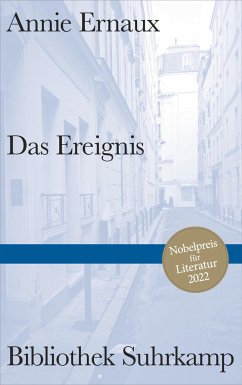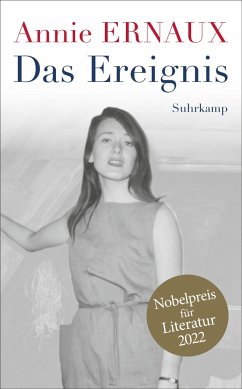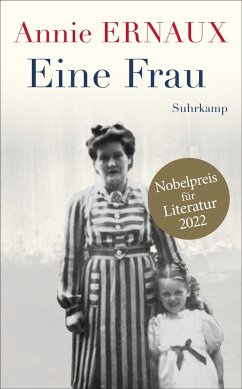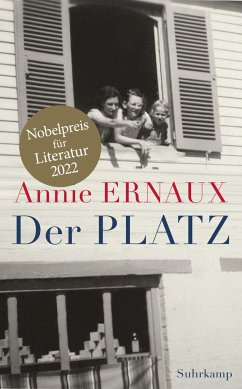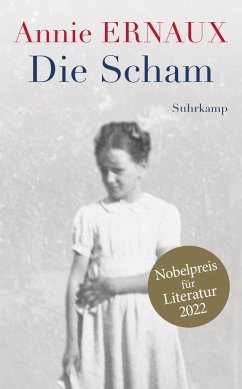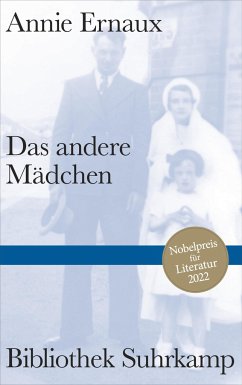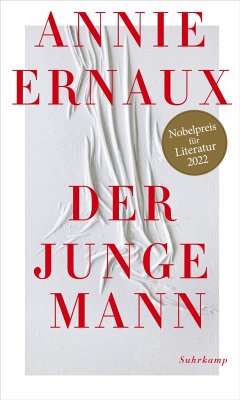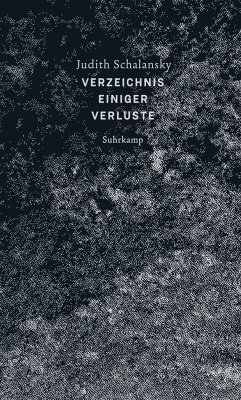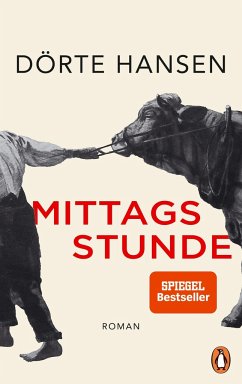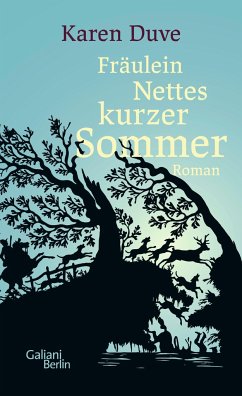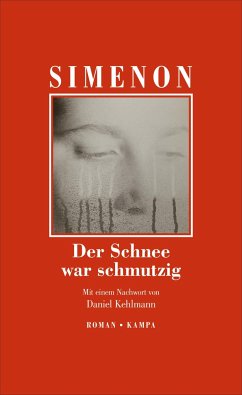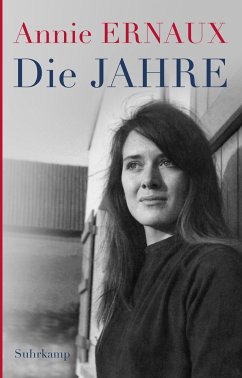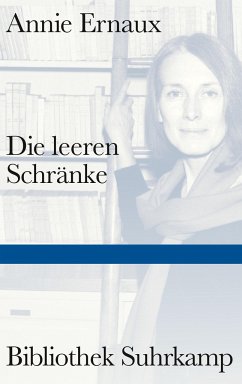Annie Ernaux
Gebundenes Buch
Erinnerung eines Mädchens
Nobelpreis für Literatur 2022
Übersetzung: Finck, Sonja
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Nobelpreis für Literatur 2022Sommer 1958: Annie Duchesne wird 18 Jahre alt. Sie arbeitet als Betreuerin in einer Ferienkolonie. Sie findet in eine Clique, zusammen feiern sie Feten, genießen ihre Jugend. Und Annie ist in H. verliebt, mit ihm hat sie ihr erstes Mal. Eine Nacht, die einen anhaltenden Schock bedeutet. Auch weil H. sie fortan ignoriert, sie weiß nicht, wohin mit sich und lässt sich auf andere ein. Schnell ist sie verfemt. Was folgt, sind Ausgrenzung, der Hohn der anderen, ihre eigene Scham. Und Schweigen. Denn über 55 Jahre braucht Annie Ernaux, um sich dieser »Erinnerung de...
Nobelpreis für Literatur 2022
Sommer 1958: Annie Duchesne wird 18 Jahre alt. Sie arbeitet als Betreuerin in einer Ferienkolonie. Sie findet in eine Clique, zusammen feiern sie Feten, genießen ihre Jugend. Und Annie ist in H. verliebt, mit ihm hat sie ihr erstes Mal. Eine Nacht, die einen anhaltenden Schock bedeutet. Auch weil H. sie fortan ignoriert, sie weiß nicht, wohin mit sich und lässt sich auf andere ein. Schnell ist sie verfemt. Was folgt, sind Ausgrenzung, der Hohn der anderen, ihre eigene Scham.
Und Schweigen. Denn über 55 Jahre braucht Annie Ernaux, um sich dieser »Erinnerung der Scham« stellen zu können - anhand von Fotografien und Briefen schreibt sie von einer Zeit, die sich in ihren Körper gebrannt hat. Die ihre Moral, ihre Sexualität, ihr ganzes langes Leben geprägt und bestimmt hat.
Mit schonungsloser Genauigkeit erzählt Annie Ernaux von ihrer ersten sexuellen Begegnung - von Macht, Ohnmacht und Unterwerfung. Von einer Wunde, die niemals ausgeheilt ist. Und vom teuer bezahlten Erkennen des eigenen Werts.
Sommer 1958: Annie Duchesne wird 18 Jahre alt. Sie arbeitet als Betreuerin in einer Ferienkolonie. Sie findet in eine Clique, zusammen feiern sie Feten, genießen ihre Jugend. Und Annie ist in H. verliebt, mit ihm hat sie ihr erstes Mal. Eine Nacht, die einen anhaltenden Schock bedeutet. Auch weil H. sie fortan ignoriert, sie weiß nicht, wohin mit sich und lässt sich auf andere ein. Schnell ist sie verfemt. Was folgt, sind Ausgrenzung, der Hohn der anderen, ihre eigene Scham.
Und Schweigen. Denn über 55 Jahre braucht Annie Ernaux, um sich dieser »Erinnerung der Scham« stellen zu können - anhand von Fotografien und Briefen schreibt sie von einer Zeit, die sich in ihren Körper gebrannt hat. Die ihre Moral, ihre Sexualität, ihr ganzes langes Leben geprägt und bestimmt hat.
Mit schonungsloser Genauigkeit erzählt Annie Ernaux von ihrer ersten sexuellen Begegnung - von Macht, Ohnmacht und Unterwerfung. Von einer Wunde, die niemals ausgeheilt ist. Und vom teuer bezahlten Erkennen des eigenen Werts.
Annie Ernaux, geboren 1940, bezeichnet sich als »Ethnologin ihrer selbst«. Sie ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit, ihre zwanzig Romane sind von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert worden. Annie Ernaux hat für ihr Werk zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Nobelpreis für Literatur. Sonja Finck übersetzt aus dem Französischen und Englischen, darunter Bücher von Jocelyne Saucier, Kamel Daoud, Chinelo Okparanta und Wajdi Mouawad. Für ihre Ernaux-Übersetzungen wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: Suhrkamp
- Originaltitel: Mémoire de fille
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 163
- Erscheinungstermin: 2. Oktober 2018
- Deutsch
- Abmessung: 213mm x 131mm x 22mm
- Gewicht: 316g
- ISBN-13: 9783518427927
- ISBN-10: 351842792X
- Artikelnr.: 52366877
Herstellerkennzeichnung
Suhrkamp Verlag
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
»Erinnerung eines Mädchens erschien ein Jahr vor #MeToo. Man kann sich kein treffenderes Buch zu diesem heiklen Gebiet zwischen Einwilligung und Missbrauch vorstellen.« Martina Läubli NZZ am Sonntag 20241124
Die Veränderung der Sichtweise der ersten sexuellen Beziehungen
Obwohl dieses Buch kein Inhaltsverzeichnis hat, möchte ich das Buch doch in drei Teile gliedern:
Im ersten Teil bis S.35 wird die Idee des Buches beschrieben: Ein Foto aus dem Sommer 1958 mit einer 18-jährigen: …
Mehr
Die Veränderung der Sichtweise der ersten sexuellen Beziehungen
Obwohl dieses Buch kein Inhaltsverzeichnis hat, möchte ich das Buch doch in drei Teile gliedern:
Im ersten Teil bis S.35 wird die Idee des Buches beschrieben: Ein Foto aus dem Sommer 1958 mit einer 18-jährigen: „Das Mädchen auf dem Foto bin nicht ich“ (S.19) schreibt Ernaux und hat damit Recht und Unrecht. Einerseits war sie auf dem Bild, aber bis 2014 -56 Jahre später schrieb sie diese Geschichte- ist sie eine andere geworden. Die Autorin nutzt dies, um ihr damaliges Leben in der dritten Person zu beschreiben. Gedanken beim Schreiben lesen wir in der Ich-Form.
Bis zum Sommer 1958 lebte sie als einziges Kind einer Krämerfamilie in Nordfrankreich in sehr katholischen Verhältnissen, war sehr gut in der Schule und las viel.
Im zweiten Teil besucht sie im Sommer 1958 eine Ferienfreizeit als Betreuerin, ohne Eltern, und macht ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Es ist eben immer die Frage, was im Sex freiwillig ist, ihre Jungfräulichkeit hat sie jedenfalls nicht verloren: „Ich erinnere nicht, wie viele Male er versucht hat, in sie einzudringen, und sie ihm stattdessen einen geblasen hat. Einmal erklärt er, wie um das zu entschuldigen: „Ich bin halt gut bestückt.““ (S.46). In diesem Abschnitt braucht man wahrhaft dicke Eier, denn von nun an verführt sie alle Betreuer bis sie nach drei Wochen noch einmal, diesmal ausdrücklich freiwillig ein Nacht mit Liebhaber H verbringt.
Auf Seite 85 beginnt der diesmal auch im Druck getrennte dritte Teil. Das Leben nach dem Ferienlager verläuft in gesitteteren Bahnen. Sie vermisst H. Sie lebt während einer Ausbildung zur Grundschullehrerin in einem Nonnenkloster und darf keine anzüglichen Witze mehr machen.
Selbst ihre Periode setzt aus. Blut spielt schon vorher eine wichtige Rolle. Als sie erkennt, dass sie keine geborene Lehrerin ist, geht sie mit ihrer Freundin als Aupair nach England. Ihre Freundin wird beim Ladendiebstahl erwischt, worauf die beiden noch seriöser werden. Das Buch endet mit unserer Protagonistin als fleißige und zufriedene, wieder mit Blutungen lebende Literaturstudentin.
Ich habe nur Kritiken von Frauen über diese Erzählung gelesen. Ich kann nur wenige politische Bezüge erkennen, weiß nicht ob es der Frauenbewegung hilft und sehe erst recht nicht was das ganze Land damit anfangen soll.
Für mich zeigt dieses Werk wie aus einem Mädchen eine Erwachsene wird und wie die Sicht auf diese Metamorphose sich im Wandel der Zeit ändert. Mit anderen Worten, den Schlussworten, formuliert dies auch die Autorin als ihr Ziel. 5 Sterne, da es auch ohne Politik unterhaltsam ist.
Lieblingszitat:
Einmal hat eine Klassenkameradin kichernd auf ein Zitat von Paul Claudel in dem katholischen Kalender gezeigt, den das Pensionat verteilte: „Für einen Mann gibt es kein größeres Glück, als seinen Samen in fruchtbaren Boden zu pflanzen.“ Sie verstand nicht, was daran obszön war. (S.29)
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Weder Fisch noch Fleisch
Die in Frankreich als literarische Legende geltende Annie Ernaux hat mit «Erinnerung eines Mädchens» ihrem überwiegend autobiografischen Œuvre jetzt auch noch die Geschichte ihrer sexuellen Initiation hinzugefügt. Mit der Verarbeitung …
Mehr
Weder Fisch noch Fleisch
Die in Frankreich als literarische Legende geltende Annie Ernaux hat mit «Erinnerung eines Mädchens» ihrem überwiegend autobiografischen Œuvre jetzt auch noch die Geschichte ihrer sexuellen Initiation hinzugefügt. Mit der Verarbeitung ihres Lebens hat sie ihr ureigenes Sujet gefunden, in ihrer spezifischen Gedächtnisliteratur verschmelzen Individuelles und Kollektives symbiotisch miteinander.
«Es gibt Menschen, die überwältigt werden von der Gegenwart anderer» lautet der erste Satz in einer Art Vorwort. Gebannt von der Präsenz eines dominanten Mannes wird die knapp 18jährige Annie Duchesne zum willenlosen Opfer ihres «Herrn», den die Autorin, wie auch andere ihrer Figuren, nur mit einem Buchstaben benennt. Das Mädchen, behütetes Einzelkind aus einfachen Verhältnissen, streng katholisch erzogen, steigt am 14. August 1958, von Rouen kommend, aus dem Zug, um als Betreuerin in einem Erholungsheim für Kinder zu arbeiten. Drei Tage später landet sie mit H, dem breitschultrigen Chefbetreuer, während einer wilden Party im Bett. Das erstmals aus der strengen Obhut ihrer Eltern befreite, völlig unerfahrene, naive Mädchen ist fasziniert von dem orgiastischen Treiben und lässt willenlos alles mit sich geschehen. Es gelingt H aber nicht, in sie einzudringen, sie ist total verkrampft, er wendet sich abrupt von ihr ab. Sie stürzt sich daraufhin in wahllose Abenteuer mit anderen Kollegen, ohne dass es dabei aber je zum Vollzug kommt. Diese Zäsur in ihrem Leben wird begleitet von Phasen der Bulimie und Kleptomanie, sie ist völlig aus der Bahn geworfen und wird von ihren Kollegen gnadenlos verhöhnt. Lebenslang begleitet sie nun diese traumatische Erfahrung und die tiefe Scham darüber. Ihre Jungfernschaft verliert sie erst sechs Jahre später bei dem Mann, den sie heiratet, fortan heißt sie Annie Ernaux.
Dieses Buch einer problembeladenen Emanzipation ist eher aus einer soziologischen Perspektive heraus geschrieben als aus einer literarischen, Sentimentalitäten, Tränen womöglich kommen da gar nicht erst auf. Die Autorin hat für ihr absolut eigenständige Werk eine kühne Konstruktion gewählt, indem sie versucht, sich als Autobiografin, aus einem Abstand von mehr als sechzig Jahren schreibend, neben das junge Mädchen von damals zu stellen, quasi parallel aus deren damaliger Perspektive zu erzählen. Dementsprechend wechselt in den fraktionell aufgeteilten Abschnitten immer wieder der Erzähler, wird häufig von der ersten zur dritten Person umgeschaltet, vom «ich» zum «sie». In ihrer narrativen Symbiose von Autobiographie und Chronik will die Autorin keine Interpretationen akzeptieren, nichts glätten. «Ich konstruiere keine Romanfigur. Ich dekonstruiere das Mädchen, das ich gewesen bin». Bei ihrer Suche nach Wahrheit im Erinnerten nutzt Annie Ernaux zur Recherche alle Möglichkeiten der modernen Kommunikation, ohne dass sie der inneren Wahrheit damit auch wirklich nahe kommt.
Ihr Leben ist, wie nicht anders zu erwarten, von früh an literarisch geprägt, das essayistische Buch weist mit seiner üppigen Intertextualität deutlich darauf hin, zitiert zudem auch Spielfilme und Musiktitel. Der Leser erlebt den Prozess des Schreibens unmittelbar mit, er wird zudem sehr direkt mit den Zweifeln am Erinnerten, an den scheinbaren Gewissheiten konfrontiert. Stilistisch nüchtern und präzise geschrieben, wirkt ihr lakonisch anmutender Text ohne jedes Pathos gleichwohl verstörend. Unbehaglich war mir als Leser, dass etliche Ungereimtheiten und andere Zweifel hier ja nicht einfach als Fiktion abgetan werden können, es ist erklärtermaßen alles autobiografisch, also real. Als Mann frage ich mich aber auch, ob geschildertes Gefühlschaos und daraus resultierendes Verhalten denn wirklich Realität gewesen sein können. Ich habe meine Zweifel an diesem Seelenstriptease, aber auch an dieser poststrukturalistischen Literatur. Sie ist weder Fisch noch Fleisch, sie überzeugt mich als psychologische Studie ebenso wenig wie als Belletristik.
Weniger
Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für