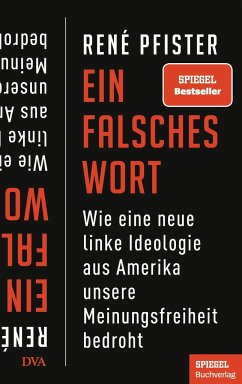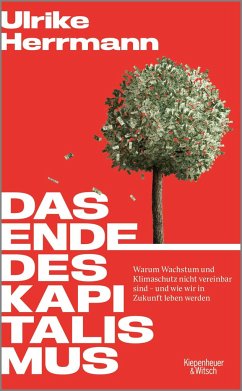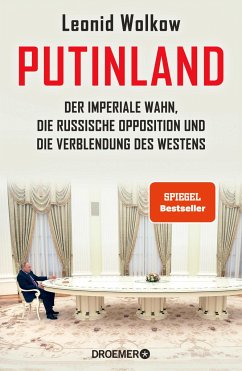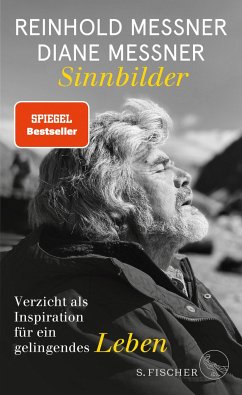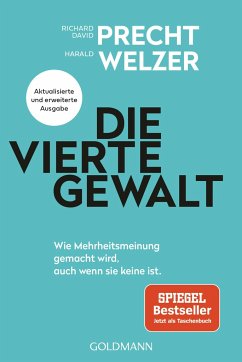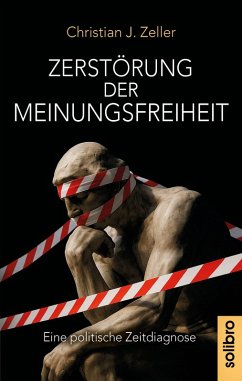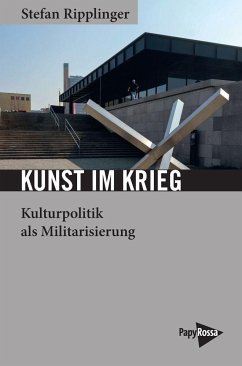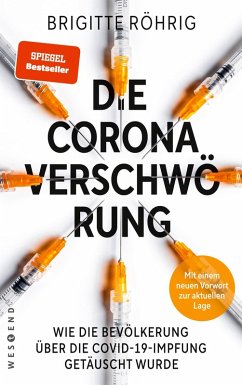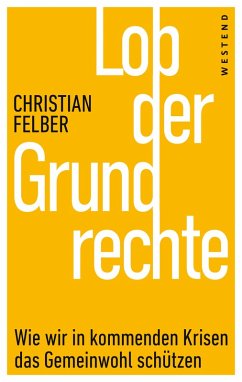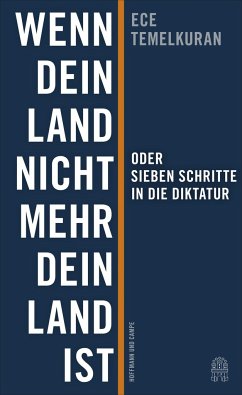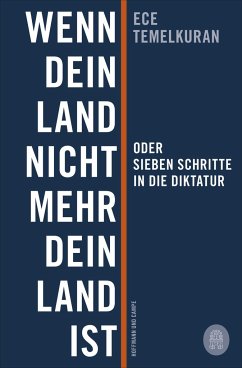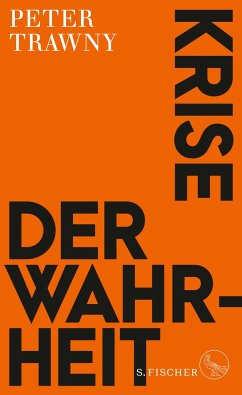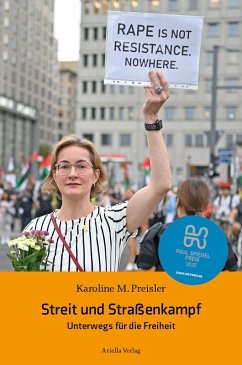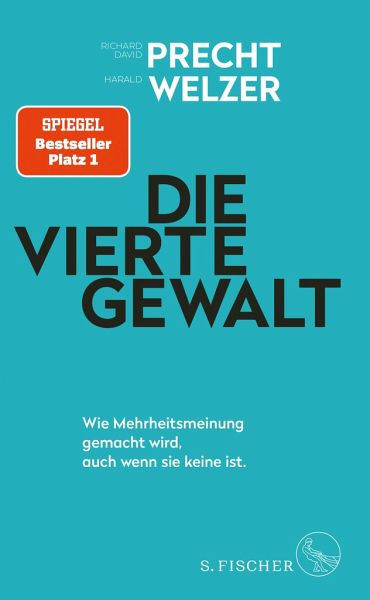
Die vierte Gewalt
Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das erste gemeinsame Buch der beiden Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer: Wie Massenmedien die Demokratie gefährdenWas Massenmedien berichten, weicht oft von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung ab - gerade, wenn es um brisante Geschehnisse geht. So entsteht häufig der Eindruck, die Massenmedien in Deutschland seien von der Regierung oder »dem Staat« manipuliert. Aber die heutige Selbstangleichung der Medien hat mit einer gelenkten Manipulation nichts zu tun. Die Massenmedien in Deutschland sind keine Vollzugsorgane staatlicher Meinungsmache. S...
Das erste gemeinsame Buch der beiden Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer: Wie Massenmedien die Demokratie gefährden
Was Massenmedien berichten, weicht oft von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung ab - gerade, wenn es um brisante Geschehnisse geht. So entsteht häufig der Eindruck, die Massenmedien in Deutschland seien von der Regierung oder »dem Staat« manipuliert. Aber die heutige Selbstangleichung der Medien hat mit einer gelenkten Manipulation nichts zu tun. Die Massenmedien in Deutschland sind keine Vollzugsorgane staatlicher Meinungsmache. Sie sind die Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache: mit immer stärkerem Hang zum Einseitigen, Simplifizierenden, Moralisierenden, Empörenden und Diffamierenden. Und sie bilden die ganz eigenen Echokammern einer Szene ab, die stets darauf blickt, was der jeweils andere gerade sagt oder schreibt, ängstlich darauf bedacht, bloß davon nicht abzuweichen. Diese Angst ist der bestmöglicheDünger für den Zerfall der Gesellschaft. Denn Maßlosigkeit und Einseitigkeit des Urteils zerstören den wohlmeinenden Streit, das demokratische Ringen um gute Lösungen.
In ihrem ersten gemeinsamen Buch analysieren die Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer die Mechanismen, die in diese Sackgasse führen: Wie kann eine liberale Demokratie mit pluraler Medienlandschaft sich selbst so gefährden? Wie ist es in Deutschland, dem Land einer lange vorbildlichen Qualitätspresse und eines im internationalen Vergleich ebenso vorbildlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu gekommen? Wie konnte und kann die Medienlandschaft durch die »vierte Gewalt« selbst unfreier werden? Und was bildet das veröffentlichte Meinungsbild ab, wenn es mit dem öffentlichen so wenig übereinstimmt?
Wir müssen verstehen, wie unsere Demokratie nicht durch Willkür und Macht »von oben«, sondern aus der Sphäre der Öffentlichkeit selbst unterspült wird - erst dann kann die »vierte Gewalt« ihrer Rolle wieder gerecht werden.
Was Massenmedien berichten, weicht oft von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung ab - gerade, wenn es um brisante Geschehnisse geht. So entsteht häufig der Eindruck, die Massenmedien in Deutschland seien von der Regierung oder »dem Staat« manipuliert. Aber die heutige Selbstangleichung der Medien hat mit einer gelenkten Manipulation nichts zu tun. Die Massenmedien in Deutschland sind keine Vollzugsorgane staatlicher Meinungsmache. Sie sind die Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache: mit immer stärkerem Hang zum Einseitigen, Simplifizierenden, Moralisierenden, Empörenden und Diffamierenden. Und sie bilden die ganz eigenen Echokammern einer Szene ab, die stets darauf blickt, was der jeweils andere gerade sagt oder schreibt, ängstlich darauf bedacht, bloß davon nicht abzuweichen. Diese Angst ist der bestmöglicheDünger für den Zerfall der Gesellschaft. Denn Maßlosigkeit und Einseitigkeit des Urteils zerstören den wohlmeinenden Streit, das demokratische Ringen um gute Lösungen.
In ihrem ersten gemeinsamen Buch analysieren die Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer die Mechanismen, die in diese Sackgasse führen: Wie kann eine liberale Demokratie mit pluraler Medienlandschaft sich selbst so gefährden? Wie ist es in Deutschland, dem Land einer lange vorbildlichen Qualitätspresse und eines im internationalen Vergleich ebenso vorbildlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu gekommen? Wie konnte und kann die Medienlandschaft durch die »vierte Gewalt« selbst unfreier werden? Und was bildet das veröffentlichte Meinungsbild ab, wenn es mit dem öffentlichen so wenig übereinstimmt?
Wir müssen verstehen, wie unsere Demokratie nicht durch Willkür und Macht »von oben«, sondern aus der Sphäre der Öffentlichkeit selbst unterspült wird - erst dann kann die »vierte Gewalt« ihrer Rolle wieder gerecht werden.